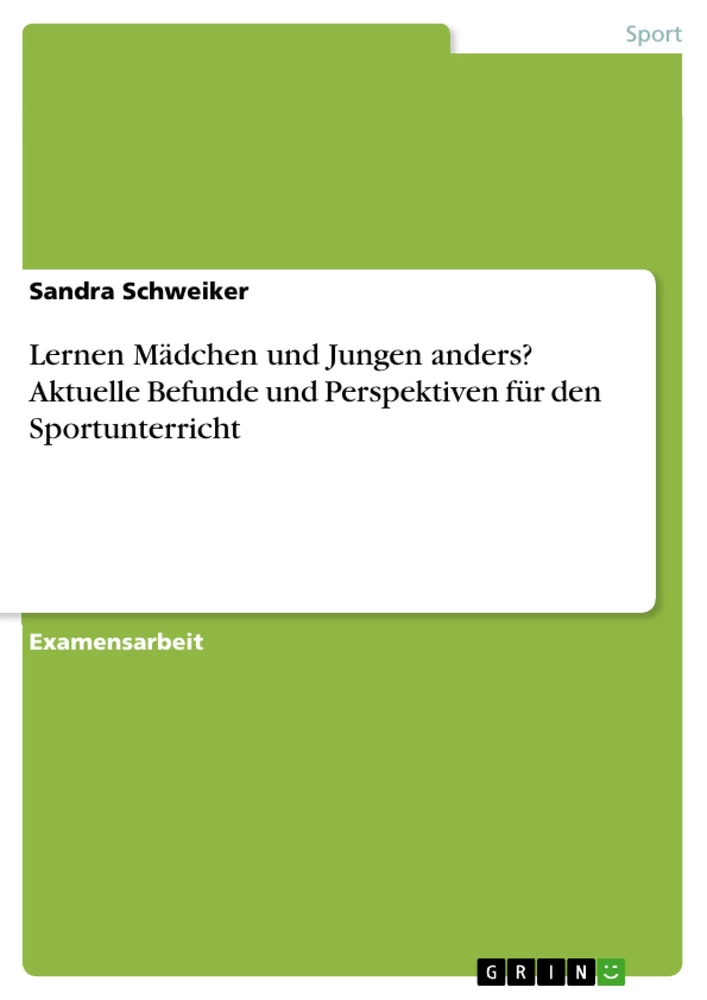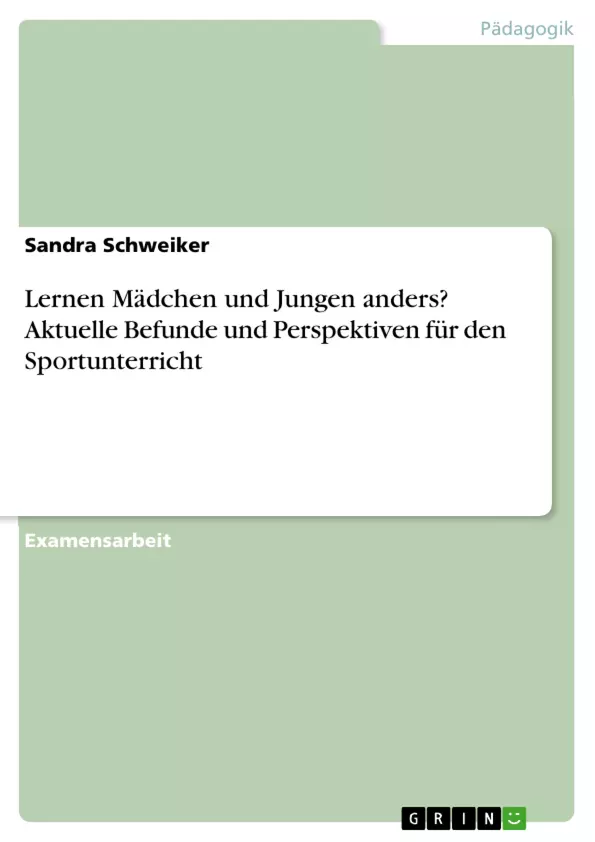Seit den 60er Jahren ist das koedukative Unterrichten von Mädchen und Jungen an öffentlichen Schulen in der Bundesrepublik Deutschland zur Normalität geworden. Reine Mädchen- oder Jungenschulen sind hierzulande nur noch selten vorzufinden, da ein gesellschaftlicher Konsens hinsichtlich des gemeinsamen Unterrichtens beider Geschlechter besteht.
Trotz alledem gibt es Ausnahmen, in denen alte Klischees wieder aufkommen und die Frage nach dem Für und Wider des koedukativen Unterrichts neu gestellt wird. Eine dieser Ausnahmen bildet der Sportunterricht und es scheint, als wäre das gemeinsame Unterrichten von Mädchen und Jungen in diesem Fach nach wie vor eine besondere pädagogische Situation. So hat das Fach Sport eine von vielen Schülern, Lehrkräften und Eltern akzeptierte Sonderstellung im Fächerkanon inne, da es hier im Gegensatz zu allen anderen Fächern stets als natürlich empfunden wird, über Sinn und Unsinn, Vor- und Nachteile, Positives und Negatives der Koedukation zu diskutieren.
Viele Kritiker sehen Nachteile in der Realisierung koedukativen Sportunterrichts. Sie wenden ein, dass es zu große Unterschiede bezüglich der sportlichen Leistungsfähigkeit zwischen Mädchen und Jungen gibt und zudem die Interessen und Neigungen der Geschlechter im Sport zu verschieden seien. Befürworter hingegen sehen das soziale Lernen,wie es in Form einer Interaktion der Geschlechter beim koedukativen Lernen zum Tragen kommt, als entscheidendes Kriterium für ein gemeinsames Unterrichten.
Gerade in der heutigen Gesellschaft gewinnen soziale Kompetenzen zunehmend an Bedeutung. Sie werden im derzeitigen Berufsleben, wo ein immer größerer Wert auf Teamfähigkeit gelegt wird, als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. Problematisch ist jedoch, dass Kindern heutzutage in ihrem familiären Umfeld soziale Kompetenzen nicht mehr ausreichend vermittelt werden, da sie oftmals als Einzelkinder aufwachsen, deren Eltern beide berufstätig sind und ihnen der soziale Kontakt zu Gleichaltrigen fehlt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Vorgehensweise
- Geschlechterdiskurs in der Sportpädagogik
- Zum Begriff „Koedukation“
- Koedukation im Sportunterricht
- Geschlechtertypisierung im Kontext der peer-culture
- Theoretische Grundlagen zum sozialen Lernen
- Theoretische Grundlagen zur Unterrichtsmethode ,,Kooperatives Lernen"
- Kooperatives Lernen als Chance im gegenwärtigen Schulalltag
- Zur Begründung kooperativer Lernformen im Sportunterricht
- Definition kooperativer Lernformen
- Merkmale des kooperativen Lernens
- Gemeinsames Gruppenziel
- Spielraum für Entscheidungen
- Individuelle Verantwortlichkeit in Bezug auf das Gruppenziel
- Positive Interdependenz in Bezug auf den Lernprozess
- Rahmenbedingungen für kooperatives Lernen
- Zusammensetzung der Gruppe
- Bereitschaft der Lernenden zur Kooperation
- Individuelle Kompetenzen zur Kooperation
- Die Rolle des Lehrers
- Auswahl der Unterrichtsmethode
- Aufgabenstellung
- Begleiten der Lernprozesse
- Ergebnissicherung der Lern- und Gruppenprozesse
- Belohnungsstrukturen kooperativen Lernens
- Positive Wirkungsaspekte des kooperativen Lernens in bisherigen Studien
- Effekte kooperativen Lernens im Sportunterricht
- Problemebenen kooperativen Lernens im Sportunterricht
- Einsatzgebiete für kooperatives Lernen
- Zur Studie „Analyse geschlechtstypischer Handlungsmuster beim kooperativen Lernen in einem peer-basierten Sportunterricht“ - Bisherige Befundlage
- Fragestellung und Untersuchungsansatz
- Datenerhebung
- Datenaufbereitung und -auswertung
- Ergebnisdarstellung
- Ergebnisse zu den Prozessvariablen (Fragestellung 1)
- Ergebnisse zu den Wirkungsvariablen (Fragestellung 2)
- Interpretation der bisherigen Ergebnisse
- Offene Befundlage
- Empirischer Untersuchungsansatz
- Offene Fragestellung
- Untersuchungsansatz
- Begründung der qualitativen Vorgehensweise
- Die Einzelfallanalyse
- Untersuchungsgegenstand
- Untersuchungsergebnisse
- Beschreibung der Lerngruppen
- Lerngruppe F1
- Lerngruppe B1
- Verlaufskizzen des Gruppengeschehens
- Verlaufsskizze der Lerngruppe F1
- Entwicklungen innerhalb der Lerngruppe F1
- Verlaufsskizze der Lerngruppe B1
- Entwicklungen innerhalb der Lerngruppe B1
- Analyse des Gruppengeschehens
- Auswahlkriterien für bestimmte Kinder
- Auswahl der Schlüsselszenen
- Lerngruppe F1
- Ausgewählte Kinder der Lerngruppe F1
- Begründung der Auswahl bestimmter Videosequenzen
- Schlüsselszene
- Lerngruppe B1
- Ausgewählte Kinder der Lerngruppe B1
- Begründung der Auswahl einer bestimmten Videosequenz
- Schlüsselszene
- Interpretation
- Geschlechterdifferenzen im Sportunterricht
- Soziale Lernprozesse und Kooperation
- Kooperatives Lernen als Unterrichtsmethode im Sportunterricht
- Analyse von geschlechtsspezifischen Handlungsmustern im kooperativen Lernen
- Empirische Untersuchung anhand von Videoanalysen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Examensarbeit befasst sich mit der Frage, ob Mädchen und Jungen im Sportunterricht unterschiedlich lernen. Sie analysiert die aktuelle Befundlage zu geschlechtsspezifischen Handlungsmustern im Kontext des kooperativen Lernens im Sportunterricht. Dabei werden theoretische Grundlagen des sozialen Lernens und der Unterrichtsmethode „Kooperatives Lernen“ beleuchtet. Die Arbeit untersucht, welche Rahmenbedingungen und Wirkungsaspekte des kooperativen Lernens im Sportunterricht zu berücksichtigen sind und welche Herausforderungen sich aus der Anwendung dieser Unterrichtsmethode ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Vorgehensweise der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet den Geschlechterdiskurs in der Sportpädagogik und diskutiert den Begriff „Koedukation“ sowie die Bedeutung von Geschlechtertypisierung im Kontext der peer-culture. Kapitel 3 und 4 befassen sich mit den theoretischen Grundlagen des sozialen Lernens und der Unterrichtsmethode „Kooperatives Lernen“. Kapitel 5 analysiert die aktuelle Befundlage zu geschlechtsspezifischen Handlungsmustern beim kooperativen Lernen in einem peer-basierten Sportunterricht. Kapitel 6 beschreibt den empirischen Untersuchungsansatz, der zur Klärung der Fragestellung eingesetzt wird. Kapitel 7 präsentiert die Untersuchungsergebnisse der Videoanalysen von zwei Lerngruppen.
Schlüsselwörter
Koedukation, Sportunterricht, Geschlechtertypisierung, Peer-culture, soziales Lernen, kooperatives Lernen, Handlungsmuster, Videoanalyse, qualitative Forschung, Einzelfallanalyse
Häufig gestellte Fragen
Lernen Mädchen und Jungen im Sportunterricht unterschiedlich?
Die Arbeit analysiert geschlechtsspezifische Handlungsmuster und zeigt, dass Interessen, Leistungsfähigkeit und soziale Interaktionen zwischen den Geschlechtern variieren können.
Was versteht man unter kooperativem Lernen im Sport?
Es ist eine Unterrichtsmethode, bei der Schüler in Gruppen gemeinsame Ziele verfolgen. Merkmale sind positive Interdependenz, individuelle Verantwortlichkeit und Spielraum für Entscheidungen.
Welche Rolle spielt die Koedukation im Sportunterricht?
Obwohl gemeinsamer Unterricht Standard ist, wird im Sport oft über Vor- und Nachteile diskutiert, da körperliche Unterschiede und tradierte Rollenbilder hier besonders deutlich werden.
Wie beeinflusst die Peer-Culture das Verhalten im Sport?
In der Peer-Group finden oft Geschlechtertypisierungen statt, die das sportliche Handeln und die gegenseitige Wahrnehmung von Mädchen und Jungen stark prägen.
Was sind die Vorteile des kooperativen Lernens?
Es fördert soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Kommunikation, die in der heutigen Gesellschaft und Arbeitswelt als Schlüsselqualifikationen vorausgesetzt werden.
- Citation du texte
- Sandra Schweiker (Auteur), 2006, Lernen Mädchen und Jungen anders? Aktuelle Befunde und Perspektiven für den Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55480