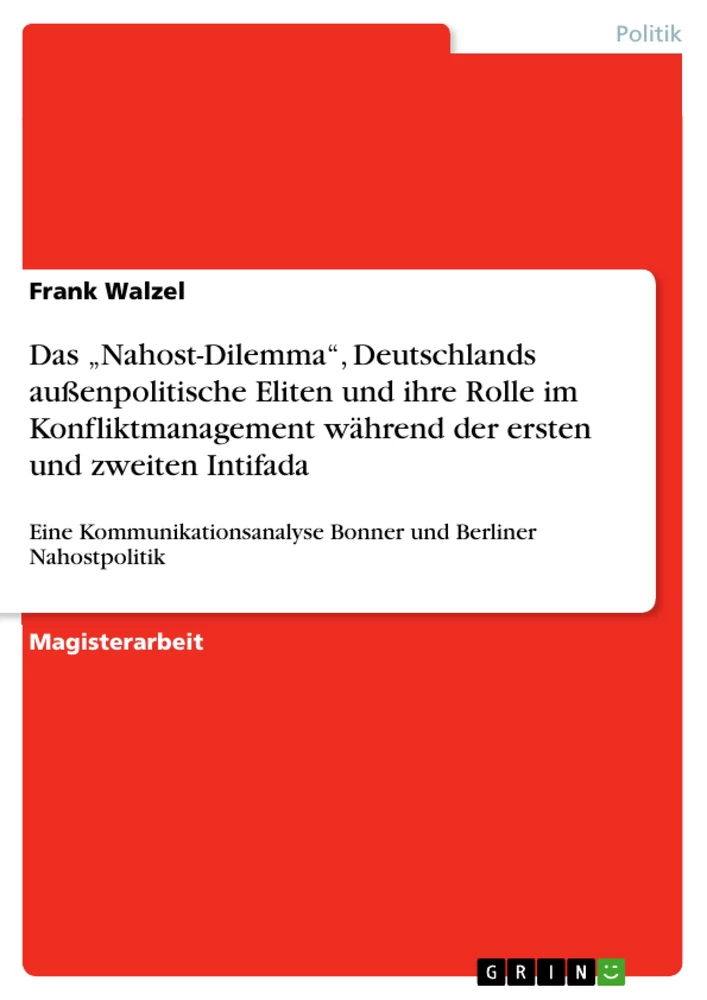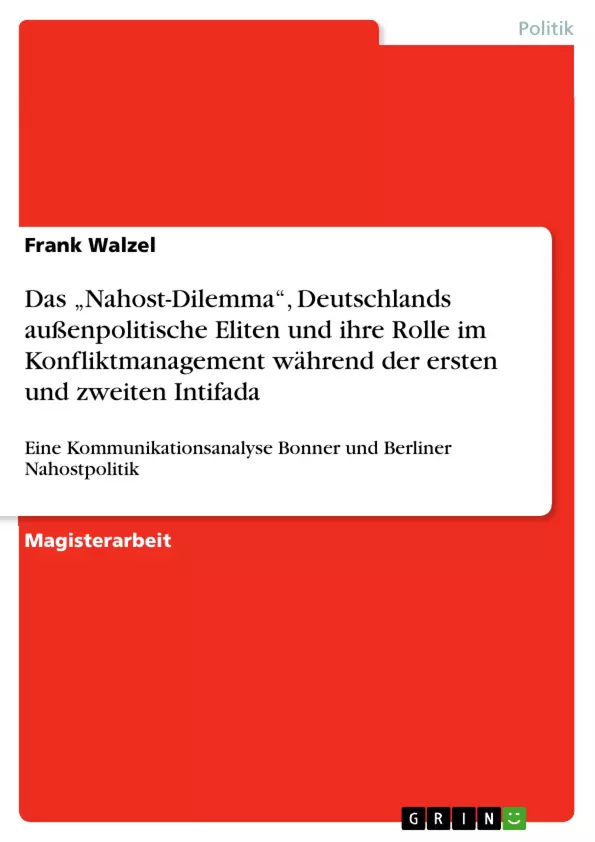Keine andere Region der Welt hält für deutsche Außenpolitiker ähnlich viele Fallstricke und Dilemmata bereit wie der Nahe Osten. Gefangen zwischen den historisch begründeten „besonderen“ Beziehungen zum Staat Israel und dem wirtschaftlichen wie politischen Interesse an den arabischen Staaten wird die Suche nach einem Standpunkt zum Nahostkonflikt für die außenpolitischen Eliten zur „Quadratur des Dreiecks“ (vgl. Jaeger 1997) zwischen Palästinensern, Israel und den USA. Aufgrund des Entscheidungsdrucks, den dieses Dilemma verursacht, entschied man sich in Deutschland dazu, in dieser Frage dem außenpolitischen Kurs der EU zu folgen. Dies veranlasste vor allem die bundesrepublikanische Nahostpolitik dem inneren Entscheidungsdruck dadurch zu entgehen, indem sie den Anschluss an die europäische außenpolitische Linie gesucht hatte. Als der Konflikt zu einem Aufstand der Palästinenser, der Intifada, anwuchs und zugleich eine Ende des Ost-West-Konflikts in greifbare Nähe rückte, verschoben sich die außenpolitischen Schwerpunkte und dies stellte die europäische und mit ihr die deutsche Nahostpolitik vor völlig neue Herausforderungen. Um den Leser mit den notwendigsten Hintergrundinformationen zu versorgen, liefert das erste Kapitel eine kurze Darstellung sowohl deutscher Außenpolitik in der Region als auch des Nahostkonflikts an sich, ohne die ein Verständnis der nachfolgenden Ereignisse nur schwer auskommt.
Neben der wirtschaftlichen Unterstützung der Region mussten sich die außenpolitischen Eliten fragen, ob die Rolle eines „Konfliktmanagers“ für die deutsche Außenpolitik im Rahmen der EG/EU angebracht wäre. Spätestens mit dem Ausbruch der Zweiten Intifada im September 2000 wurde die Dringlichkeit eines deutschen und europäischen Konfliktmanagements für den „Nahen“ Osten jedoch überdeutlich. Genau an diesem Punkt setzt die zentrale Frage der Untersuchung dieser Arbeit ein: Wie positionieren sich die deutschen außenpolitischen Eliten gegenüber dem Nahostkonflikt und in welcher Rolle sehen sie sich selber bei der Schlichtung bzw. dem Konfliktmanagement der Intifada? Um die Analyse der Fragestellung auf eine solide Datengrundlage zu stellen, wurden sowohl das Bulletin der Bundesregierung als auch die Plenarprotokolle des Deutschen Bundestages für die Zeiträume 1987 bis 1993 und 2000 bis 2005 ausgewählt und nach qualitativen Gesichtspunkten ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutsche Außenpolitik und der Nahostkonflikt
- Konflikt und Intifada
- Der Nahostkonflikt
- Sondertypen
- Deutsche Nahostpolitik
- Die „,eindeutige Israel-Option“
- ,,Politik der Ausgewogenheit“
- Rollentheorie, Außenpolitik und Inhaltsanalyse
- Grundlagen der Rollentheorie
- Rollentheorie in der außenpolitischen Analyse
- Ursprung
- Rollentheorie und Außenpolitik
- Rollenkonzeptionen
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Grundlagen
- Ablaufmodell
- Kategorien
- Deutschlands außenpolitische Eliten und die Erste Intifada (1987-1993)
- Kontinuität trotz Systemumbruch
- Das Wesen des Konfliktmanagements
- Definition
- Vermittlungsformen
- Bundesrepublikanische und gesamtdeutsche Nahostpolitik zwischen der Passiv-Aktiv-Position und Aktiv-Aktiv-Position
- Bulletin der Bundesregierung (1987-1993)
- Plenarprotokolle des Bundestages (1987-1993)
- Bundesrepublikanische Rhetorik während des Ost-West-Konflikts
- Gesamtdeutsche Rhetorik nach dem Ost-West-Konflikt
- Analyse: Wohlwollende Vernachlässigung?
- Deutschlands außenpolitische Eliten und die Zweite Intifada
- Deutsche Nahostpolitik zwischen der Passiv-Aktiv-Position und Aktiv-Aktiv-Position
- Bulletin der Bundesregierung (2000-2005)
- Plenarprotokolle des Bundestags (2000-2005)
- Vor dem 11. September 2001
- Die Nachwehen des 11. Septembers
- Von der „Roadmap“ zu den palästinensischen Präsidentenwahlen
- Analyse: Primus inter pares?
- Bewertung: „Alte“ vs. „neue“ deutsche Nahostpolitik?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle deutscher außenpolitischer Eliten im Konfliktmanagement während der Ersten und Zweiten Intifada. Sie analysiert die Kommunikation der Eliten in Bezug auf den Nahostkonflikt, wobei sie sich auf die Zeiträume 1987-1993 und 2000-2005 konzentriert.
- Die Analyse befasst sich mit dem Wandel deutscher Nahostpolitik im Kontext der Intifada.
- Sie untersucht die Kommunikation der Eliten über die Rolle Deutschlands im Konfliktmanagement.
- Die Arbeit analysiert die Selbstwahrnehmung der Eliten als Akteure im Nahostkonflikt.
- Sie beleuchtet die Bedeutung des Ost-West-Konflikts und des 11. Septembers für die deutsche Nahostpolitik.
- Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle Deutschlands als „Konfliktmanager“ im Nahostkonflikt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die Methodik. Kapitel 1 beleuchtet den Nahostkonflikt und die deutsche Außenpolitik in der Region. Kapitel 2 stellt die Grundlagen der Rollentheorie und die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse vor. Kapitel 3 analysiert die Kommunikation der Eliten während der Ersten Intifada. Kapitel 4 setzt sich mit der Kommunikation während der Zweiten Intifada auseinander. Das letzte Kapitel beinhaltet eine Bewertung der Ergebnisse und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Nahostkonflikt, Intifada, deutsche Außenpolitik, Konfliktmanagement, Rollentheorie, Inhaltsanalyse, Kommunikation, politische Eliten und Selbstwahrnehmung. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle Deutschlands als „Konfliktmanager“ und untersucht die Kommunikation deutscher außenpolitischer Eliten in Bezug auf den Nahostkonflikt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Nahost-Dilemma“ der deutschen Außenpolitik?
Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen der historischen Verantwortung gegenüber Israel und den wirtschaftlichen sowie politischen Interessen an den arabischen Staaten.
Welche Rolle spielten die deutsche Eliten während der Intifadas?
Die Arbeit untersucht, wie sich deutsche außenpolitische Eliten als „Konfliktmanager“ positionierten und welche rhetorischen Strategien sie im Konfliktmanagement verfolgten.
Welche Quellen wurden für die Analyse verwendet?
Die Untersuchung basiert auf der qualitativen Auswertung des Bulletins der Bundesregierung und der Plenarprotokolle des Deutschen Bundestages (Zeiträume 1987-1993 und 2000-2005).
Wie beeinflusste der 11. September die deutsche Nahostpolitik?
Die Arbeit analysiert die Verschiebungen in der Kommunikation und Strategie der Eliten infolge der Nachwehen der Terroranschläge von 2001 im Kontext der Zweiten Intifada.
Was besagt die Rollentheorie in diesem Kontext?
Die Rollentheorie dient als theoretischer Rahmen, um die Selbstwahrnehmung und die zugeschriebenen Rollen Deutschlands im internationalen Konfliktmanagement zu verstehen.
- Citar trabajo
- M.A. Frank Walzel (Autor), 2006, Das „Nahost-Dilemma“, Deutschlands außenpolitische Eliten und ihre Rolle im Konfliktmanagement während der ersten und zweiten Intifada, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57259