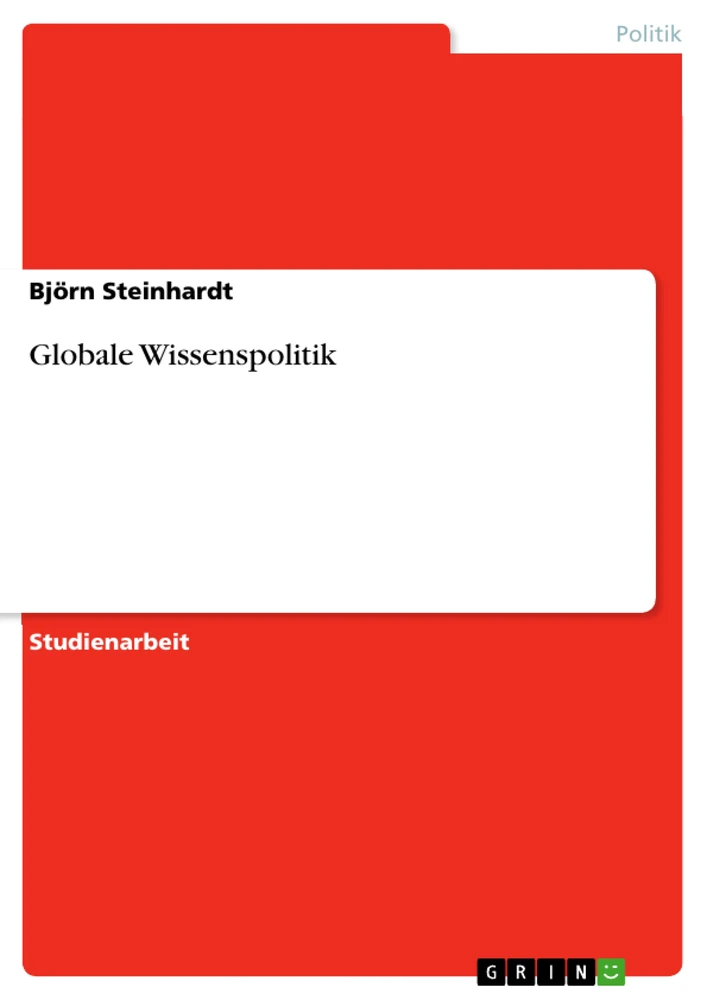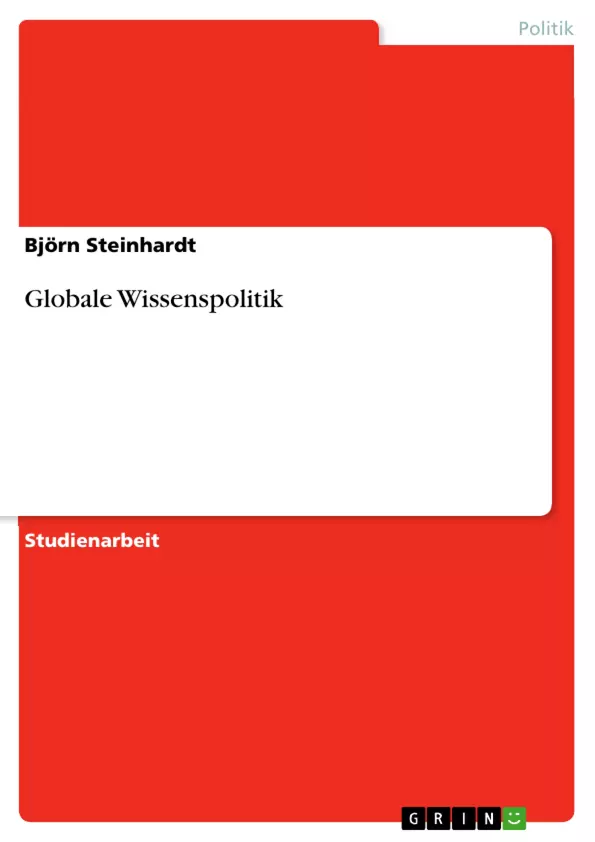Die Auseinandersetzung mit dem Tatbestand der globalen Wissenspolitik ist eng mit den Begriffen Risiko und Gefahr verbunden. Diese können im Zuge einer fortschreitenden Globalisierung zwangsläufig einen Großteil oder vielleicht sogar die gesamte Weltbevölkerung betreffen und bedrohen. Ziel dieser Ausarbeitung soll es daher sein, einige Merkmale des Risikokonzeptes von Nico Stehr darzustellen, sowie im Anschluss daran diesen den systemischen Ansatz von Helmut Willke gegenüber zu stellen. Nico Stehr vertritt grundsätzlich die Ansicht, dass die Risikoforschung in den letzten Jahren zwar Fortschritte gemacht habe, auf der anderen Seite jedoch„das Wissen über die Frage der Konstruktion und Kommunikation von Risiken in der modernen Gesellschaft fragil bleibt“und dass es schwer sei„robustes Wissen über Risiken und Gefahren zu generieren“(vgl. Stehr 2003: 262). Er geht weiterhin davon aus, dass der Versuch der Forschung, das Phänomen des Risikos durch die Unterscheidung zwischen subjektivem und objektivem Risiko erfassen zu können, unvollständig sei und Schwachstellen aufweise (vgl. ebd.: 264/265). In diesem Kontext sind in erster Linie zwei Unterscheidungen hervorzuheben, die Stehr innerhalb seiner Überlegungen vornimmt, nämlich auf der einen Seite die zwischen dem Risiko und der Gefahr und auf der anderen Seite die zwischen Entscheider und Betroffener.
Inhaltsverzeichnis
-
- Grundlagen einer globalen Wissenspolitik: Wie ist der Begriff des Risikos gekennzeichnet und welche Rolle spielt er im Zusammenhang einer globalen Wissenspolitik?
- Die Bedeutung von Risiken und Gefahren für die Wissenspolitik
- Das Risikokonzept von Nico Stehr
- Die Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr
- Die Unterscheidung zwischen Entscheider und Betroffenem
- Helmut Willkes systemischer Risikoansatz
- Der Risikobegriff und eine globale Wissenspolitik
-
- Problemdiagnose: Inwiefern haben sich die Aufgaben des Staates in den letzten Jahren gewandelt und welche Rolle spielen private Autoritäten und öffentlich-private Partnerschaften in diesem Zusammenhang?
- Einleitung
- Der Wandel der staatlichen Aufgaben
- Die Rolle privater Autoritäten und öffentlich-privater Partnerschaften
- Die Auswirkungen für eine globale Wissenspolitik
-
- Fallstudie: Mit welchen wissensbasierten Problemen sehen sich „less developed countries“ konfrontiert und was sind mögliche Lösungsansätze?
- Einleitung
- Wissensbasierte Probleme von „less developed countries“
- Lösungsansätze
- Kritik an den Konzepten des Wissensmanagements und der Wissensnetzwerke
- Abschließende Betrachtung – Konsequenzen für eine globale Wissenspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Frage, wie sich der Begriff des Risikos im Kontext einer globalen Wissenspolitik darstellt und welche Rolle er in diesem Zusammenhang spielt. Sie untersucht die Veränderungen der staatlichen Aufgaben im Zuge der Globalisierung und die Bedeutung privater Autoritäten und öffentlich-privater Partnerschaften. Des Weiteren analysiert die Arbeit die wissensbasierten Probleme von "less developed countries" und mögliche Lösungsansätze.
- Das Risikokonzept von Nico Stehr und seine Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr sowie Entscheider und Betroffenem
- Der systemische Risikoansatz von Helmut Willke und das Konzept des Systemrisikos
- Der Wandel der staatlichen Aufgaben in der Wissensgesellschaft
- Die Rolle privater Autoritäten und öffentlich-privater Partnerschaften in der globalen Wissenspolitik
- Wissensbasierte Probleme von "less developed countries" und mögliche Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Risikokonzept von Nico Stehr und untersucht dessen Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr sowie Entscheider und Betroffenem. Es stellt dieses Konzept dem systemischen Risikoansatz von Helmut Willke gegenüber und diskutiert die Bedeutung des Risikokonzepts für eine globale Wissenspolitik.
Das zweite Kapitel analysiert den Wandel der staatlichen Aufgaben im Kontext der Globalisierung und untersucht die Rolle privater Autoritäten und öffentlich-privater Partnerschaften in diesem Zusammenhang. Es zeigt die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die globale Wissenspolitik.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den wissensbasierten Problemen von "less developed countries" und untersucht mögliche Lösungsansätze. Es analysiert die Kritik an den Konzepten des Wissensmanagements und der Wissensnetzwerke und zieht abschließende Konsequenzen für eine globale Wissenspolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der globalen Wissenspolitik, Risiko und Gefahr, staatliche Aufgaben, private Autoritäten, öffentlich-private Partnerschaften, Wissensbasierte Probleme, "less developed countries", Wissensmanagement und Wissensnetzwerke.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter globaler Wissenspolitik?
Globale Wissenspolitik befasst sich mit der Steuerung und dem Management von Wissen, Risiken und Gefahren in einer globalisierten Welt, in der nationale Grenzen an Bedeutung verlieren.
Wie unterscheidet Nico Stehr zwischen Risiko und Gefahr?
Stehr unterscheidet zwischen Risiken, die aus eigenen Entscheidungen resultieren, und Gefahren, die von außen (für den Betroffenen unbeeinflussbar) auf Individuen oder Gesellschaften einwirken.
Was ist Helmut Willkes systemischer Risikoansatz?
Willke betrachtet Risiken als systemische Phänomene, die die Stabilität ganzer gesellschaftlicher Teilsysteme gefährden können und ein spezialisiertes Wissensmanagement erfordern.
Welche Rolle spielen private Autoritäten in der Wissenspolitik?
Da Staaten allein komplexe globale Probleme oft nicht lösen können, gewinnen private Akteure und öffentlich-private Partnerschaften (PPPs) an Einfluss bei der Setzung von Standards und Regeln.
Mit welchen Problemen kämpfen „less developed countries“ in der Wissensgesellschaft?
Diese Länder leiden oft unter einem mangelnden Zugang zu globalen Wissensnetzwerken und technologischen Ressourcen, was ihre Entwicklungschancen in einer wissensbasierten Weltökonomie einschränkt.
- Quote paper
- Björn Steinhardt (Author), 2006, Globale Wissenspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57919