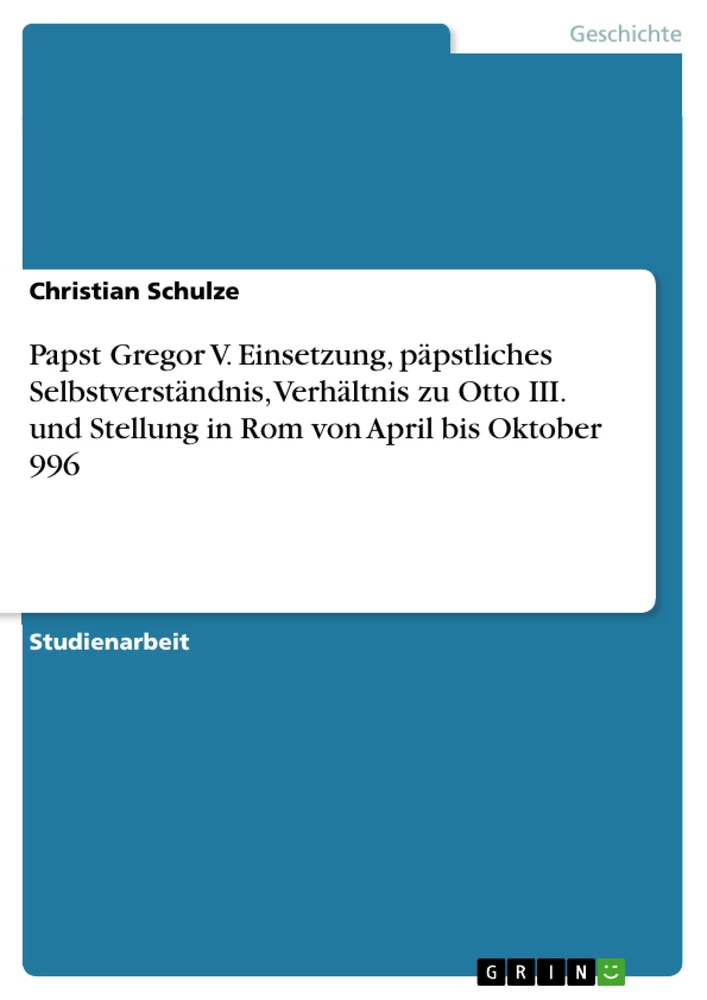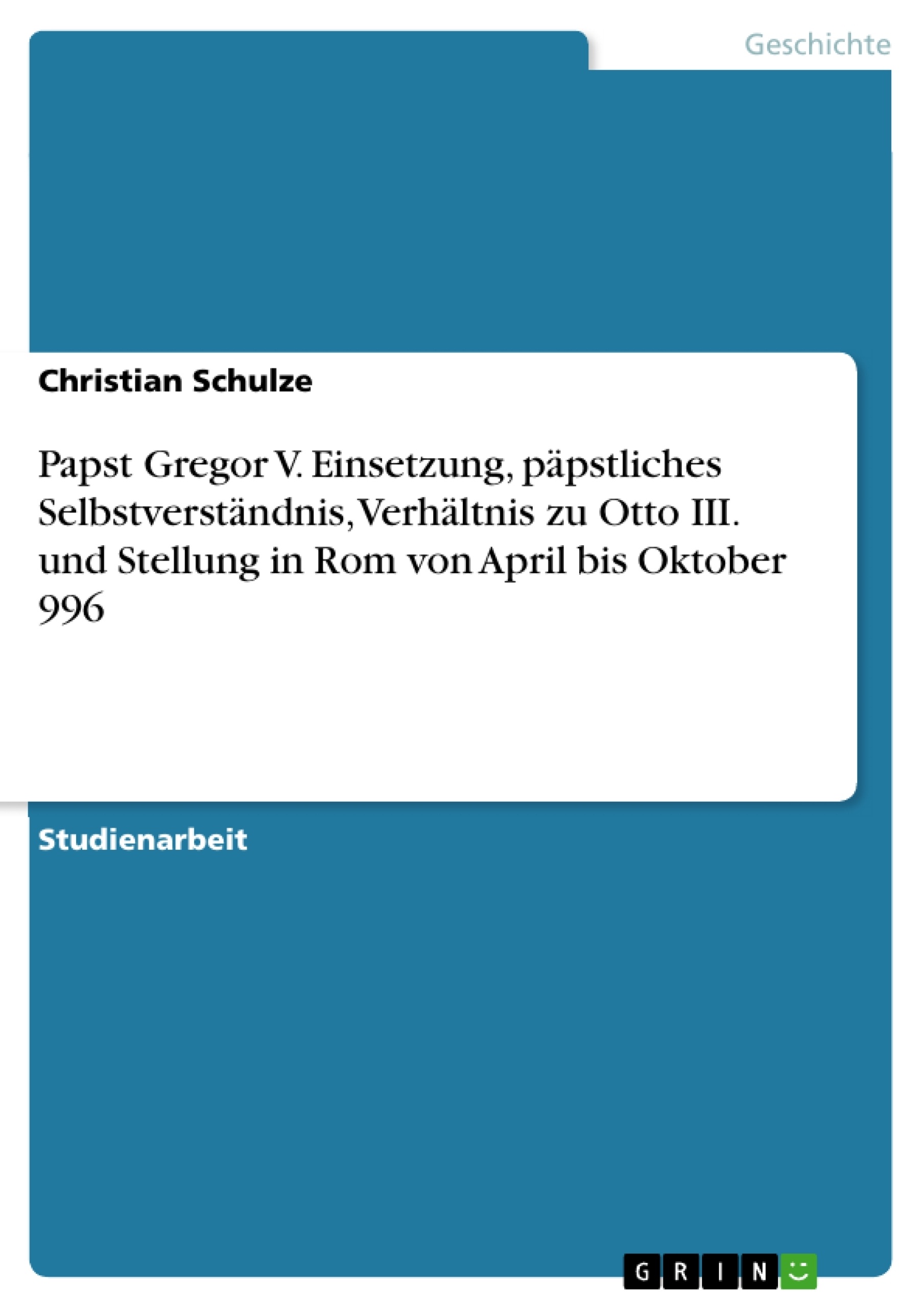Im Herbst des Jahres 995 sah sich Papst Johannes XV. zunehmend durch den Führer der römischen Adelsfamilie der Crescentier, Crescentius II. Nomentanus, in seinem Amt bedroht und wurde kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Durch seinen Hilferuf zog der deutsche König Otto III. von November 995 bis April 996 nach Norditalien, um ihm zurück ins Amt zu verhelfen. Noch in Ravenna erreichte Otto III. die Nachricht vom Tod des Papstes und wenige Tage später setzte der 16-jährige König seinen 24-jährigen Vetter Brun von Kärnten zum neuen Papst ein - es war der erste ‚deutsche’ Papst und der erste Papst, der ohne das Einverständnis des römischen Adels ernannt worden war. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Umstände dieser Papsteinsetzung näher zu beleuchten, Vorgeschichte und Folgen zu beschreiben und schließlich die Frage nach zentralen Motiven im Handlungsfeld der Beteiligten zu beantworten. Im ersten Teil der Arbeit sollen die stadtrömischen Verhältnisse bis ins Jahr 995 kurz umrissen werden, der Schwerpunkt liegt auf der Etablierung der Macht durch die Crescentier. Daran schließt sich eine Beschreibung der Umstände der Papsteinsetzung an. Welche Erwartungen hatte der deutsche König an den neuen Papst und inwiefern konnte dieser den Ansprüchen gerecht werden? Im dritten Teil stehen das Verhältnis zwischen Gregor V. und Otto III. nach der Kaiserkrönung und die Frage nach Gregors V. päpstlicher Selbstsicht im Mittelpunkt. Der vierte Teil beleuchtet dann das Beziehungsdreieck zwischen Papst, Kaiser und der römischen Oberschicht während des gemeinsamen Aufenthalts der beiden Herrscher in Rom. Welches waren ihre Handlungsmotive und Erwartungen, und inwiefern konnten diese erfüllt werden? Die Arbeit schließt mit Überlegungen zur Abreise Ottos III. wenige Wochen nach der Krönung und der Frage, wie und wodurch sich das Verhältnis zwischen Kaiser und Papst wandeln konnte. Als Quellengrundlage dienen die von Philipp Jaffé zusammengetragenenRegesta pontificum Romanorumund die Neuberarbeitung derPapstregesten 911—1024von Harald Zimmermann. Neben den Arbeiten von Percy E. Schramm und Mathilde Uhlirz hat Teta E. Moehs’ umfassende biographische Veröffentlichung zu Gregor V. als eine der wichtigsten Grundlagen für diese Arbeit gedient. Darüber hinaus seien noch die neuren Arbeiten von Gerd Althoff und Knut Görich erwähnt, die u.a. mit Ergebnissen zur Herrschaftsstruktur in ottonischer Zeit und zum Verhältnis zwischen Kaiser und Papst wichtige Ansätze geliefert haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Brun von Kärnten als Papst Gregor V.
- Stadtrömische Verhältnisse bis zur Papsteinsetzung
- Umstände und Motivation der Papsteinsetzung, Wahl des Kandidaten
- Verhältnis zwischen Kaiser und Papst, päpstliches Selbstverständnis
- Gregors V. Stellung in Rom, Rolle Ottos III
- Ottos III. Rückzug aus Rom: Motive und Folgen
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Papsteinsetzung von Gregor V. im Jahr 996 und beleuchtet die Umstände, die Vorgeschichte und die Folgen dieser Entscheidung. Sie widmet sich insbesondere der Frage nach den Motiven der beteiligten Akteure.
- Die Entwicklung der Machtverhältnisse in Rom bis zum Jahr 995, insbesondere die Rolle der Crescentier.
- Die Umstände der Papsteinsetzung von Gregor V. und die Erwartungen des deutschen Königs Otto III. an den neuen Papst.
- Das Verhältnis zwischen Gregor V. und Otto III. nach der Kaiserkrönung und die Frage nach Gregors V. päpstlicher Selbstsicht.
- Das Beziehungsdreieck zwischen Papst, Kaiser und der römischen Oberschicht während des gemeinsamen Aufenthalts in Rom.
- Die Abreise Ottos III. aus Rom und die Veränderung des Verhältnisses zwischen Kaiser und Papst.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Papsteinsetzung von Gregor V. im Herbst 995 ein und beschreibt die politischen und religiösen Spannungen in Rom, die zur Absetzung von Papst Johannes XV. führten. Otto III. reist nach Italien, um Johannes XV. zu unterstützen, und ernennt nach dessen Tod seinen Vetter Brun von Kärnten zum neuen Papst.
- Das Kapitel "Brun von Kärnten als Papst Gregor V." beginnt mit einer Analyse der politischen Verhältnisse in Rom bis 995. Der Fokus liegt dabei auf der Macht der Crescentier, die zunehmend Einfluss auf die Papstwahl erlangten. Anschließend werden die Umstände der Papsteinsetzung von Gregor V. untersucht, wobei die Erwartungen Ottos III. an den neuen Papst im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Papsteinsetzung, mittelalterliche Geschichte, Papst Gregor V., Otto III., Crescentier, römischer Adel, Verhältnis zwischen Kaiser und Papst, päpstliches Selbstverständnis, politische Machtkämpfe.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Papst Gregor V.?
Gregor V. (ursprünglich Brun von Kärnten) war der erste „deutsche“ Papst. Er wurde 996 im Alter von 24 Jahren von seinem Vetter, König Otto III., eingesetzt.
Warum war seine Einsetzung ungewöhnlich?
Es war das erste Mal, dass ein Papst ohne das Einverständnis des römischen Adels durch einen deutschen König ernannt wurde.
Wer waren die Crescentier?
Die Crescentier waren eine mächtige römische Adelsfamilie, die die Stadt Rom kontrollierte und den vorherigen Papst Johannes XV. vertrieben hatte.
Wie war das Verhältnis zwischen Gregor V. und Otto III.?
Ihr Verhältnis war eng, da sie Vettern waren. Otto III. erwartete vom Papst Unterstützung für seine Kaiserpläne, während Gregor V. den militärischen Schutz des Königs benötigte.
Was passierte nach der Abreise Ottos III. aus Rom?
Die Position von Gregor V. in Rom wurde ohne den Schutz des Kaisers extrem instabil, da der römische Adel unter den Crescentiern versuchte, die Macht zurückzugewinnen.
- Quote paper
- Christian Schulze (Author), 2005, Papst Gregor V. Einsetzung, päpstliches Selbstverständnis, Verhältnis zu Otto III. und Stellung in Rom von April bis Oktober 996, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58465