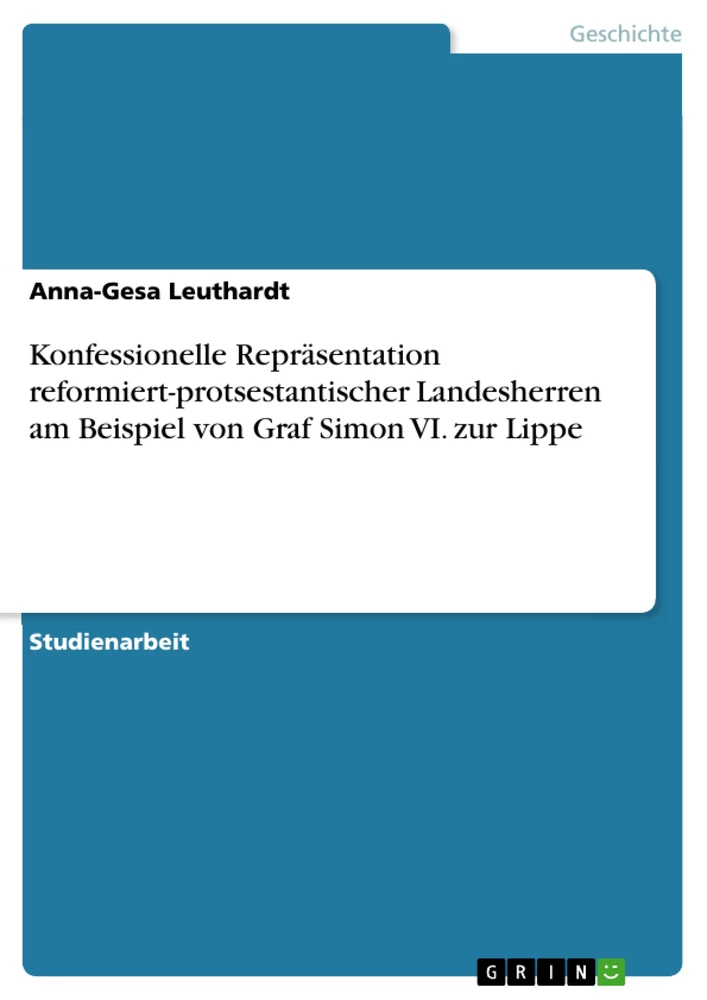Am zweiten Juni 1605 predigte der Detmolder Superintendent Dreckmeier vor seinem Landesherren Graf Simon VI. zur Lippe und dessen gesamtem Hofstaat. Beim anschließenden Abendmahl reichte Dreckmeier dem Grafen statt der Oblate ein Stück Brot. Diese Detmolder Abendmahlsfeier wird als die entscheidende Zäsur beim Übergang der Grafschaft Lippe vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis gesehen. Obgleich auch schon vorher Veränderungen der kirchlichen Praxis in der Grafschaft durchgeführt worden waren, war dieses öffentliche Bekenntnis des Grafen zur reformierten Richtung ein deutliches Signal für seine Entschlossenheit die Erneuerungen weiter voranzutreiben.
Über die Grafschaft Lippe, seit 1529 Reichsgrafschaft, existiert eine große Anzahl Arbeiten, die sich direkt mit dem Territorium beschäftigen. Besonders über die Einführung der Reformation in den 1530er Jahren und den Übergang zum reformierten Bekenntnis zu Beginn des 17. Jahrhunderts ist eine sehr breite Debatte geführt worden. Maßgeblich sind die Untersuchungen von Heinz Schilling, in denen er die reformierte Konfessionalisierung für Lippe als entscheidendes Element der Territorialstaatsbildung nachweist. Einen sehr umfangreichen Überblick über die Regierungszeit Simons VI. liefert August Falkmann mit seiner Zusammenfassung der wichtigsten archivalischen Quellen.
Obwohl Falkmann eine gewisse Tendenz zur lutherischen, bzw. Lemgoer Perspektive anzumerken ist, gibt er durch seine ausführliche Recherche viele Informationen über die Biographie Simons VI. Dieser ist bei der Betrachtung dieses Konfliktes, je nach Blickwinkel des Autors, als entschiedener Calvinist oder als kontrollierender Landesherr dargestellt worden, der die Entschlossenheit seiner Untertanen unterschätzte. Thema dieser Arbeit soll dagegen die konfessionelle Außendarstellung des lippischen Grafen sein. Interessant ist, inwieweit ein reformiert-protestantischer Adeliger im frühen 17. Jahrhundert seine Überzeugung öffentlich präsentieren konnte, da das reformierte Bekenntnis von den Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens relativ ausgeschlossen blieb. Um nicht unter das „Sektenverbot“ zu fallen, musste zumindest nach außen das Luthertum gewahrt bleiben. Schilling beurteilt deswegen die kirchlichen Veränderungen in der Grafschaft Lippe als zunächst „bewusst im Verborgenen gehalten“. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung Simons VI. bis zur Übernahme der Regierungsverantwortung
- Die kirchlichen Erneuerungen
- Erste Anzeichen
- Die Konsistorialordnung von 1600
- Ein neuer Katechismus und Visitationen
- ,,Lemgo contra Lippe“
- ,,Bekenntnis zum Bekenntnis“
- Probleme der konfessionellen Repräsentation bei reformiert-protestantischen Landesherren
- Zurschaustellung der religiösen Überzeugung innerhalb der Grafschaft
- Der veränderte Abendmahlsritus
- Beziehungen zum Kaiserhof
- Fazit
- Quellen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die konfessionelle Außendarstellung Graf Simons VI. zur Lippe im frühen 17. Jahrhundert. Das Hauptziel ist es, zu beleuchten, wie ein reformierter Landesherr seine Überzeugung in einer Zeit öffentlich präsentieren konnte, in der das reformierte Bekenntnis vom Augsburger Religionsfrieden relativ ausgeschlossen blieb.
- Konfessionelle Repräsentation reformierter Landesherren im frühen 17. Jahrhundert
- Die Einführung des reformierten Bekenntnisses in der Grafschaft Lippe
- Der Konflikt zwischen der Grafschaft Lippe und der Stadt Lemgo um die Konfession
- Die Rolle der Konsistorialordnung von 1600 bei der Durchsetzung der reformierten Lehre
- Die Bedeutung des Abendmahlsritus für die konfessionelle Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Übergang der Grafschaft Lippe vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis unter Graf Simon VI. und stellt die Forschungslage zum Thema dar. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung Simons VI. bis zu seiner Regierungsübernahme und zeigt, wie er bereits in jungen Jahren mit reformierten Ideen in Kontakt kam. Kapitel 3 behandelt die kirchlichen Erneuerungen in der Grafschaft Lippe, einschließlich der Einführung der Konsistorialordnung von 1600, der Einführung eines neuen Katechismus und der Visitationen. Es wird auch der Konflikt mit Lemgo um die Konfession erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Konfessionalisierung, reformierte Lehre, Repräsentation, Landesherren, Grafschaft Lippe, Abendmahlsritus, Konfessionskonflikt, Lemgo.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Graf Simon VI. zur Lippe?
Ein Reichsgraf, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts den Übergang der Grafschaft Lippe vom lutherischen zum reformierten (calvinistischen) Bekenntnis vollzog.
Was war das Signal für den Konfessionswechsel in Lippe?
Die Abendmahlsfeier am 2. Juni 1605 in Detmold, bei der statt der Oblate ein Stück Brot gereicht wurde, gilt als entscheidende Zäsur.
Welches Problem hatten reformierte Landesherren bei der Repräsentation?
Das reformierte Bekenntnis war nicht durch den Augsburger Religionsfrieden geschützt. Um das "Sektenverbot" zu umgehen, musste nach außen oft der Schein des Luthertums gewahrt bleiben.
Was war der Konflikt „Lemgo contra Lippe“?
Die Stadt Lemgo weigerte sich, dem Konfessionswechsel des Grafen zu folgen, und blieb lutherisch, was zu einem langanhaltenden politischen und religiösen Konflikt führte.
Welche Rolle spielte die Konsistorialordnung von 1600?
Sie war ein wichtiges Instrument des Grafen, um die kirchliche Verwaltung zu reformieren und die Durchsetzung der reformierten Lehre in der Grafschaft voranzutreiben.
- Citar trabajo
- Anna-Gesa Leuthardt (Autor), 2006, Konfessionelle Repräsentation reformiert-protsestantischer Landesherren am Beispiel von Graf Simon VI. zur Lippe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59101