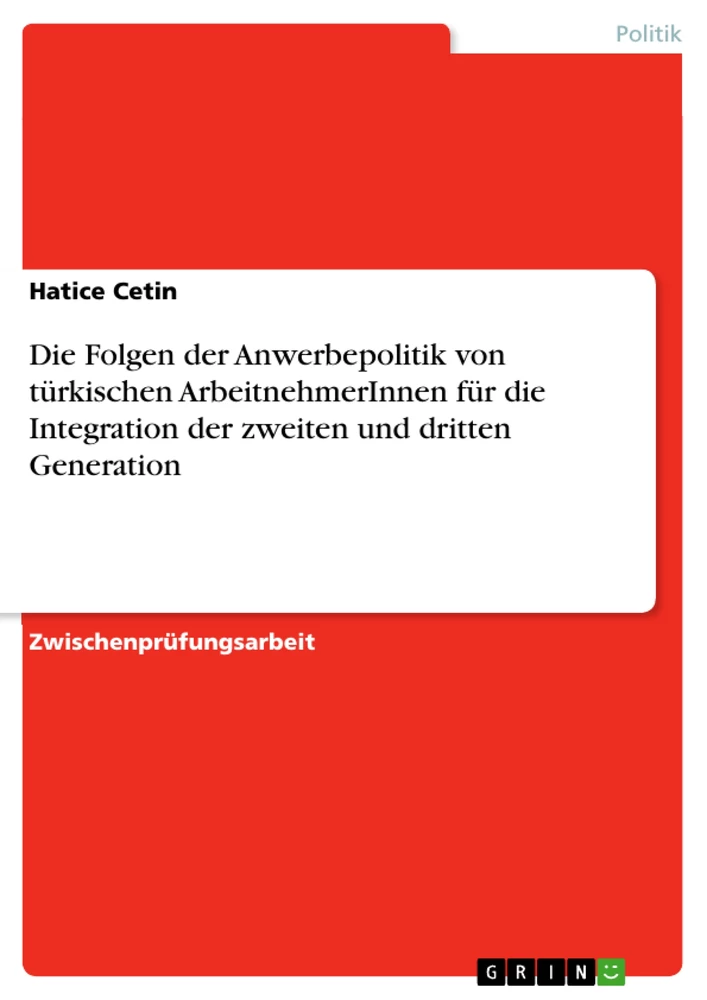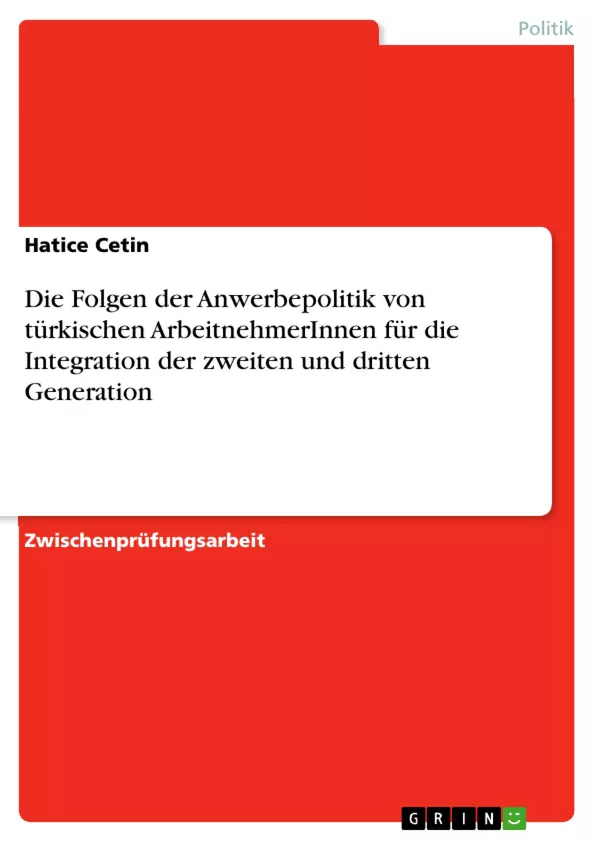In Deutschland leben derzeit knapp 1,9 Mio. Bürger mit türkischer Staatsangehörigkeit, wovon ungefähr 650 000 in Deutschland geboren sind. Ihre Migration nach Deutschland wurde mit dem deutsch-türkischen Anwerbevertrag aus dem Jahre 1961 begünstigt. Seitdem ist ihr Anteil an der ausländischen Bevölkerung konstant gestiegen, sodass sie heute, mit einem Anteil von ca. 2,5% an der Gesamtbevölkerung, die mit Abstand größte ausländische Gruppe in Deutschland darstellen. Ihr Aufenthalt in Deutschland erscheint jedoch nicht ganz unproblematisch. Diese Gruppe wird oft in der Öffentlichkeit als integrationsresistent dargestellt und ist im besonderen Maße von den spezifischen Ausländerproblemen betroffen. Kriminalität, Arbeitslosigkeit, schlechte Schul- bzw. Berufsausbildung, Selbstethnisierungstendenzen und starke Religiosität sind die Probleme, mit denen ihre Anwesenheit thematisiert wird und zeitweilig die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich lenkt. Da ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nicht unerheblich ist und dieser seit ihrer Migration in die BRD einen steigenden Trend aufweist, erscheint es notwendig, die Integration dieser Bevölkerungsgruppe, besonders der zweiten und dritten Generation, etwas näher zu betrachten. Im ersten Abschnitt dieser Arbeit soll zunächst der Integrationsbegriff erläutert werden. Dabei wurden die vier Integrationsformen Assimilation, Inklusion, Exklusion und Segregation nach Heitmeyer gewählt. Da die Entstehungsbedingungen zentraler Problembereiche wichtig für das Verständnis der gegenwärtigen Integrationsprobleme sind und ihre Grundlage darstellen, geht der zweite Abschnitt näher auf die erste Türkengeneration mit ihren spezifischen Problemlagen ein. Im dritten Abschnitt werden die zweite und dritte Generation der Ersten gegenübergestellt und sowohl Erfolge, als auch Stagnation bzw. kritische Entwicklungen bzgl. der Integration herauskristallisiert. Letztere sollen schließlich im vierten Abschnitt theoretisch fundiert und näher erläutert werden. Angesichts der zunehmenden Selbstethnisierungstendenzen legt die Arbeit ihren Schwerpunkt auf die Selbstorganisationen der türkischen Migranten und die türkischen Wohn- und Gewerbeviertel. Dies erscheint deshalb wichtig, weil diese als wichtige Ausdrucksformen der Integrationsdefizite der zweiten Generation genannt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsklärung: Was ist Integration?
- III. Die ersten türkischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland
- 1. Migration und Soziostruktur der ersten türkischen Migranten
- 2. Eingliederungsproblematik der ersten Generation
- 2.1. Soziales Verhalten
- 2.2. Türkische Selbstorganisationen
- 2.3. Zu ihrer Stellung auf dem Arbeitsmarkt
- 2.4. Wohnverhältnisse
- 2.5. Reaktionen der deutschen Politik und Öffentlichkeit
- IV. Die zweite und dritte Generation in Deutschland
- 1. Eine Gegenüberstellung mit der ersten Generation
- 2. Türkische Unternehmen, ein Fortschritt der Integration
- 3. Kritische Entwicklungen
- V. Selbstethnisierungstendenzen der türkischen Bevölkerung
- 1. Zur Bedeutung der Selbstorganisationen
- 1.1. Selbstorganisation vs. Integration?
- 1.2. Türkische Sportvereine als neue Form der Gettoisierung?
- 2. Türkische Wohn- und Gewerbeviertel
- 3. Vorgehen gegen die Problemakkumulation in ethnischen Wohnquartieren.
- 3.1. Vorgehen der Hauseigentümer bzw. Wohnungsgesellschaften
- 3.2. Vorgehen von Bund und Ländern
- 1. Zur Bedeutung der Selbstorganisationen
- VI. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Anwerbepolitik türkischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland und ihren Folgen für die Integration der zweiten und dritten Generation. Sie analysiert die Entstehung der Problematik anhand der soziostrukturellen Bedingungen der ersten türkischen Migrantengeneration und beleuchtet die Integrationsprozesse der folgenden Generationen.
- Die Eingliederungsproblematik der ersten türkischen Migranten und deren Einfluss auf die Integration der nachfolgenden Generationen.
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration der zweiten und dritten Generation türkischer Migranten in Deutschland.
- Die Rolle von Selbstorganisationen und ethnischen Wohnquartieren in der Integration türkischer Migranten.
- Die Bedeutung von Werten, Einstellungen und Handlungsorientierung für den Integrationsprozess.
- Die Relevanz von sozialer Teilhabe und die verschiedenen Faktoren, die sie beeinflussen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die Relevanz des Themas. Sie beleuchtet die demografische Entwicklung der türkischen Bevölkerung in Deutschland und zeigt die Herausforderungen und Chancen der Integration auf.
- Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Integrationsbegriff und beschreibt verschiedene Integrationsformen wie Assimilation, Inklusion, Exklusion und Segregation. Dabei wird deutlich, dass der Integrationsprozess von der Handlungsorientierung des Zuwanderers sowie von den Chancen zur sozialen Teilhabe in der Aufnahmegesellschaft abhängt.
- Das dritte Kapitel analysiert die Situation der ersten türkischen Migranten in Deutschland und ihre spezifischen Herausforderungen. Hierbei werden die soziostrukturellen Bedingungen der Migration, die Eingliederungsprobleme der ersten Generation und die Reaktionen der deutschen Politik und Öffentlichkeit beleuchtet.
- Das vierte Kapitel vergleicht die zweite und dritte Generation mit der ersten Generation und zeigt sowohl Erfolge als auch Stagnation bzw. kritische Entwicklungen bzgl. der Integration auf. Es wird deutlich, dass die Integration der nachfolgenden Generationen von den Erfahrungen der ersten Generation geprägt ist.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Phänomen der Selbstethnisierungstendenzen der türkischen Bevölkerung. Dabei werden die Rolle von Selbstorganisationen, die Entstehung von türkischen Wohn- und Gewerbevierteln und die Probleme in diesen Quartieren behandelt. Die Arbeit beleuchtet die Gründe für diese Entwicklungen und diskutiert mögliche Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Türkische Migranten, Integration, zweite Generation, dritte Generation, Selbstethnisierung, Selbstorganisationen, Wohn- und Gewerbeviertel, soziale Teilhabe, Handlungsorientierung, Assimilation, Inklusion, Exklusion, Segregation.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für die türkische Migration nach Deutschland?
Der deutsch-türkische Anwerbevertrag von 1961 begünstigte die Zuwanderung türkischer Arbeitskräfte, die ursprünglich nur temporär als „Gastarbeiter“ bleiben sollten.
Welche Integrationsformen unterscheidet Heitmeyer?
Die Arbeit nutzt die Kategorien Assimilation, Inklusion, Exklusion und Segregation, um die gesellschaftliche Teilhabe von Migranten zu analysieren.
Was versteht man unter „Selbstethnisierung“?
Selbstethnisierung beschreibt den Rückzug in die eigene ethnische Gemeinschaft und die verstärkte Betonung der Herkunftskultur, oft als Reaktion auf mangelnde Inklusion in der Aufnahmegesellschaft.
Wie unterscheidet sich die zweite und dritte Generation von der ersten?
Während die erste Generation oft in prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen lebte, zeigen die Nachfolgegenerationen sowohl größere Integrationserfolge (z.B. Unternehmertum) als auch neue Herausforderungen bei der Identitätsfindung.
Welche Rolle spielen türkische Wohn- und Gewerbeviertel?
Diese Viertel können einerseits soziale Sicherheit und wirtschaftliche Chancen bieten, bergen aber auch das Risiko einer räumlichen Segregation und Gettoisierung.
- Citar trabajo
- Hatice Cetin (Autor), 2004, Die Folgen der Anwerbepolitik von türkischen ArbeitnehmerInnen für die Integration der zweiten und dritten Generation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59285