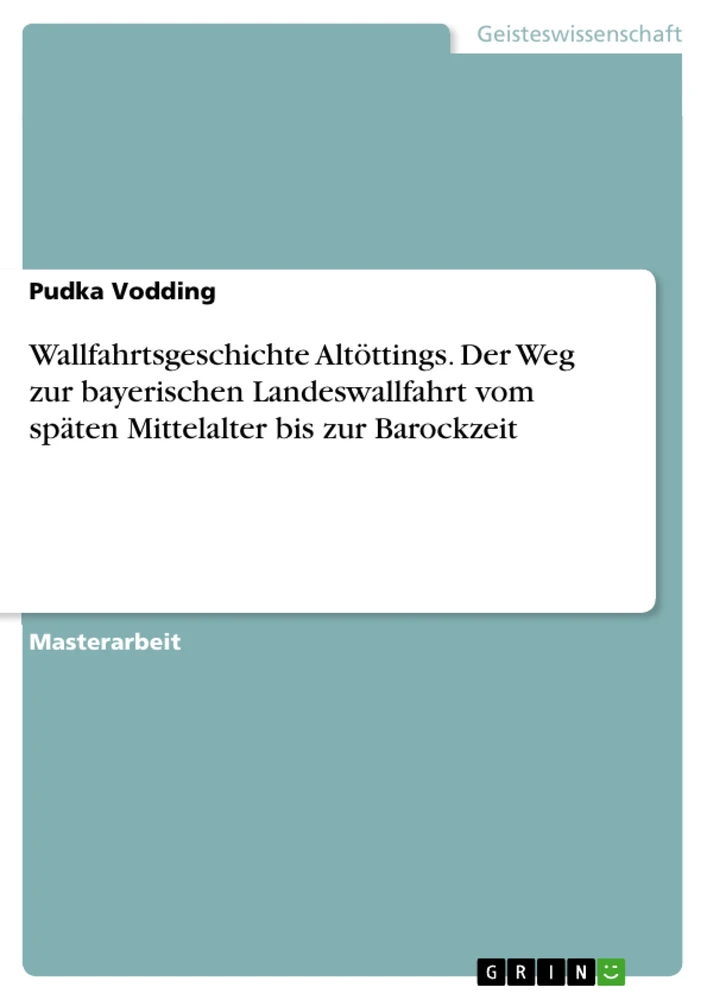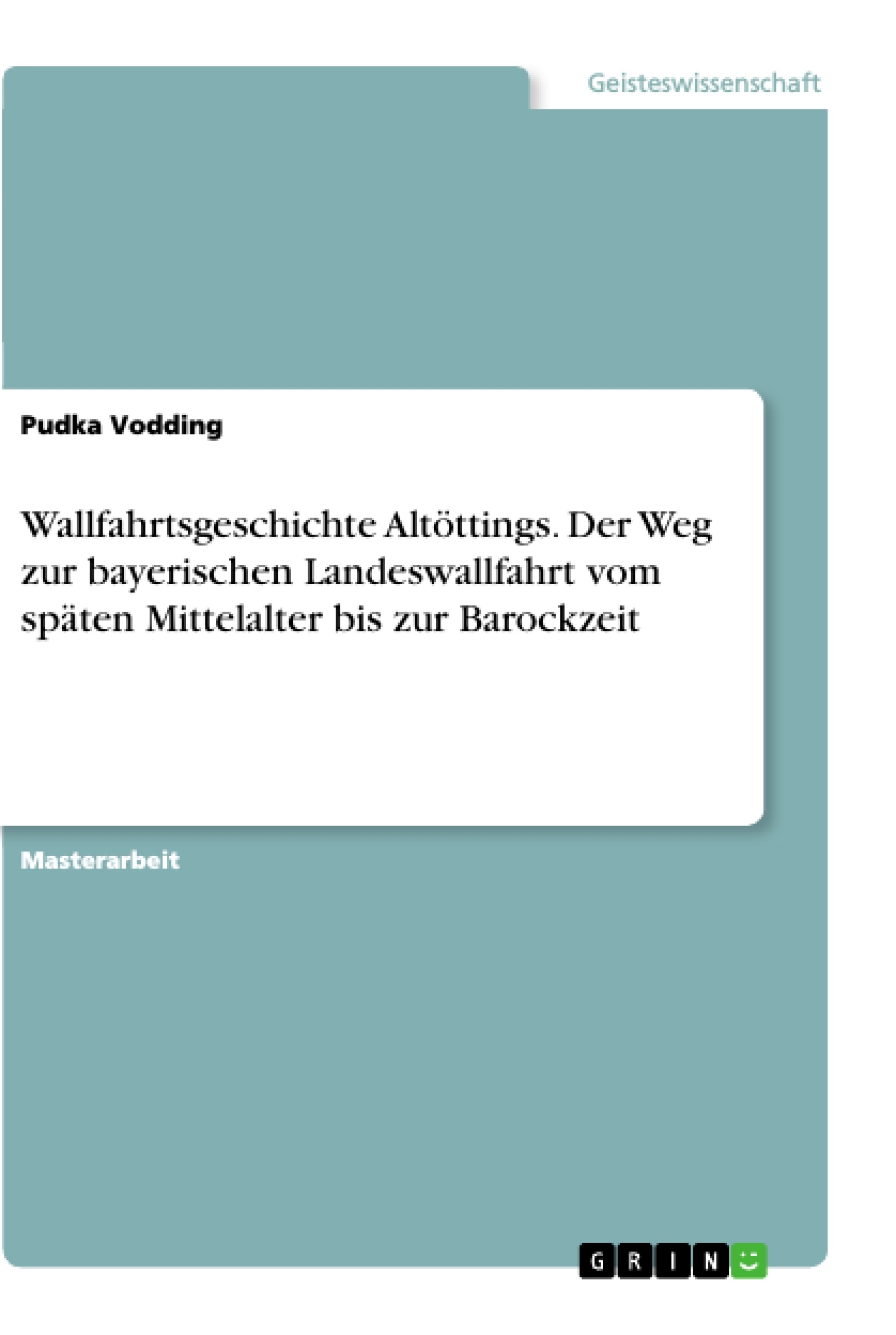Lange bevor die geschichtlich dokumentierte Wallfahrt nach Altötting mit zwei kurz aufeinander folgenden Mirakeln im Jahr 1489 begann, pilgerten schon Menschen zur Gottesmutter nach Altötting. Im Oktogon der "Uralt hayligen Capelln" ( Stadt Altötting, 2000, Seite 216), eines der ehrwürdigsten Gotteshäuser auf deutschem Boden, um circa 650 gebaut, befand sich ein Marienbild von einer sitzenden Madonna, das vermutlich sehr verehrt wurde, sonst wäre es kaum zum Wappen des Neuöttinger Richters geworden und später in das Neuöttinger Stadtwappen aufgenommen worden. Reliquien, die König Karlmann aus einem Römerzug für die von ihm erbaute Sitftskirche mitbrachte, die Vergrößerung der Stiftskirche 1245, sowie die prächtige Ausmalung des Kreuzgangs der Stiftskirche lassen darauf schließen, dass schon lange vor der geschichtlich dokumentierten Wallfahrt eine große Anzahl von Pilgern nach Altötting kam.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur geschichtlichen Entwicklung Altöttings
- Herrschaft der Agilolfinger
- Herrschaft der Karolinger
- Herrschaft der Wittelsbacher
- Geschichtlich dokumentierte Wallfahrtszeit
- Eigentlicher Beginn der Wallfahrt nach Altötting 1489
- Wallfahrtsfördernde Mirakel
- Die Marienstatue im Oktogon der Gnadenkapelle
- Popularisierung und Attraktivität
- Mirakelbücher und Mirakelbüchlein
- Votivtafeln
- Mirakeltafeln
- Pilgerzeichen
- Andachtsbilder
- Opfergaben
- Bauliche Entwicklung
- Soziologie der Pilger
- Die Wallfahrt nach Altötting im 16. Jahrhundert
- Niedergang durch den Landshuter Erbfolgekrieg
- Neues Aufblühen der Wallfahrt 1506
- Auswirkungen der Reformation 1520 - 1560
- Aufschwung durch Petrus Canisius
- Förderung der Wallfahrt durch Dr. Martin Eisengrein
- Aufschwung der Wallfahrt unter Herzog Albrecht V. (1550 - 1579)
- Entfaltung der Wallfahrt unter Herzog Wilhelm V. (1579 - 1597) und den Jesuiten in Altötting
- Die Wallfahrt nach Altötting in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert
- Kurfürst Maximilian I
- Die Wallfahrt nach Altötting während des Dreißigjährigen Krieges
- Die Wallfahrt nach Altötting während der Pest
- Entwicklung der Wallfahrt in der Barockzeit bis ca. 1750
- Förderer der Wallfahrt: Propst Wartenberg
- Altötting in kaiserlichem und fürstlichem Glanz
- Altöttinger Wallfahrt - eine Wallfahrt des Volkes
- Die Wallfahrt nach Altötting während des Spanischen Erbfolgekriegs
- Karl Albrecht und U. L. Frau von Altötting
- Armut des Volkes und der Hl. Kapelle
- Die Entstehung der Wallfahrt nach Altötting im Kontext historischer Ereignisse
- Die Rolle von Mirakeln und Heiligenbildern in der Entwicklung der Wallfahrt
- Die Bedeutung des Marienbildes in der Gnadenkapelle
- Die soziologische und gesellschaftliche Bedeutung der Wallfahrt
- Die Bedeutung der Wallfahrt im Kontext des Dreißigjährigen Krieges und der Pest
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text verfolgt das Ziel, die geschichtliche Entwicklung der bayerischen Landeswallfahrt nach Altötting von ihren Anfängen im späten Mittelalter bis zur Blütezeit des Barocks zu beleuchten. Dabei werden die einzelnen Phasen der Wallfahrt anhand historischer Ereignisse, Mirakel und Baulichkeiten dargestellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Anfänge der Wallfahrt nach Altötting ein und erklärt, warum die Region schon lange vor der geschichtlich dokumentierten Wallfahrt als Wallfahrtsort bekannt war. Anschließend wird die geschichtliche Entwicklung Altöttings im Kontext der Herrschaft verschiedener Herrschergeschlechter beleuchtet.
Der dritte Abschnitt des Textes konzentriert sich auf die geschichtlich dokumentierte Wallfahrt, beginnend mit dem Jahr 1489. Hier werden die wallfahrtsfördernden Mirakel, die Popularisierung der Wallfahrt, die Opfergaben, die bauliche Entwicklung und die Soziologie der Pilger näher erläutert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Wallfahrt im 16. Jahrhundert und untersucht die Auswirkungen von Ereignissen wie dem Landshuter Erbfolgekrieg und der Reformation auf die Wallfahrt. Es werden auch die Förderung der Wallfahrt durch bedeutende Persönlichkeiten wie Petrus Canisius und Dr. Martin Eisengrein beleuchtet.
Der fünfte Abschnitt beleuchtet die Entwicklung der Wallfahrt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, einschließlich der Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und der Pest.
Das sechste Kapitel behandelt die Entwicklung der Wallfahrt während der Barockzeit, wobei die Bedeutung von Förderern wie Propst Wartenberg, der kaiserliche und fürstliche Glanz des Wallfahrtsortes sowie die soziale Bedeutung der Wallfahrt für das Volk hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Bayerische Landeswallfahrt, Altötting, Gnadenkapelle, Marienbild, Mirakel, Wallfahrtsgeschichte, Barockzeit, Dreißigjähriger Krieg, Pest, Soziologie der Pilger, Opfergaben, Bauliche Entwicklung, Reformation, Petrus Canisius, Dr. Martin Eisengrein.
- Citation du texte
- Pudka Vodding (Auteur), 2016, Wallfahrtsgeschichte Altöttings. Der Weg zur bayerischen Landeswallfahrt vom späten Mittelalter bis zur Barockzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593627