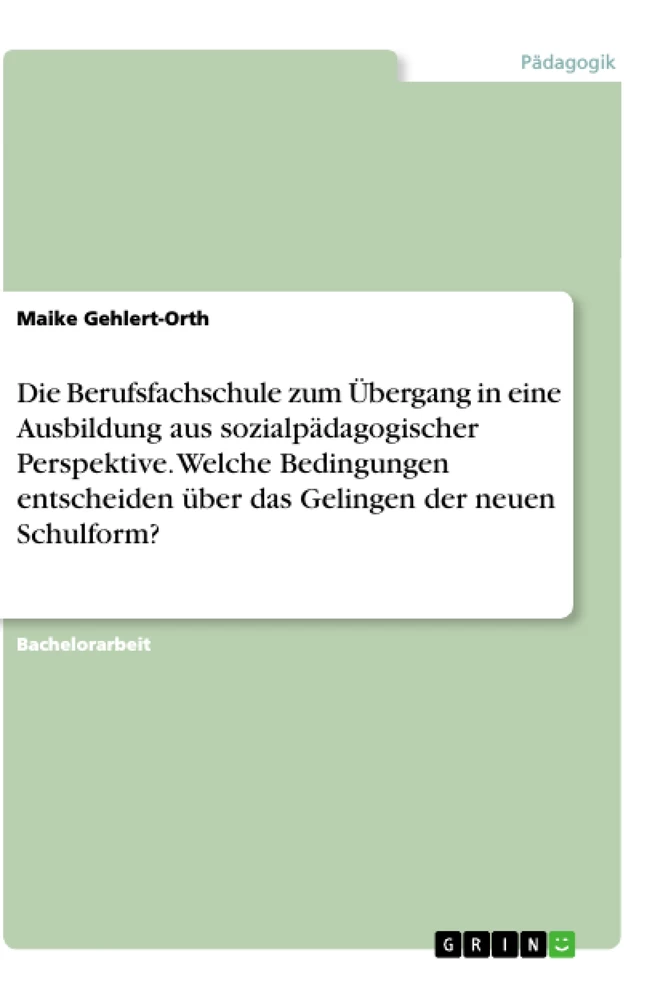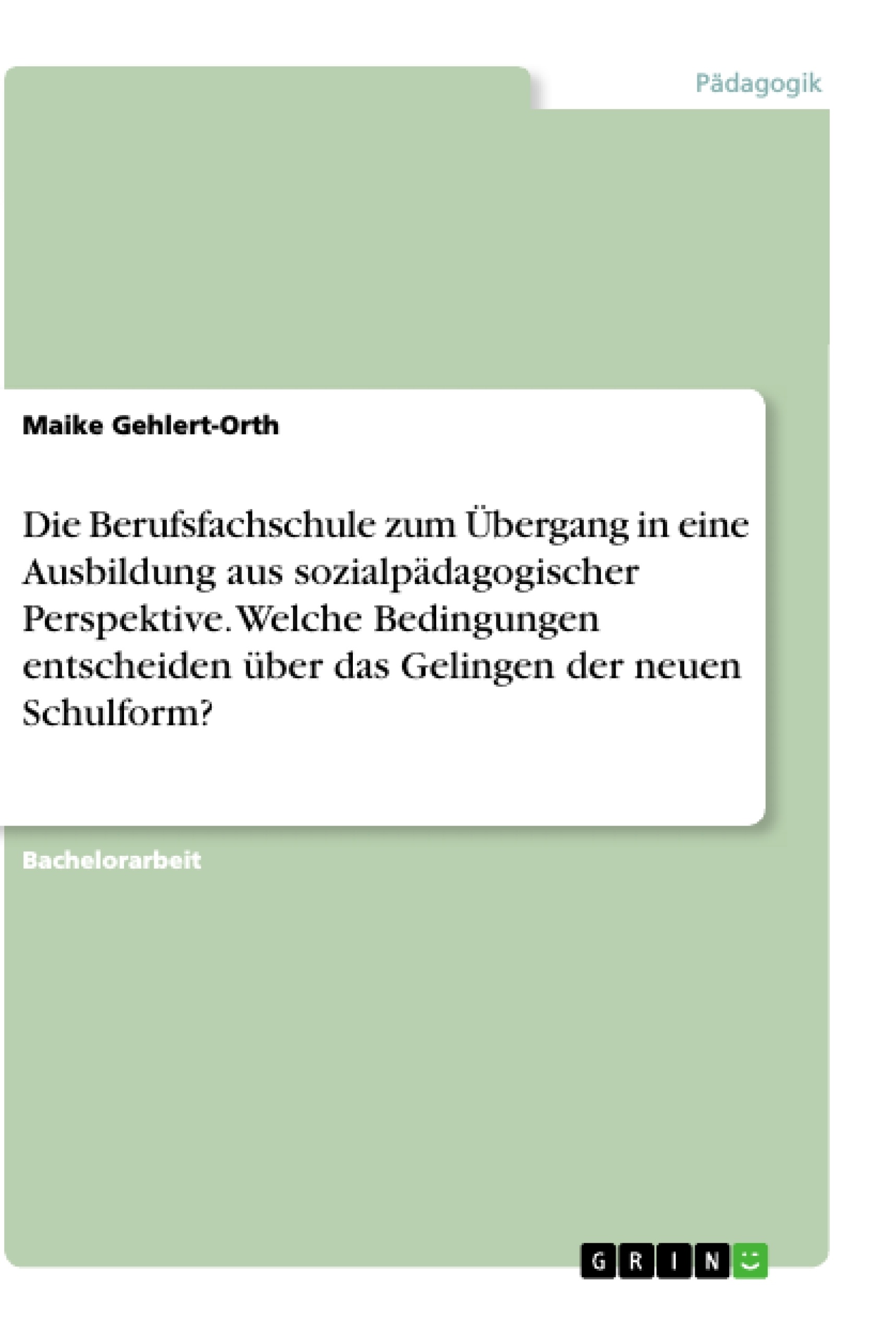Diese Bachelorarbeit klärt die Leitfrage: Welche Bedingungen müssen innerhalb des Schulsystems und der neuen Schulform geschaffen werden, beziehungsweise welche Bedingungen des Schulsystems müssen verändert werden, damit junge Menschen ohne oder mit Hauptschulabschluss in der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung ihre persönlichen, beruflichen Ziele entwickeln und erreichen können? In den Blick geraten dadurch die Lebensbedingungen der jungen Menschen zuhause und in der Schule, die die persönliche Entwicklung und Entfaltung und das formelle Lernen in der Schule möglich machen, behindern oder gänzlich verhindern.
Im nächsten Schritt soll die Lebenswelt der Adressatengruppe vertieft analysiert werden. Zur theoretischen Untermauerung werden in den darauffolgenden Abschnitten sowohl das Bewältigungskonzept nach Lothar Böhnisch, als auch der Empowerment-Ansatz nach Norbert Herriger vorgestellt und die für die Adressatengruppe relevanten Aspekte auf deren Ausgangslagen hin transferiert.
Ziel ist die Ableitung von Konzeptionsgrundlagen in Form von Handlungsempfehlungen an die sozialpädagogischen Fachkräfte in Kombination mit einer kleinen methodischen Anregung, die als Entwicklungsgrundstein gesehen werden kann.
Ab dem Schuljahr 2020/2021 kommt auf viele Berufsbildende Schulen in Hessen eine neue Schulform zu, an deren Erprobung bisher nur einzelne, wenige Schulen beteiligt waren. Das vorausgegangene Pilotprojekt wurde mit relativer Eile umgesetzt und dann aber mit erheblichem wissenschaftlichem Aufwand begleitet. Es drängt sich die Frage auf, ob es damit getan sein kann, Kompetenzen zu fördern, berufliche Orientierung zu bieten und bei den Bewerbungen zu helfen. Vor allem, wo es zumindest ähnliche Konzepte an den abgebenden Schulen doch auch gibt. Aber warum gelangten diese jungen Menschen nicht in Ausbildung? Und wollten sie dort überhaupt hin?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Dina eine (Bildungs-) Biografie
- Schule - Lernen und Sozialisation
- Wann was wie (und ob) gelernt wird
- Wie Schule (auch) wirkt
- Die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung
- Verortung im Bildungssystem
- Der Schulversuch
- Zielsetzung der Schulform
- Rahmenbedingungen
- Zielgruppe und Sozialstruktur
- Bedingungen Jugendlicher zur Schulzeit und der mittleren Jugend
- Schule heute
- Die Jugendphase - aus sozialwissenschaftlicher und weiteren Perspektiven
- Die Übergangssituation erster Schwelle - ihre Bedingungen, Risiken und Chancen
- Spezielle Bedingungen in der Versuchsschulform
- Lern- und Scheiter-Erfahrungen
- Stigmata und Diskriminierung
- Migrationserfahrungen
- Milieu
- Peergroups
- Theoretische Grundlagen
- Das Konzept der Lebensbewältigung
- Der Empowerment-Ansatz
- Auftrag und Handlungsrahmen der Schulsozialarbeit
- Allgemeine Aufträge von Schulsozialarbeit
- Aufgaben und Aufträge im Kontext der BÜA
- Bedingungen der Schulsozialarbeit im Jahr 2020
- Fazit
- Methodische Anregungen zur Konzeptionsentwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedingungen zu erforschen, die innerhalb des Schulsystems und der neuen Schulform BÜA geschaffen werden müssen, damit junge Menschen ohne oder mit Hauptschulabschluss ihre persönlichen und beruflichen Ziele erreichen können. Dabei liegt der Fokus auf den Lebensbedingungen der jungen Menschen zuhause und in der Schule, die ihre Entwicklung und das formelle Lernen beeinflussen.
- Die Analyse der Rahmenbedingungen der BÜA und der Lebenswelten der Zielgruppe
- Die Herausarbeitung von spezifischen Bedingungen, die zum Scheitern oder Gelingen von Bildungswegen führen können
- Die Untersuchung der Rolle der Schulsozialarbeit im Kontext der BÜA und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für sozialpädagogische Fachkräfte
- Die Bedeutung von Empowerment-Strategien zur Förderung der Selbstwirksamkeit und Zielerreichung der Jugendlichen
- Die Berücksichtigung von Migrationserfahrungen, Stigmatisierung und Diskriminierung als Einflussfaktoren auf den Bildungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Einführung der Bildungsbiografie von Dina, um die Problematik der BÜA anhand eines konkreten Beispiels zu veranschaulichen. Anschließend werden neurobiologische und psychologische Erkenntnisse zur Lernfähigkeit zusammengetragen und die Sozialisationsfunktionen der Schule im Allgemeinen beleuchtet. Der Schulversuch BÜA wird im Detail vorgestellt, wobei die Zielsetzung, Rahmenbedingungen und die Zielgruppe mit Hilfe wissenschaftlicher Erhebungen analysiert werden.
Im weiteren Verlauf werden die Lebenswelten der Adressatengruppe vertieft betrachtet, wobei insbesondere die Übergangssituation von der Schule in die Ausbildung, die Lern- und Scheiter-Erfahrungen der Jugendlichen sowie ihre Sozialstruktur und Hintergründe im Fokus stehen. Hierbei werden die Themen Stigmatisierung, Diskriminierung, Migrationserfahrungen, das Milieu und die Peergroups berücksichtigt.
Die Kapitel 6.1 und 6.2 setzen sich mit dem Konzept der Lebensbewältigung nach Böhnisch und dem Empowerment-Ansatz nach Herriger auseinander und übertragen die relevanten Aspekte auf die Ausgangslage der Adressatengruppe. Abschließend werden die aktuellen Arbeitsbedingungen der Schulsozialarbeit und die daraus resultierenden Handlungsaufträge im Kontext der BÜA diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Schulversuch BÜA (Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung) und den Gelingensbedingungen für Jugendliche ohne oder mit Hauptschulabschluss. Zentrale Themen sind Lebensbewältigung, Empowerment, Sozialisation, Schulsozialarbeit, Migrationserfahrungen, Stigmatisierung und Diskriminierung, sowie die Analyse von Lern- und Scheiter-Erfahrungen im Kontext der BÜA.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die BÜA und welches Ziel verfolgt sie?
Die BÜA (Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung) ist eine neue Schulform in Hessen, die Jugendlichen ohne oder mit Hauptschulabschluss helfen soll, berufliche Ziele zu entwickeln und den Übergang in eine Ausbildung zu schaffen.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Bachelorarbeit genutzt?
Die Arbeit stützt sich auf das Bewältigungskonzept nach Lothar Böhnisch und den Empowerment-Ansatz nach Norbert Herriger.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit im Kontext der BÜA?
Schulsozialarbeit soll die Jugendlichen unterstützen, Hindernisse in ihrer Lebenswelt abzubauen und durch Empowerment ihre Selbstwirksamkeit zu fördern.
Welche Faktoren erschweren den Bildungserfolg der Zielgruppe?
Einflussfaktoren sind unter anderem frühere Scheiter-Erfahrungen, Stigmatisierung, Diskriminierung, Migrationserfahrungen und das soziale Milieu.
Was ist das Ziel der Handlungsempfehlungen in der Arbeit?
Ziel ist die Ableitung von Konzeptionsgrundlagen, die sozialpädagogischen Fachkräften helfen, die Bedingungen für ein Gelingen der Schulform zu verbessern.
- Citation du texte
- Maike Gehlert-Orth (Auteur), 2020, Die Berufsfachschule zum Übergang in eine Ausbildung aus sozialpädagogischer Perspektive. Welche Bedingungen entscheiden über das Gelingen der neuen Schulform?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593649