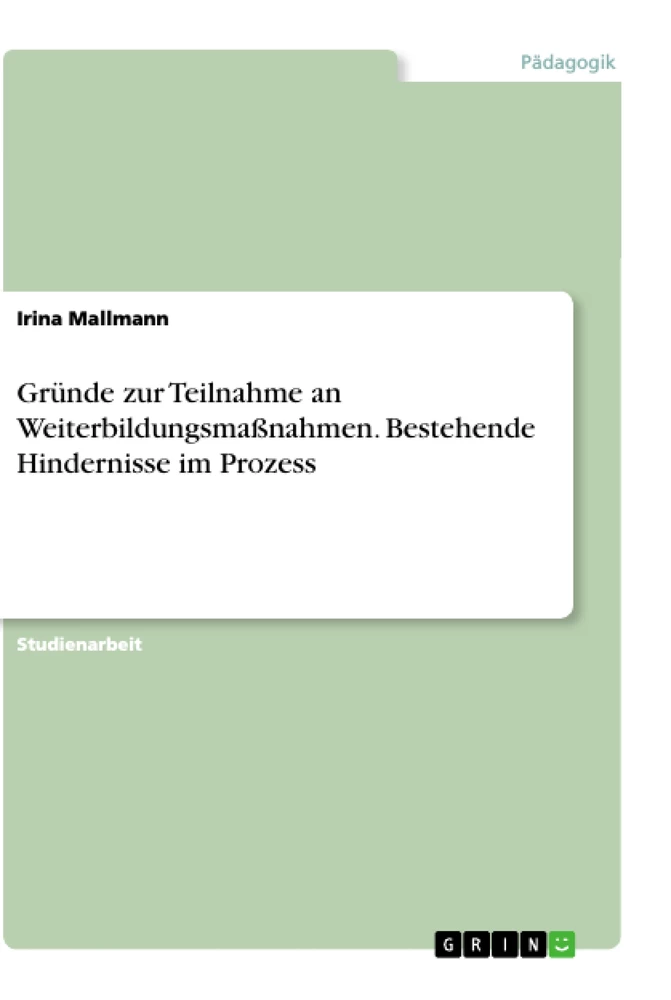Wissen profiliert sich in der modernen Gesellschaft als wichtigstes Kapitalgut. Damit hängt zusammen, dass der Bildungsbegriff an das proklamierte Bildungsziel des Lebenslangen Lernens geknüpft wird. Wissen ist in den Globalisierungs- und Technologiesierungsprozessen und der damit einhergehenden Zuspitzung des Wettkampfes zu einem entscheidenden Faktor geworden. Bildung, agiert als formalisierte Gestalt von Wissen und erhebt sich zu einer Instanz, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Angelegenheiten ein kompetentes Format zur Generierung von Lösungen bietet. Die progressiv verlaufenden Entwicklungen in Bezug auf die Globalisierung und Technologisierung, bewirken eine steigende Orientierung der Bildung an wirtschaftlichen Interessen, was sich auch im Weiterbildungssektor besonders verdeutlicht. Gemäß Feststellungen der Autorin Elke Gruber findet vor diesem bildungsbezogenen Hintergrund eine Pädagogisierung der wirtschaftlichen Prozesse und im Umkehrschluss auch eine Verwirtschaftlichung der Pädagogik statt. In diesem Zusammenhang zeichnet sich eine Verzweckung von Qualifikationsbedarfs ab. Zunehmend werden aus wirtschaftlicher und politischer Perspektive gut qualifizierte und flexibilisierte Kräfte nachgefragt und relevant. Im Sinne des gesteigerten Wettbewerbs werden die notwendigen Rivalitätskompetenzen an dieser Stelle vorausgesetzt.
Weiterbildung stellt dabei eine formalisierte und informelle Form dar, Lebenslanges Lernen institutionell zu verankern, was die Beteiligung und Nicht-Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen der näheren Betrachtung unterzieht und das Interesse an Forschung der Einflussfaktoren erweckt. Im Hinblick darauf, dass die Weiterbildungsteilnahme die formalisierte Form der von der Wissensgesellschaft propagierten Bedeutung des Lebenslangen Lernens mit einem quasi verbindlichen Charakter darstellt, ist die Erforschung der Gründe und Einflussfaktoren der Weiterbildungsabstinenz durchaus interessant.
In der folgenden Ausarbeitung wird zunächst die Struktur des Weiterbildungssektors untersucht, um anschließend über jene Einflussfaktoren, welche sich in individuelle und institutionelle Teilnahmebedingungen aufteilen, zu betrachten. In Form der Schlussbetrachtung wird sie schließlich in einer Reflektion münden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Struktur des Weiterbildungssektors
- Motivationale Aspekte auf individueller Ebene
- Motivation
- Soziostruktuelle und soziökonomische Aspekte
- Personenspezifische Merkmale
- Geschlecht
- Motivationale Aspekte auf institutioneller Ebene
- Individuelle Abwägung von Kosten und Nutzen
- Informations- und Beratungsintransparenz
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gründe für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen und analysiert die bestehenden Hindernisse im Prozess der Weiterbildungsentscheidung. Sie beleuchtet sowohl individuelle als auch institutionelle Aspekte, die die Motivation und die Teilnahmemöglichkeiten an Weiterbildungsmaßnahmen beeinflussen.
- Struktur und Organisation des Weiterbildungssektors
- Motivationale Aspekte der Weiterbildungsteilnahme auf individueller Ebene
- Institutionelle Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
- Die Bedeutung des Lebenslangen Lernens und der Weiterbildung in der heutigen Gesellschaft
- Wirtschaftliche und politische Interessen im Zusammenhang mit Weiterbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Weiterbildung und des Lebenslangen Lernens ein. Sie beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Bildung und Qualifikation in einer globalisierten und technologisierten Gesellschaft. Die Autorin verweist auf die Verzweckung von Qualifikationsbedarfs und die wachsende Nachfrage nach gut qualifizierten und flexiblen Arbeitskräften. Die Einleitung hebt die Relevanz der Weiterbildung als Instrument zur Steigerung der individuellen und institutionellen Wettbewerbsfähigkeit hervor.
2. Struktur des Weiterbildungssektors
Dieses Kapitel beleuchtet die heterogene Struktur des Weiterbildungssektors und seine verschiedenen Akteure, wie z. B. Kammern, Bildungsorganisationen, staatliche und private Anbieter. Es wird auf die fehlende einheitliche gesetzliche Regelung der Weiterbildung hingewiesen und die Rolle der Marktförderung sowie der staatlichen Arbeitsmarktpolitik beschrieben. Die Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des Weiterbildungssektors nach und zeigt, wie sich die Finanzierung und Organisation von der privatrechtlichen zur staatlich gelenkten Form entwickelt haben.
Schlüsselwörter
Weiterbildung, Lebenslanges Lernen, Motivation, Bildungssektor, Institutionelle Rahmenbedingungen, Wirtschaftliche Interessen, Qualifikationsbedarfs, Globalisierung, Technologisierung, Wissensgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Wissen heute als wichtigstes Kapitalgut bezeichnet?
In Zeiten von Globalisierung und Technologisierung ist Wissen der entscheidende Faktor für Wettbewerbsfähigkeit und Problemlösungen.
Was bedeutet "Verwirtschaftlichung der Pädagogik"?
Es beschreibt den Trend, dass sich Bildungsinhalte und Weiterbildungsziele zunehmend an wirtschaftlichen Interessen und Marktbedarfen orientieren.
Welche individuellen Faktoren beeinflussen die Teilnahme an Weiterbildung?
Dazu gehören die persönliche Motivation, sozioökonomische Aspekte sowie personenspezifische Merkmale wie das Geschlecht.
Was sind institutionelle Hindernisse für Weiterbildung?
Häufige Hürden sind die Intransparenz von Informationen und Beratungsangeboten sowie eine ungünstige Kosten-Nutzen-Abwägung.
Wie ist der Weiterbildungssektor in Deutschland strukturiert?
Der Sektor ist heterogen und umfasst staatliche Anbieter, private Unternehmen, Kammern und Bildungsorganisationen ohne einheitliche gesetzliche Regelung.
- Quote paper
- Irina Mallmann (Author), 2017, Gründe zur Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen. Bestehende Hindernisse im Prozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/595470