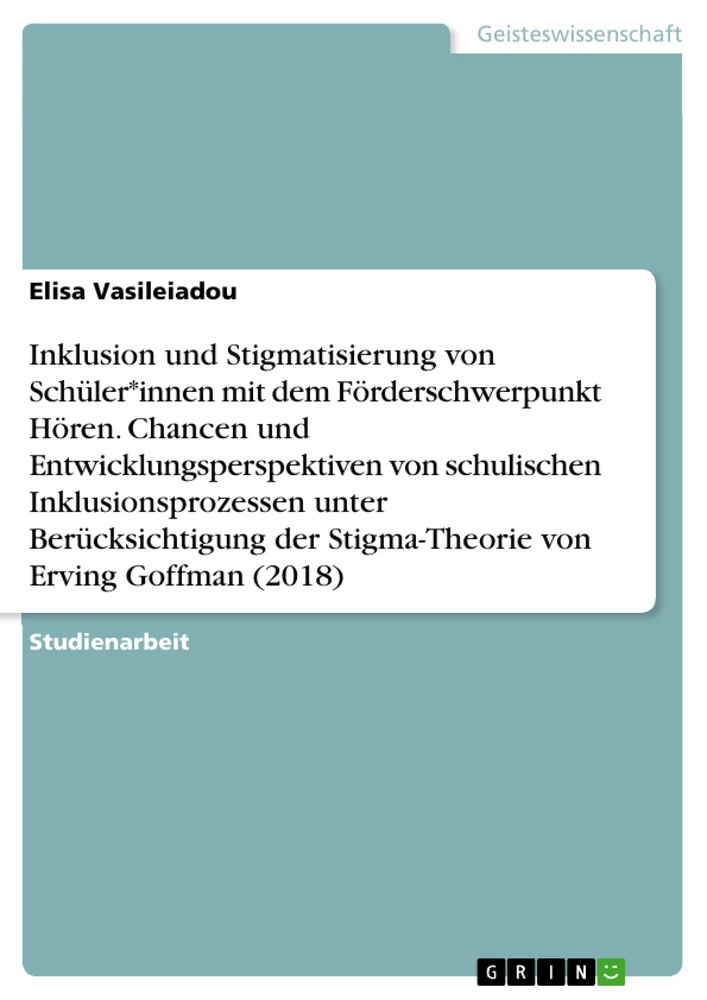Diese Arbeit beschränkt sich ausschließlich auf die Inklusion und Stigmatisierung von Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Hören. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Chancen und Entwicklungsperspektiven von schulischen Inklusionsprozessen unter Berücksichtigung der Stigma-Theorie von Goffman (2018). Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Klärung theoretischer Grundlagen. Der Begriff Menschen mit Behinderung wird angeführt und konkretisiert durch den Übergang zur Hörbeeinträchtigung. Anschließend wird auf die Einstellung, die gegenüber Menschen mit Behinderung herrscht, eingegangen.
Des Weiteren wird im zweiten Teil die Inklusion anfangs generell und im Nachhinein gezielt bezüglich des schulischen Bereichs betrachtet. In diesem Teil der Theorie werden die Charakteristika des inklusiven Unterrichts angeführt und die Frage, wie die schulische Inklusion aus der Sicht Hörbeeinträchtigter aussieht, beantwortet. Im nächsten Kapitel wird die Stigma-Theorie von Goffman (2018) betrachtet. Hierbei wird zunächst die soziale Identität beschrieben und anschließend auf die Stigmatisierung eingegangen. Um die Theorie anhand von Beispielen zu verdeutlichen, werden im fünften Kapitel Beispiele angebracht. Abschließend werden mit Hilfe dieser Beispiele die Chancen und Entwicklungsperspektiven der schulischen Inklusionsprozesse hergeleitet und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Behinderung und Hörbeeinträchtigung
- Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung
- Schulische Inklusion
- Von der Integration zur Inklusion
- Inklusiver Unterricht
- Schulische Inklusion hörbeeinträchtigter Schüler*innen
- Stigma-Theorie von Goffman
- Soziale Identität
- Stigma und Stigmatisierung
- Beispiele der schulischen Inklusionsprozesse und Stigmatisierung Schüler*innen mit dem FS Hören
- Switched at birth
- Inklusion gehörloser an deutschen Schulen
- Chancen und Entwicklungsperspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die schulische Inklusion hörbeeinträchtigter Schüler*innen im Kontext der Stigmatisierung. Dabei wird die Stigma-Theorie von Goffman herangezogen, um die Herausforderungen und Chancen der Inklusion zu beleuchten.
- Theoretische Fundierung des Begriffs Behinderung und Hörbeeinträchtigung
- Analyse von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung
- Diskussion der schulischen Inklusion und ihrer Herausforderungen
- Anwendung der Stigma-Theorie von Goffman auf schulische Inklusionsprozesse
- Bewertung der Chancen und Entwicklungsperspektiven der schulischen Inklusion hörbeeinträchtigter Schüler*innen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand der Inklusion und deren Relevanz für die Bildung beschreibt. Im zweiten Kapitel werden grundlegende Begriffe wie Behinderung und Hörbeeinträchtigung erläutert, sowie Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung analysiert. Das dritte Kapitel fokussiert auf die schulische Inklusion, wobei die Entwicklung von der Integration zur Inklusion und die Charakteristika des inklusiven Unterrichts beleuchtet werden. Im vierten Kapitel wird die Stigma-Theorie von Goffman betrachtet, die ein tieferes Verständnis der Stigmatisierung im Kontext der schulischen Inklusion ermöglicht. Anschließend werden in Kapitel fünf konkrete Beispiele für schulische Inklusionsprozesse und Stigmatisierung von Schüler*innen mit Hörbeeinträchtigung vorgestellt. Schließlich werden in Kapitel sechs die Chancen und Entwicklungsperspektiven der schulischen Inklusion diskutiert, wobei die Ergebnisse der vorhergehenden Analysen und Beispiele berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Schulische Inklusion, Hörbeeinträchtigung, Stigmatisierung, Stigma-Theorie von Goffman, soziale Identität, Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung, Chancen und Entwicklungsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Inklusion und Stigmatisierung bei Hörbeeinträchtigung zusammen?
Die Arbeit untersucht, wie inklusive Schulprozesse zwar Teilhabe ermöglichen, aber durch bestehende Vorurteile auch zur Stigmatisierung der betroffenen Schüler führen können.
Was besagt die Stigma-Theorie von Erving Goffman?
Goffman beschreibt Stigmatisierung als einen Prozess, bei dem ein Individuum aufgrund eines Merkmals (wie einer Behinderung) von der Gesellschaft als „minderwertig“ oder „anders“ kategorisiert wird.
Was kennzeichnet inklusiven Unterricht für Schüler mit Förderschwerpunkt Hören?
Dazu gehören technische Hilfsmittel, eine optimierte Raumakustik sowie pädagogische Methoden, die die spezifischen Kommunikationsbedürfnisse hörbeeinträchtigter Kinder berücksichtigen.
Welche Rolle spielt die soziale Identität in diesem Kontext?
Die soziale Identität wird durch die Interaktion mit anderen geprägt. Stigmatisierung kann das Selbstbild der Schüler negativ beeinflussen und ihre soziale Integration erschweren.
Welche Entwicklungsperspektiven bietet die schulische Inklusion?
Chancen liegen im Abbau von Barrieren und Vorurteilen durch gemeinsames Lernen, sofern die Rahmenbedingungen und die Sensibilisierung des Umfelds stimmen.
- Arbeit zitieren
- Elisa Vasileiadou (Autor:in), 2020, Inklusion und Stigmatisierung von Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Hören. Chancen und Entwicklungsperspektiven von schulischen Inklusionsprozessen unter Berücksichtigung der Stigma-Theorie von Erving Goffman (2018), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/595802