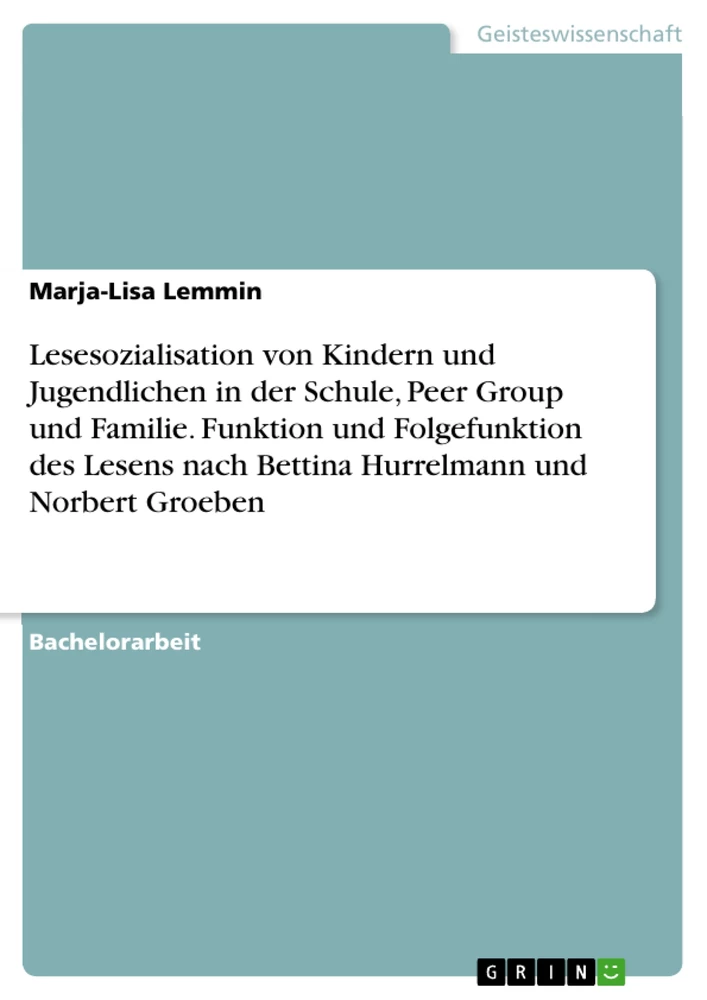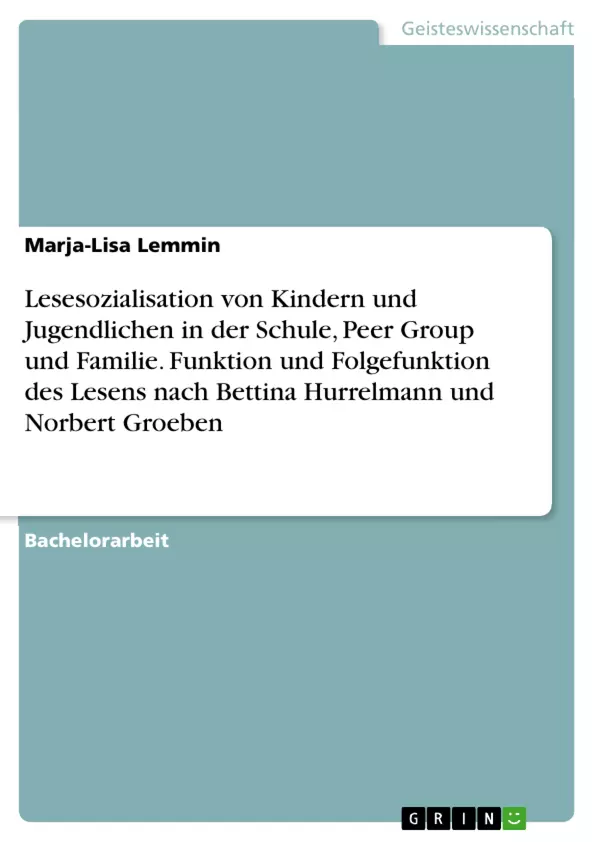Diese Arbeit soll die Bedeutung der Lesesozialisation für Kinder und Jugendliche herausarbeiten. Um in das Themenfeld einzuleiten, wird das Lesen definiert und seine Rolle im Alltag herausgearbeitet. Ein genauerer Blick wird auf die Unterscheidung von AlphabetInnen und AnalphabetInnen geworfen. Wie wird Lesen in der Schule gelernt und welche Stufen der Lesefähigkeit gibt es? Was wird unter AnalphabetInnen verstanden und was sind die Ursachen für Analphabetismus? Auf die Funktionen und Folgefunktionen wird anschließend eingegangen, wobei ein Schwerpunkt auf die Darstellungen von Bettina Hurrelmann und Norbert Groeben gelegt wird. Beide lehrten an der Universität zu Köln. Bettina Hurrelmanns Spezialgebiet waren die Kinder- und Literaturforschung, Lese- und Medienforschung sowie Literaturdidaktik. Norbert Groebens Schwerpunkt stellen die Medien-, Sprach- und Denkpsychologie dar, wobei sein Hauptgebiet die Lesepsychologie ist. Er hat zahlreiche Bücher gemeinsam mit Bettina Hurrelmann zu den Themen Lesesozialisation, Medien- bzw. Lesekompetenz herausgegeben.
Einen Blick zurück in die Geschichte der Lesesozialisation wird mit Fokus auf die Biedermeierzeit, die Kaiserzeit und die Zeit des Eintritts in die Mediengesellschaft geworfen. Mit diesem Basiswissen wird nun das Feld der Lesesozialisation mit einer Begriffserklärung, sowie der Vorstellung der primären, sekundären und tertiären Sozialisationsphase eröffnet. Die in den Sozialisationsphasen relevanten Sozialisationsphasen Schule, Peer Group und Familie werden vorgestellt, wobei der Fokus auf die Familie gelegt wird. Was sind die familialen Bedingungen der frühen Lesesozialisation, welche Rolle spielen dabei prä- und paraliterarische Kommunikationsformen und woraus bestehen diese? Das Vorlesen mit seinen diversen Funktionen wird anschließend vertieft behandelt. Die Vorlesestudie "Leseförderung durch Lesen" der PH Weingarten, welche die Bedeutung des Vorlesens der Lehrkraft für die Schülerinnen und Schüler erforscht, wird genauer beleuchtet und die Ergebnisse dieser präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Lesen
- Die Alphabetin
- Die Analphabetin
- Funktionen und Folgefunktionen des Lesens
- Lesesozialisation im historischen Wandel
- Die Lesesozialisation
- Die Sozialisationsphasen
- Sozialisationsinstanz Schule
- Sozialisationsinstanz Peer Group
- Sozialisationsinstanz Familie
- Familiale Bedingungen der frühen Lesesozialisation
- Das Vorlesen
- Leseförderung durch Vorlesen
- Lesekompetenz
- Lesekompetenz und PISA
- Lesekompetenz und Geschlecht
- Unterschiede zwischen Schularten - Pisa 2012
- Sozialer Hintergrund und Schülerleistungen
- Lesekompetenz und PISA
- (Reproduktion der) Schicht als Einflussfaktor
- Das Leseverhalten im Lebenslauf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung der Lesesozialisation für Kinder und Jugendliche. Sie untersucht die Entwicklung der Lesefähigkeit im Kontext verschiedener Sozialisationsinstanzen, insbesondere der Familie. Dabei werden wichtige Funktionen und Folgefunktionen des Lesens sowie die historische Entwicklung der Lesesozialisation beleuchtet.
- Definition und Relevanz des Lesens im Alltag
- Die Rolle der Familie in der Lesesozialisation
- Die Bedeutung der Leseförderung durch Vorlesen
- Der Einfluss von Schule und Peer Group auf die Lesesozialisation
- Der Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und sozialem Hintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Relevanz des Lesens als Schlüsselqualifikation in der heutigen Gesellschaft dar. Sie betont die Bedeutung der frühen Lesesozialisation, insbesondere den Einfluss der Familie, und gibt einen Überblick über die Inhalte der Arbeit.
- Das Lesen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Lesens und unterscheidet zwischen AlphabetInnen und AnalphabetInnen. Es beleuchtet die Rolle des Lesens im Alltag und die verschiedenen Stufen der Lesefähigkeit.
- Funktionen und Folgefunktionen des Lesens: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Funktionen des Lesens und seinen Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche. Dabei werden die Erkenntnisse von Bettina Hurrelmann und Norbert Groeben in Bezug auf die Lesesozialisation und Lesekompetenz aufgezeigt.
- Lesesozialisation im historischen Wandel: Dieses Kapitel zeichnet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Lesesozialisation in verschiedenen Epochen, von der Biedermeierzeit bis zur Mediengesellschaft.
- Die Lesesozialisation: Dieses Kapitel definiert die Lesesozialisation und beschreibt die verschiedenen Phasen der Sozialisation, wobei die primäre, sekundäre und tertiäre Sozialisationsphase vorgestellt werden. Es legt den Fokus auf die Rolle der Sozialisationsinstanzen Schule, Peer Group und Familie.
- Das Vorlesen: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Vorlesens als wichtige Komponente der Leseförderung.
- Lesekompetenz: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und PISA-Studien. Dabei werden die Einflüsse von Geschlecht, Schularten und sozialem Hintergrund auf die Lesekompetenz von Schülern beleuchtet.
Schlüsselwörter
Lesesozialisation, Familie, Schule, Peer Group, Leseförderung, Vorlesen, Lesekompetenz, PISA, Analphabetismus, Sozialer Hintergrund, Bildung, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Lesesozialisation?
Lesesozialisation beschreibt den Prozess des Erwerbs der Lesekompetenz und der Entwicklung einer Lesehaltung innerhalb von Familie, Schule und Peer Group.
Welche Rolle spielt die Familie beim Lesenlernen?
Die Familie ist die primäre Sozialisationsinstanz, in der durch Vorlesen und prä-literarische Kommunikation der Grundstein für die spätere Lesefreude gelegt wird.
Was sind die Folgefunktionen des Lesens nach Hurrelmann und Groeben?
Die Autoren untersuchen, wie Lesen über die reine Informationsaufnahme hinaus die Identitätsbildung und soziale Teilhabe beeinflusst.
Wie hängen sozialer Hintergrund und Lesekompetenz zusammen?
PISA-Studien zeigen, dass der soziale Status der Eltern oft einen erheblichen Einfluss auf die schulischen Leistungen und die Lesefähigkeit der Kinder hat.
Was ist der Unterschied zwischen Alphabetismus und Analphabetismus?
Die Arbeit definiert Stufen der Lesefähigkeit und untersucht die Ursachen, warum Menschen trotz Schulpflicht keine ausreichende Lesekompetenz erwerben.
- Quote paper
- Marja-Lisa Lemmin (Author), 2019, Lesesozialisation von Kindern und Jugendlichen in der Schule, Peer Group und Familie. Funktion und Folgefunktion des Lesens nach Bettina Hurrelmann und Norbert Groeben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/596000