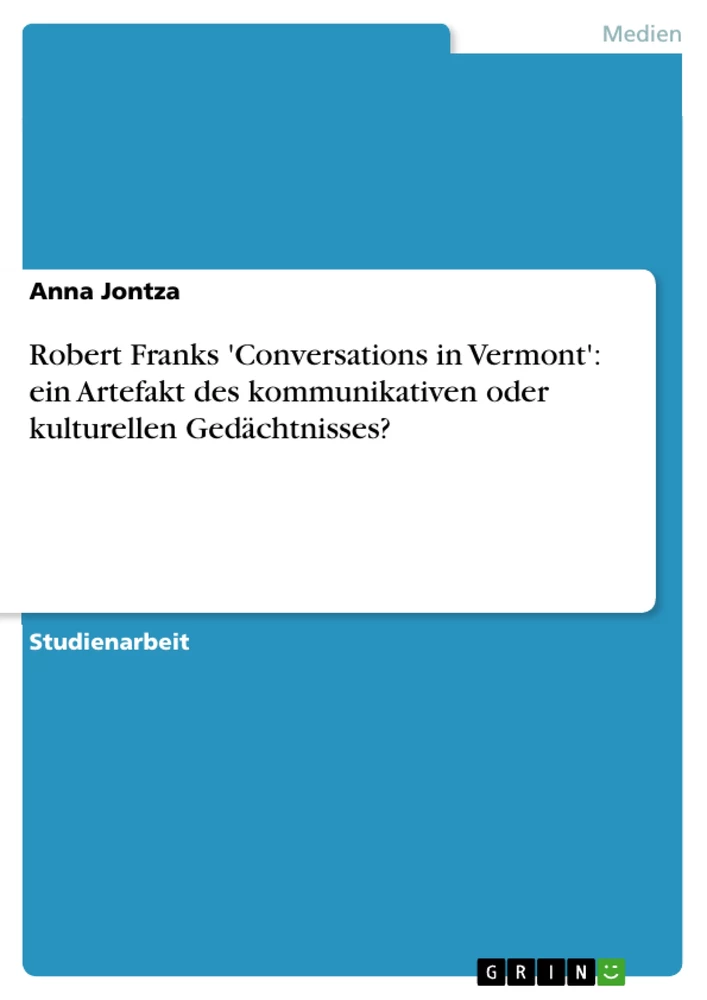Robert Frank ist ein Fotograf und Filmemacher, dessen Privatleben im Zentrum seines künstlerischen Schaffens steht. In dem FilmConversations in Vermontaus dem Jahr 1969 thematisiert Frank seinen Besuch bei seinen Kindern, die gleichzeitig als persönliche Reise in die gemeinsame Vergangenheit und die Gegenwart dargestellt wird. Im Kontext der privaten Geschehnisse des Jahres 1969 wirkt der Film wie ein Versuch zu rekapitulieren was in der Vergangenheit geschehen ist, und eine Erklärung für die große Distanz zu seinen Kindern zu finden. Er lässt sich gerade von seiner Frau Mary scheiden und seine beiden minderjährigen Kinder Pablo und Andrea leben in einer Kommune in Vermont, da sie mit dem Leben in New York nicht zurecht gekommen sind - im Besonderen der achtzehnjährige Pablo, der einschlägige Erfahrungen mit Drogen gemacht hat. Conversations in Vermonthinterlässt auf den ersten Blick den Eindruck, dass die Kommunikation über die Vergangenheit mit seinen Kindern scheitert und keine gemeinsame Familiengeschichte, sondern ein großes Schweigen zwischen dem Vater und seinen Kindern existiert. Dem Zuschauer drängt sich die Frage auf, ob Frank schlicht gegen das Vergessen fotografiert und filmt. Im Diskurs um das kulturelle Gedächtnis ist das Genre Dokumentarfilm als Zeitdokumentation einer Gesellschaft etabliert. Gleichzeitig stellt Angela Keppler die Frage nach der Funktion von Homemovie im Kontext eines familiären Gedächtnisses. Der oberflächliche Eindruck, es handele sich bei dem FilmConversations in Vermontnur um den Versuch Franks, die eigene Vergangenheit im Sinne der bildenden Kunst auf ein Medium zu bannen, um es als Geschichte abschließen und distanzieren zu können, legt die Klassifizierung des Films als Artefakt des familiären Gedächtnisses nahe. Der Film wird dem Zuschauer als „Familienalbum“ angekündigt und scheint auch vertraute Elemente familiärer Handlungen zu enthalten. In seiner spezifischen Ästhetik changiert er aber zwischen den Genres Homemovie und Dokumentation, also einem Privat- und einem Zeitdokument. Es wird zu untersuchen sein, inwieweit der Film Strukturen eines kulturellen Gedächtnisses aufweist und damit der oberflächliche Status als Artefakt eines familiären Gedächtnisses revidiert bzw. differenziert werden muss. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Conversations in Vermont - eine Beschreibung
- Das kommunikative Gedächtnis
- Schemata des kommunikativen Gedächtnisses in Conversations in Vermont
- Das Gedächtnis der Familie
- Familiäre Riten in Conversations in Vermont
- Das kulturelle Gedächtnis
- Conversations in Vermont als Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses
- Resümee
- Quellen
- Sequenzprotokoll zu Conversations in Vermont
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Robert Franks Film "Conversations in Vermont" aus dem Jahr 1969 und analysiert seine Funktion als Artefakt des kommunikativen oder kulturellen Gedächtnisses. Der Film thematisiert Franks Besuch bei seinen Kindern und stellt zugleich eine persönliche Reise in die gemeinsame Vergangenheit und Gegenwart dar. Die Arbeit beleuchtet die Dynamik der familiären Kommunikation im Film und untersucht, inwieweit er Strukturen eines kulturellen Gedächtnisses aufweist.
- Analyse der familiären Kommunikation in "Conversations in Vermont"
- Untersuchung der Funktion des Films im Kontext des kommunikativen und kulturellen Gedächtnisses
- Bedeutung von Franks filmischer Ästhetik und der Verwendung von Fotografien und Filmmaterial
- Interpretation des Films als autobiografisches Material und als Objekt eines kollektiven Gedächtnisses
- Einordnung des Films in den Kontext der Debatten über Gedächtnis und Film
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Robert Frank als Fotografen und Filmemacher vor, dessen Privatleben im Zentrum seines künstlerischen Schaffens steht. Der Film "Conversations in Vermont" wird als Versuch beschrieben, die Vergangenheit zu rekapitulieren und die Distanz zu seinen Kindern zu erklären. Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob der Film als Artefakt des familiären oder kulturellen Gedächtnisses zu betrachten ist.
- Das Kapitel "Conversations in Vermont - eine Beschreibung" analysiert die formalen Elemente des Films und beschreibt die zwei Bereiche: den dokumentarischen Teil, der Franks Gespräche mit seinen Kindern zeigt, und den archivischen Teil, der Fotografien und Filmmaterial integriert. Die Arbeit betont die Vielschichtigkeit und Offenheit des Films sowie seine kontrastierende Montage und die Verwendung von ikonischen und symbolischen Elementen.
- Das Kapitel "Das kommunikative Gedächtnis" behandelt die Schemata des kommunikativen Gedächtnisses in "Conversations in Vermont", wobei die Familie als zentrale Einheit betrachtet wird. Die Arbeit untersucht die familiäre Kommunikation, Identitätskonstruktion und Riten im Film und analysiert, inwieweit die Kommunikation über die Vergangenheit scheitert und ein Schweigen zwischen Vater und Kindern herrscht.
Schlüsselwörter
Robert Frank, "Conversations in Vermont", kommunikatives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis, Familiengeschichte, Homemovie, Dokumentarfilm, autobiografisches Material, ikonische und symbolische Elemente, Zeitdokumentation, Familie, Vergangenheit, Gegenwart, Erinnerung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Robert Franks Film „Conversations in Vermont“?
Der Film thematisiert einen Besuch von Robert Frank bei seinen Kindern Pablo und Andrea in einer Kommune und reflektiert die gemeinsame Familiengeschichte.
Was ist der Unterschied zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis?
Das kommunikative Gedächtnis umfasst persönliche Erinnerungen im sozialen Nahbereich (Familie), während das kulturelle Gedächtnis Zeitdokumente einer ganzen Gesellschaft bewahrt.
Warum wird der Film als „Homemovie“ bezeichnet?
Er nutzt private Aufnahmen und wirkt wie ein Familienalbum, das vertraute Riten und persönliche Gespräche dokumentiert.
Welche ästhetischen Mittel nutzt Robert Frank?
Frank verwendet eine kontrastierende Montage aus neuen Filmaufnahmen und alten Fotografien sowie ikonische Symbole, um Vergangenheit und Gegenwart zu verknüpfen.
Scheitert die Kommunikation im Film?
Der Film hinterlässt oft den Eindruck eines „großen Schweigens“ zwischen Vater und Kindern, was die Frage aufwirft, ob das Filmen lediglich ein Kampf gegen das Vergessen ist.
Was macht den Film zu einem Zeitdokument?
Durch die Darstellung des Lebens in Kommunen und den Umgang mit Drogen im Jahr 1969 wird die private Familiengeschichte zu einem Dokument gesellschaftlicher Umbrüche.
- Citar trabajo
- Anna Jontza (Autor), 2005, Robert Franks 'Conversations in Vermont': ein Artefakt des kommunikativen oder kulturellen Gedächtnisses?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59714