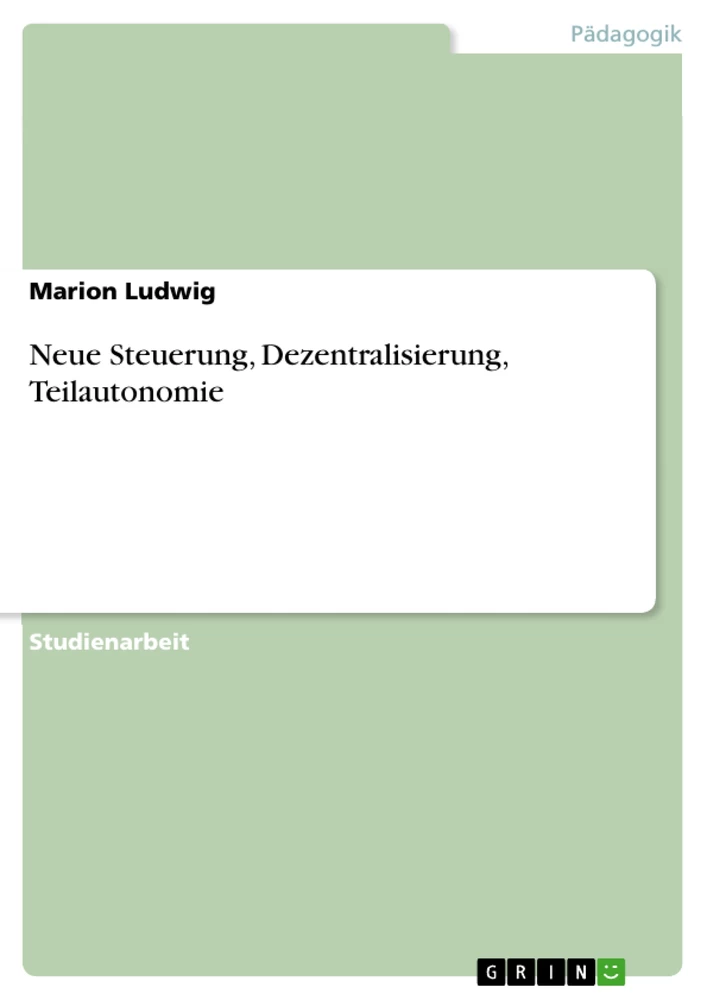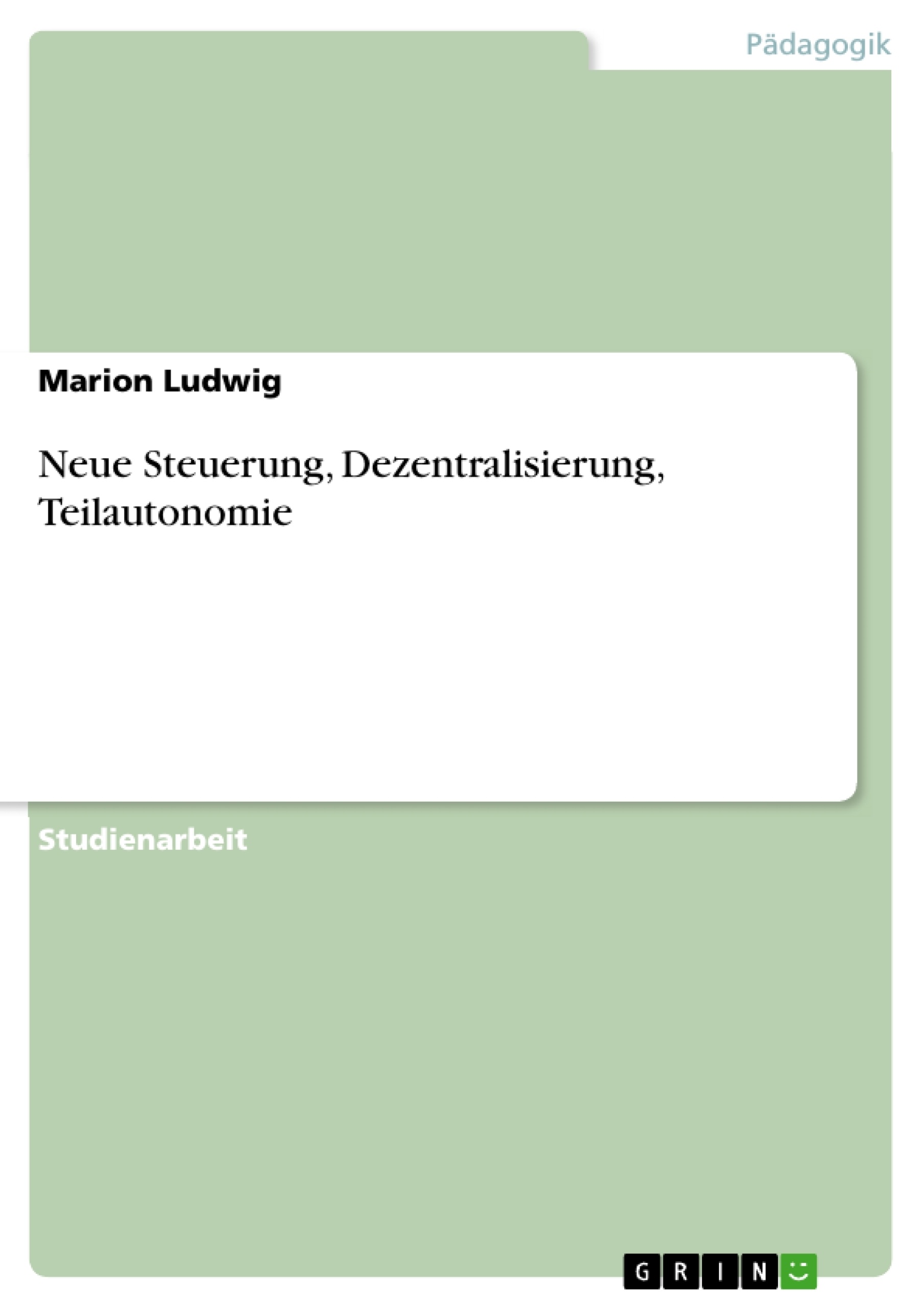Seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts taucht in der Diskussion über eine Neuorientierung im Bereich öffentlicher Verwaltungen immer wieder das Wort „Autonomie“ auf. Da die Schulen auch zu öffentlichen Verwaltungen gehören, kommt dem Begriff „Autonomie“ auch hier eine große Bedeutung zu.
Der Begriff der Schulautonomie bezieht sich im Wesentlichen auf die Delegation von Verantwortung für die Unterrichtsgestaltung, auf eine Mittelverteilung und auf die allgemeine Schulorganisation an den Einzelschulen unter Berücksichtigung der geltenden Gesetze sowie der geregelten Lehr- und Rahmenlehrpläne im staatlichen Schulwesen. (vgl. Stiepelmann 2003, S. 114)
Im Folgenden möchte ich auf die aktuellen Problemlagen des staatlichen Schulwesens sowie auf deren Ursachen eingehen. Im Anschluss daran werde ich kurz Verbesserungsvorschläge zusammentragen und das Reformmodell nach Hensel beschreiben. In meinen letzten beiden Teilen werde ich ein neues Steuerungsmodell und die dezentrale Ressourcenverwaltung von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachungen aus dem Jahre 1991 sowie die erhöhte Selbstverantwortung von Schulen vorstellen. Als abschließende Betrachtung möchte ich aus meiner Sicht erklären, ob den Schulen mehr Autonomie zugesprochen werden kann und worin weiterhin die Probleme liegen werden. Ich habe mich im Folgenden mit den Texten von Hensel 1999, Zedler 2000, Stotz 1996, Winter 1996, Stiepelmann 2003 und Bessoth 1997 auseinandergesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind die aktuellen Problemlagen des staatlichen Schulwesens?
- Worin liegen die Ursachen dafür und welches sind die Problemfelder?
- Welche Verbesserungsvorschläge können in Hinblick auf das Schulwesen vorgenommen werden?
- Vorstellung des Reformmodells nach Hensel
- Was bedeuten der neue Steuerungsansatz und die dezentrale Ressourcenverantwortung für die Schulen?
- Wie lässt sich eine erhöhte Selbstverantwortung in den Schulen verwirklichen?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den aktuellen Problemlagen des staatlichen Schulwesens und untersucht die Möglichkeiten zur Verbesserung durch ein neues Steuerungsmodell und dezentrale Ressourcenverwaltung. Sie analysiert die Defizite im Bildungssystem und die Gründe dafür, wobei die veränderte Kindheit und Jugend sowie die Überbürokratisierung und -reglementierung im Fokus stehen.
- Aktuelle Problemlagen des staatlichen Schulwesens
- Ursachen für die Problemlagen im Bildungssystem
- Das Reformmodell nach Hensel
- Der neue Steuerungsansatz und die dezentrale Ressourcenverantwortung
- Die Bedeutung von Selbstverantwortung in Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Schulautonomie ein und beleuchtet die aktuelle Debatte um die Neuorientierung öffentlicher Verwaltungen. Der Begriff der Schulautonomie wird definiert und die Struktur der Hausarbeit vorgestellt.
Was sind die aktuellen Problemlagen des staatlichen Schulwesens?
Dieses Kapitel stellt die aktuellen Problemlagen des staatlichen Schulwesens dar, die in öffentlichen Debatten immer wieder zum Ausdruck kommen. Es werden pädagogische Defizite, wie die veränderte Kindheit und Jugend, und „betriebliche“ Defizite, wie die fehlende selbstständige Zweckerfüllung der Schule, beschrieben. Die Kritik an der mangelnden Effektivität und Effizienz des Bildungssystems sowie an der Überreglementierung und Überbürokratisierung wird ebenfalls aufgezeigt.
Worin liegen die Ursachen dafür und welches sind die Problemfelder?
Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für die aktuellen Problemlagen des staatlichen Schulwesens. Die veränderte Kindheit und Jugend, die Mediatisierung, Kommerzialisierung und Entsinnlichung werden als zentrale Faktoren identifiziert. Es wird auch auf den Pluralismus der Werte- und Erziehungskonzepte und die Zunahme von Gewalt eingegangen. Weiterhin wird die mangelnde Praxisnähe der Schulaufsicht und Hochschulpädagogik kritisiert. Zedler beschreibt vier Problemfelder, die sich in Bezug auf die Entwicklung der Schulsysteme seit Anfang der 90er Jahre ergeben haben, darunter die zunehmende Bürokratisierung und die Entfernung von der Praxis.
Schlüsselwörter
Schulautonomie, staatliches Schulwesen, pädagogische Defizite, „betriebliche“ Defizite, Überbürokratisierung, Überreglementierung, veränderte Kindheit und Jugend, Mediatisierung, Kommerzialisierung, Entsinnlichung, Pluralismus der Werte- und Erziehungskonzepte, neue Steuerungsmodelle, dezentrale Ressourcenverantwortung, Selbstverantwortung.
Was bedeutet der Begriff „Schulautonomie“?
Schulautonomie bezeichnet die Delegation von Verantwortung für Unterrichtsgestaltung, Mittelverteilung und Organisation an die Einzelschule im Rahmen staatlicher Lehrpläne.
Welche Ursachen gibt es für die Probleme im staatlichen Schulwesen?
Als Hauptursachen werden Überbürokratisierung, mangelnde Praxisnähe, ein Pluralismus der Erziehungskonzepte sowie gesellschaftliche Veränderungen wie die Mediatisierung genannt.
Was ist das „Neue Steuerungsmodell“ (NSM)?
Das NSM ist ein Verwaltungsreformkonzept, das auf Dezentralisierung, Output-Steuerung und erhöhte Selbstverantwortung der einzelnen Institutionen setzt.
Wie sieht das Reformmodell nach Hensel aus?
Hensels Modell schlägt konkrete Schritte zur Neuorientierung vor, um pädagogische und betriebliche Defizite im staatlichen Schulwesen abzubauen.
Was bedeutet dezentrale Ressourcenverantwortung für Schulen?
Schulen erhalten mehr Freiheit bei der Verwaltung ihrer Sach- und Personalmittel, um flexibler auf lokale Bedürfnisse reagieren zu können.
Warum wird die „veränderte Kindheit“ als Problemfeld gesehen?
Die zunehmende Kommerzialisierung und Entsinnlichung der Lebenswelt von Kindern stellt die Schule vor neue pädagogische Herausforderungen, die durch starre Strukturen schwer zu bewältigen sind.