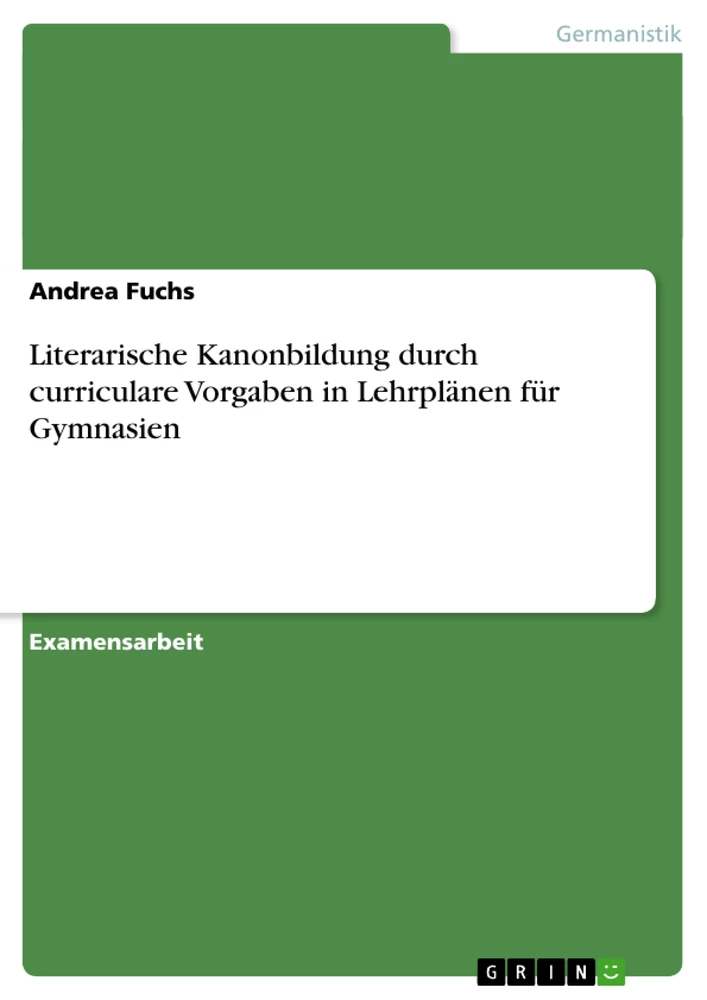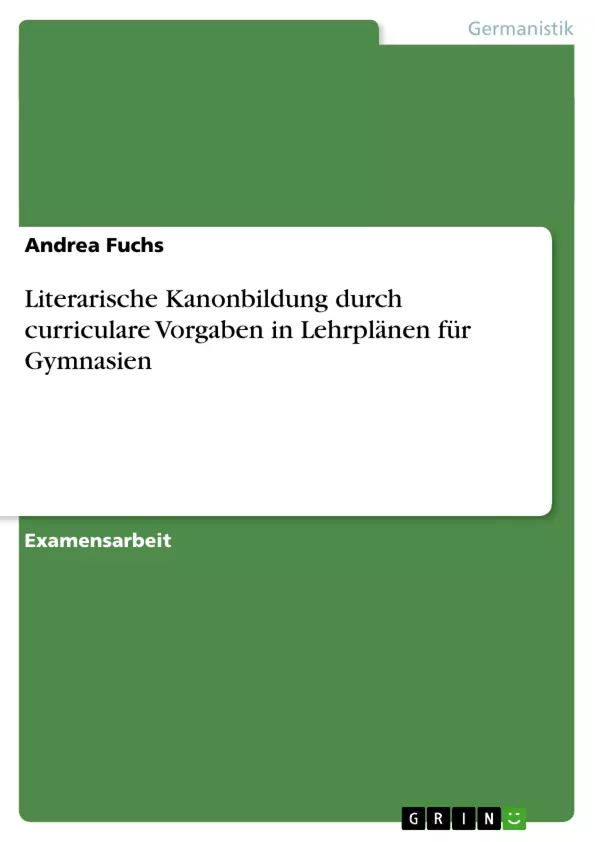Die literarische Tradition ist ein notwendiger Bestandteil dessen, was
literarische Kultur ausmacht. Nicht zuletzt im Literaturunterricht der Schule
entscheidet sich, welche Zukunft eine literarische Kultur hat. Literaturunterricht ist in der Lage, Traditionen und Werte anhand literarischer Werke zu überliefern. Literarische Traditionen und gesellschaftliche Werte spiegeln sich in literarischen Kanones wider.
Die vorliegende Wissenschaftliche Hausarbeit mit dem Thema „Literarische Kanonbildung durch curriculare Vorgaben in Lehrplänen für Gymnasien“ gliedert sich in zwei Kapitel. Ausgehend von der Definition des Kanonbegriffs zeige ich im ersten Kapitel Probleme der Kanonbildungen auf. Der Weg über die Geschichte des Kanons führt auch über den Weg der Geschichte des Kanons im
Literaturunterricht. Der Kanon im Literaturunterricht hat in den vergangenen
Jahren immer mehr an Bedeutung verloren. Erste Folgen der in Kanonlosigkeit
mündenden Entwicklungen werden sichtbar und führen zu unterschiedlichen
Reaktionen. Kanongegner und -befürworter führen seitdem eine Kanondebatte in
Fachdidaktik, Wissenschaft und Medien. Die Argumente der Kanongegner, und
der Kanonbefürworter bilden die Grundlage für die anschließende Darstellung
der gegenwärtigen Tendenzen in der Kanonbildung. Das zweite Kapitel befasst sich mit den curricularen Vorgaben in Lehrplänen für Gymnasien. Die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer geben die möglichen Inhalte des Deutsch- und Literaturunterrichts vor, indem sie unter anderem Literaturempfehlungen geben. Am Beispiel der deutschsprachigen Literatur ab dem 20. Jahrhundert untersuche ich, ausgehend von den Fragen der Verbindlichkeit und des Umfangs der Literaturempfehlungen, die Bedeutung der Lektüre von DDR-Literatur im Deutschunterricht. Schlussendlich ist das Ziel die Bildung eines Schulkanons, der Übereinstimmungen von Literaturempfehlungen voraussetzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Kanon und Kanonbildung
- 1.1 Definitionen und Probleme
- 1.2 Zur Geschichte des Kanons im Literaturunterricht
- 1.3 Die aktuelle Kanondiskussion
- 1.3.1 Argumente der Kanongegner
- 1.3.2 Argumente der Kanonbefürworter
- 1.4 Gegenwärtige Tendenzen in der Kanonbildung
- 1.4.1 Der Weg ist das Ziel – Ziele und Inhalte
- 1.4.1.1 Ich-Identität und Bildung als Voraussetzung von Persönlichkeitsbildung
- 1.4.2 Die zentrale Stellung des Deutschunterrichts bei der Persönlichkeitsbildung
- 1.4.3 Ausgewählte Kanonvorschläge
- 1.4.3.1 Konrad-Adenauer-Stiftung: Lektüreempfehlungen
- 1.4.3.2 Die Zeit-Schülerbibliothek
- 1.4.3.3 Marcel-Reich-Ranicki: Arche Noah der Bücher
- 1.5 Fazit
- 2. Literarische Kanonbildung durch curriculare Vorgaben in Lehrplänen für Gymnasien am Beispiel der deutschsprachigen Literatur ab dem 20. Jahrhundert
- 2.1 Methodischer Ansatz und Vorgehensweise
- 2.2 Die Bildungspläne in den Bundesländern – Ein vergleichender Überblick
- 2.2.1 Verbindlichkeit und Einordnung der empfohlenen Literatur
- 2.2.2 Umfang der Literaturlisten
- 2.2.3 Die Bedeutung von DDR-Literatur
- 2.2.4 Anzeichen der Einigkeit
- 2.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die literarische Kanonbildung im Kontext curriculare Vorgaben an Gymnasien. Das Hauptziel besteht darin, die Einflüsse von Lehrplänen auf die Auswahl literarischer Werke im Deutschunterricht zu analysieren und die damit verbundenen Herausforderungen und Entwicklungen zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit der Frage nach einem ausgewogenen und zeitgemäßen Kanon.
- Definition und Problematik des Kanonbegriffs
- Historische Entwicklung des Kanons im Literaturunterricht
- Die aktuelle Kanon-Debatte: Argumente von Befürwortern und Gegnern
- Analyse curriculare Vorgaben in verschiedenen Bundesländern
- Bedeutung der DDR-Literatur im Schulkanon
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kanon und Kanonbildung: Dieses Kapitel beginnt mit der Definition des Begriffs "Kanon" und beleuchtet die damit verbundenen Probleme. Es untersucht die historische Entwicklung des Kanons im Literaturunterricht, wobei der Verlust an Bedeutung in den vergangenen Jahren hervorgehoben wird. Die anschließende Diskussion der Argumente von Kanonbefürwortern und -gegnern bildet den Kontext für die Darstellung aktueller Tendenzen in der Kanonbildung. Es werden verschiedene Ansätze und Vorschläge zur Kanonbildung präsentiert und kritisch betrachtet, um ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Situation zu geben. Der Fokus liegt auf der Frage nach Zielen und Inhalten einer zeitgemäßen Kanonbildung im Literaturunterricht.
2. Literarische Kanonbildung durch curriculare Vorgaben in Lehrplänen für Gymnasien am Beispiel der deutschsprachigen Literatur ab dem 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die curricularen Vorgaben in den Lehrplänen der verschiedenen Bundesländer und untersucht deren Einfluss auf die Auswahl literarischer Werke im Deutschunterricht. Der Vergleich der Bildungspläne konzentriert sich auf die Verbindlichkeit und den Umfang der empfohlenen Literatur, wobei auch die Bedeutung der DDR-Literatur im Fokus steht. Die Analyse zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den curricularen Vorgaben zu identifizieren und deren Auswirkungen auf die Bildung eines Schulkanons zu bewerten.
Schlüsselwörter
Literarischer Kanon, Kanonbildung, Curriculare Vorgaben, Lehrpläne, Gymnasien, Deutschunterricht, Literaturdidaktik, DDR-Literatur, Kanondebatte, Persönlichkeitsbildung, Bildungspläne, Lektüreempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Literarische Kanonbildung im Deutschunterricht
Was ist der Gegenstand der wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die literarische Kanonbildung im Kontext curriculare Vorgaben an Gymnasien. Sie analysiert den Einfluss von Lehrplänen auf die Auswahl literarischer Werke im Deutschunterricht und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Entwicklungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage nach einem ausgewogenen und zeitgemäßen Kanon.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Problematik des Kanonbegriffs, historische Entwicklung des Kanons im Literaturunterricht, die aktuelle Kanon-Debatte (Argumente von Befürwortern und Gegnern), Analyse curriculare Vorgaben in verschiedenen Bundesländern, Bedeutung der DDR-Literatur im Schulkanon, sowie verschiedene Kanonvorschläge (z.B. Konrad-Adenauer-Stiftung, Die Zeit-Schülerbibliothek, Marcel Reich-Ranicki).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Hauptkapitel gegliedert: Kapitel 1 ("Kanon und Kanonbildung") befasst sich mit der Definition, der Geschichte und der aktuellen Diskussion um den literarischen Kanon. Es werden verschiedene Kanonvorschläge vorgestellt und kritisch diskutiert. Kapitel 2 ("Literarische Kanonbildung durch curriculare Vorgaben in Lehrplänen für Gymnasien am Beispiel der deutschsprachigen Literatur ab dem 20. Jahrhundert") analysiert die curricularen Vorgaben in den Lehrplänen verschiedener Bundesländer und deren Einfluss auf die Auswahl literarischer Werke im Deutschunterricht. Der Fokus liegt dabei auf dem Vergleich der Bildungspläne, der Verbindlichkeit und dem Umfang der empfohlenen Literatur, sowie der Bedeutung der DDR-Literatur.
Welche Methodik wird angewendet?
Kapitel 2 beschreibt den methodischen Ansatz und die Vorgehensweise der vergleichenden Analyse der Bildungspläne der Bundesländer. Es wird ein Überblick über die Bildungspläne gegeben, wobei Aspekte wie Verbindlichkeit, Umfang der Literaturlisten, Bedeutung der DDR-Literatur und Anzeichen der Einigkeit zwischen den Bundesländern untersucht werden.
Welche konkreten Beispiele für Kanonvorschläge werden genannt?
Die Arbeit nennt als Beispiele für Kanonvorschläge die Lektüreempfehlungen der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Zeit-Schülerbibliothek und Marcel Reich-Ranickis "Arche Noah der Bücher".
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Einflüsse von Lehrplänen auf die Auswahl literarischer Werke im Deutschunterricht zu analysieren und die damit verbundenen Herausforderungen und Entwicklungen zu beleuchten. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Fazit der einzelnen Kapitel und der Gesamtauswertung enthalten, aber zielen auf die Bewertung eines ausgewogenen und zeitgemäßen Kanons ab.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Literarischer Kanon, Kanonbildung, Curriculare Vorgaben, Lehrpläne, Gymnasien, Deutschunterricht, Literaturdidaktik, DDR-Literatur, Kanondebatte, Persönlichkeitsbildung, Bildungspläne, Lektüreempfehlungen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich wissenschaftlich mit der Thematik der literarischen Kanonbildung und deren Einfluss auf den Deutschunterricht befassen. Sie ist für Studierende der Germanistik, Literaturwissenschaft und Pädagogik relevant.
- Citar trabajo
- Andrea Fuchs (Autor), 2006, Literarische Kanonbildung durch curriculare Vorgaben in Lehrplänen für Gymnasien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60872