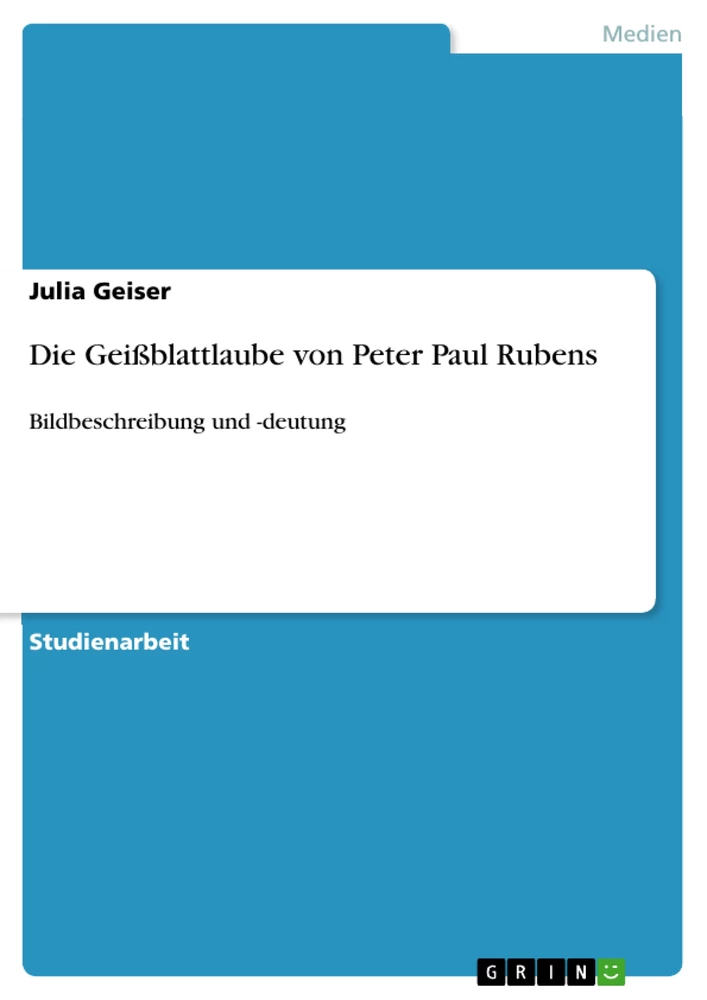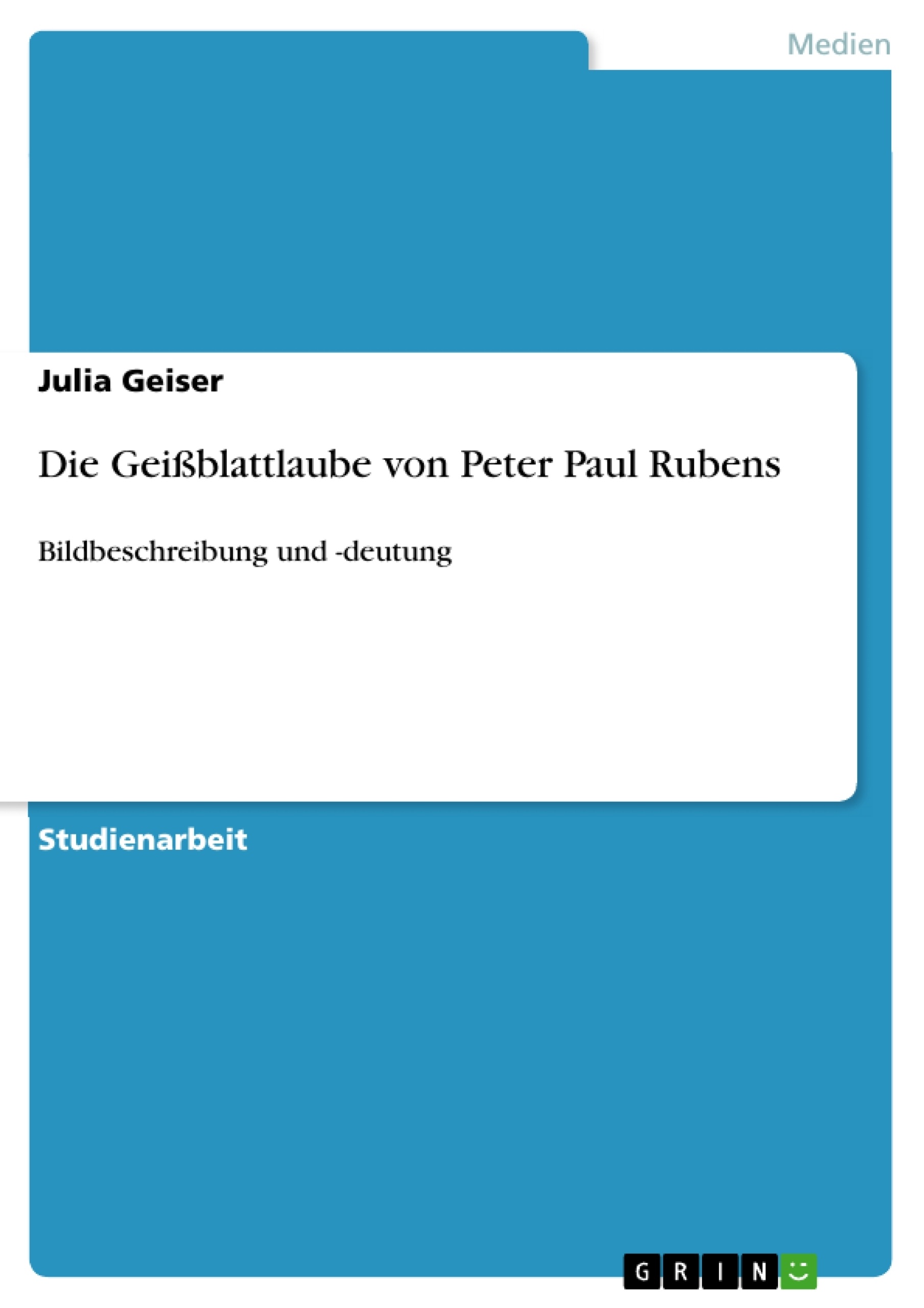Der flämische Künstler Peter Paul Rubens ( 1577- 1640 ) zählt zu den Hauptvertretern des europäischen Barock und wird des öfteren als einer der bedeutendsten Künstler der europäischen Malerei überhaupt bezeichnet. Anlässlich seiner Heirat mit der erst achtzehnjährigen Isabella Brant, „die älteste Tochter des angesehenen Antwerpener Patriziers und Stadtsekretärs Jan Brant und seiner Frau Klara de Moy“1, am 3. Oktober 1609 in Antwerpen, schuf „der damals schon hochberühmte, zweiunddreißigjährige Maler“2 Rubens ein ganzfiguriges Doppelportrait von sich selbst und seiner Gattin, welches den Namen Die Geißblattlaube trägt. Das auf Eichenholz gespannte Ölgemälde auf Leinwand befindet sich heute in der Alten Pinakothek in München. Aufgrund eines Vergleichs von Justus Müller Hofstede des Rubens`schen Gemäldes mit einem Nachstich vom Düsseldorfer Akademieprofessor und Reproduktionsstecher Carl Ernst Christoph Hess, welcher noch in der Kurpfälzerischen Galerie in Düsseldorf entstanden ist, vermutet man, dass das Werk von Peter Paul Rubens vor seiner Überführung in die Münchner Gemäldegalerie im Jahre 1806 insbesondere am oberen Bildrand um wenige Zentimeter beschnitten wurde, woraus die heutigen Maße von 178 x 136,5 cm resultieren. Dieses dennoch sehr große Format ermöglicht eine nahezu lebensgroße Darstellung des Paares. Auch die Festlegung der Datierung ist umstritten. Entgegen der allgemein geläufigen Annahme, dass Gemälde sei um 1609, also unmittelbar im Zusammenhang mit der Hochzeit, entstanden, vertritt Reinhard Liess, durch das Durchführen stilistischer Bildvergleiche, die Meinung, dass die Datierung der Geißblattlaube besser im Jahre 1612 einzuordnen ist.3 Mit dem Hinweis auf das lateinische Gedicht des Leidener Humanisten Dominicus Baudius vom 11.April 1612, welches als erste überlieferte Quelle, in der das Gemälde erwähnt wird, gilt, unterstützt Wolfgang Schöne den Datierungsvorschlag von Liess.4
Aber nicht nur über die formalen Punkte schieden sich die Geister, selbst in der Frage über die Einordnung des Gemäldes in die Bildnistradition kam es immer wieder zu gespalteten Meinungen. In diesem Werk sollen nun die Besonderheiten der Geißblattlaube von Peter Paul Rubens im Hinblick auf die Übernahme alter Bildnistraditionen und Innovationen des Künstlers näher erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildbeschreibung
- Analyse der bildnerischen Mittel
- Deutung der ikonographischen Symbole
- Stellung des Gemäldes in der Bildnistradition
- (Übernahme alter Bildnistraditionen und Rubens`sche Innovationen)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse des Gemäldes „Die Geißblattlaube“ von Peter Paul Rubens widmet sich der Erforschung des Werkes im Kontext der europäischen Barockkunst. Ziel ist es, die spezifischen Eigenheiten des Gemäldes aufzuzeigen, die Übernahme alter Bildnistraditionen zu beleuchten und die Innovationen Rubens' zu untersuchen.
- Die Darstellung des Ehepaares Rubens und Isabella Brant
- Die Analyse der ikonographischen Symbole im Gemälde
- Die Einordnung des Werkes in die Bildnistradition
- Die stilistischen Besonderheiten des Barock
- Die Bedeutung des Gemäldes in der Kunstgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über Peter Paul Rubens als einen der wichtigsten Vertreter des europäischen Barock und stellt das Gemälde „Die Geißblattlaube“ als Doppelportrait von Rubens und seiner Frau Isabella Brant vor. Es werden auch die Entstehung des Gemäldes, sein heutiger Standort und die umstrittene Datierung erörtert.
- Bildbeschreibung: Dieses Kapitel beschreibt das Gemälde im Detail. Es werden die Komposition, die dargestellten Personen und ihre Kleidung, sowie wichtige Elemente wie die Geißblattlaube und das Händepaar in der Bildmitte analysiert.
- Analyse der bildnerischen Mittel: Dieser Abschnitt untersucht die Komposition, die Perspektive, die Lichtführung und die Farbgebung des Gemäldes.
- Deutung der ikonographischen Symbole: Hier werden die Symbole im Gemälde interpretiert, z.B. die Geißblattlaube als Symbol für Liebe und Treue, die Kleidung als Ausdruck des sozialen Status und die Handhaltung des Paares als Symbol für die Ehe.
Schlüsselwörter
Peter Paul Rubens, Geißblattlaube, Doppelportrait, Barockkunst, Bildnistradition, ikonographische Symbole, Ehe, Liebe, Treue, Kleidung, soziale Status.
- Citation du texte
- Julia Geiser (Auteur), 2004, Die Geißblattlaube von Peter Paul Rubens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60910