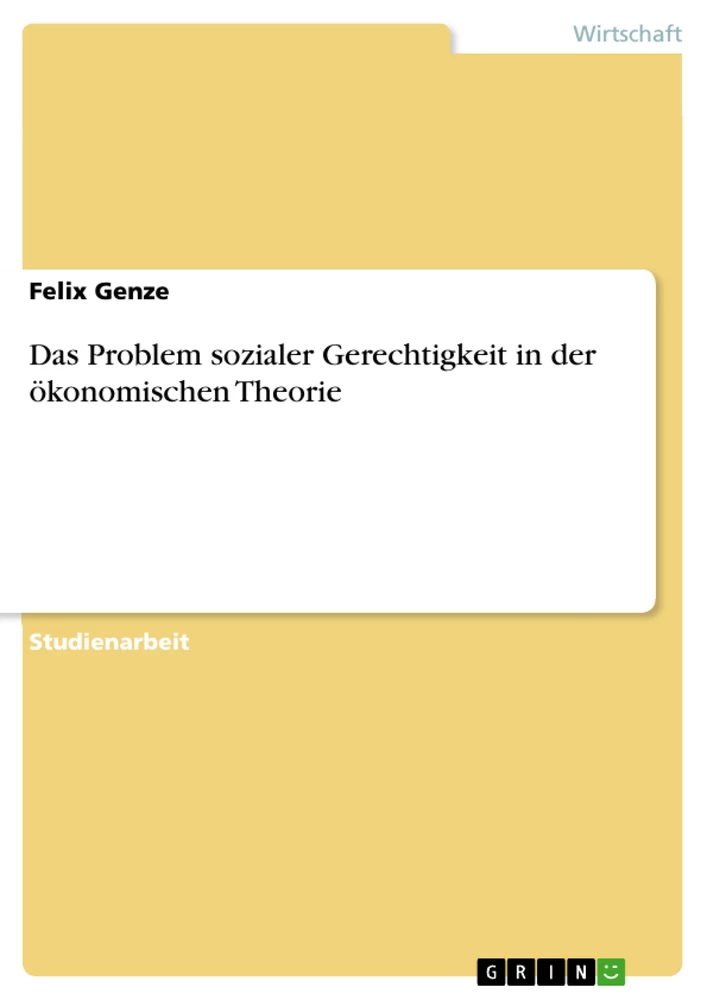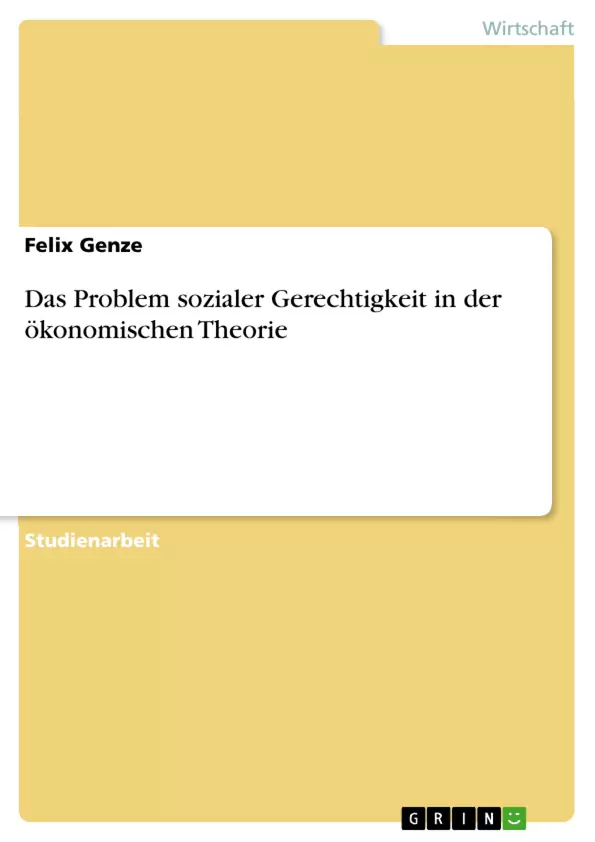Eine Parabel:
U ist auf der Suche nach einer wissenschaftlichen Hilfskraft und lädt auf die Ausschreibung hin A, B und C zu Vorstellungsgesprächen ein. U stellt fest, dass A, B und C indifferent in ihrem Bestreben sind, die Stelle zu bekommen. Ebenso schätzt U die von A, B und C zu erwartende Arbeitsleistung pro Lohneinheit gleichwertig ein. Unterschiede stellen sich nur wie im Folgenden beschrieben dar: Alle drei Aspiranten sind arm, A jedoch der Ärmste. B hingegen ist zwar reicher als A, verarmte jedoch erst in letzter Zeit. Da A und C sich schon an die Armut gewöhnt haben ist B daher der Unglücklichste unter den Dreien. U erfährt im Gespräch mit C, dass dieser unter einer chronischen, stoisch ertragenen Krankheit leidet und mit dem HiWi-Lohn eine heilende Therapie bezahlen könnte [vgl. Sen (1999, S.71f.)].
Es ist unschwer von diesem Beispiel abzuleiten, wie sehr das Problem einer gerechten Entscheidung abhängig von den ihr zugrunde liegenden Informationen und der individuellen Gewichtung einzelner Aspekte dieses Informationspools ist. So ist im vorliegenden Fall A aus Gesichtspunkten ausgleichender materieller Gerechtigkeit der Job zuzusprechen. B hätte ihn nach einer klassisch utilitaristischen Argumentationsweise gemäß Lust und Glück als Gerechtigkeitsmaßstab verdient. C hingegen sollte den Zuschlag bekommen, orientierte sich U an Gerechtigkeitsvorstellungen bezüglich der Lebensqualität von Menschen.
Seitdem Menschen in gemeinsamer, aber unterschiedlicher Anstrengung und Leistungsfähigkeit Güter produzieren und Dienstleistungen erbringen, stellt sich die Frage nach dem Verfügungsrecht der Beteiligten an dem Arbeitsergebnis, dem Sozialprodukt. Je arbeitsteiliger der Produktionsprozess, je unterschiedlicher die Leistungsbeiträge nach Art, Qualität und Quantität, je heterogener die Gesellschaftsstruktur, desto dringlicher stellt sich die soziale Frage - das Problem der gerechten Verteilung von Lasten und Erträgen dieser Zusammenarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Gerechtigkeitsverständnis im Wandel der Zeit
- Suum Cuique & Nikomachische Ethik - gerechtigkeitstheoretische Wurzeln
- Scholastische Weiterentwicklung
- Von Gerechtigkeit, Gleichheit und Glück - Utilitarismus
- Wohlfahrtstheorie
- John Rawls - Gerechtigkeit als „Fairness”
- Urzustand und der Schleier des Nichtswissens
- Gerechtigkeits-, Unterschiedsprinzip und Maximin-Strategie
- Achillessehnen des Rawlsschen Systems - kritische Positionen
- Verteilungsprinzipien als Rohbau sozialer Gerechtigkeit
- Leistungs-, Start-, Bedarfsgerechtigkeit und Sozialprinzip
- Zwischen Szylla und Charybdis - Eine Gegenüberstellung
- Praxismodelle staatlicher Einwirkung
- Angewandte Umverteilungspolitik zur Herstellung von Startgerechtigkeit
- Inzidenzanalyse steuerpolitischer Maßnahmen
- Staatliche Sicherungspolitik
- Herausforderung Globalisierung – Eine Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Problem der sozialen Gerechtigkeit im Kontext der ökonomischen Theorie. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffs, analysiert verschiedene Verteilungsprinzipien und untersucht die Rolle des Staates bei der Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft.
- Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffs
- Verschiedene Verteilungsprinzipien
- Der Einfluss von Globalisierung auf die soziale Gerechtigkeit
- Die Rolle des Staates bei der Herstellung sozialer Gerechtigkeit
- Kritische Analyse verschiedener Gerechtigkeitskonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Arbeit beginnt mit einer Parabel, die die Komplexität des Problems der sozialen Gerechtigkeit veranschaulicht. Es wird betont, wie wichtig die Wahl der zugrundeliegenden Informationen und die Gewichtung einzelner Aspekte für eine gerechte Entscheidung sind. Die Arbeit stellt außerdem das Problem der Verteilung von Ressourcen in einer arbeitsteiligen Gesellschaft dar.
- Gerechtigkeitsverständnis im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffs. Es werden die wichtigsten Gerechtigkeitskonzepte von der Antike bis zur Neuzeit beleuchtet, einschließlich Suum Cuique, der Nikomachischen Ethik, der scholastischen Weiterentwicklung und des Utilitarismus.
- John Rawls - Gerechtigkeit als „Fairness”: In diesem Kapitel wird die Gerechtigkeitskonzeption von John Rawls vorgestellt, die auf dem Konzept der „Fairness“ basiert. Es werden der Urzustand, der Schleier des Nichtswissens, das Gerechtigkeits- und Unterschiedsprinzip sowie die Maximin-Strategie behandelt.
- Verteilungsprinzipien als Rohbau sozialer Gerechtigkeit: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Verteilungsprinzipien wie Leistungs-, Start-, Bedarfsgerechtigkeit und das Sozialprinzip. Es wird ein Vergleich dieser Prinzipien vorgenommen und die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert.
- Praxismodelle staatlicher Einwirkung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des Staates bei der Herstellung von sozialer Gerechtigkeit. Es werden verschiedene Politikansätze zur Umverteilung von Ressourcen, zur Inzidenzanalyse steuerpolitischer Maßnahmen und zur staatlichen Sicherungspolitik vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Begriffen und Themen der sozialen Gerechtigkeit in der ökonomischen Theorie, darunter Gerechtigkeitskonzepte, Verteilungsprinzipien, staatliche Einwirkung, Globalisierung, Wohlfahrtstheorie, Utilitarismus, Rawlssche Gerechtigkeit, Startgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit und Inzidenzanalyse. Die Arbeit untersucht, wie sich diese Themen auf die Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft auswirken.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Gerechtigkeit als Fairness“ nach John Rawls?
Rawls schlägt vor, Gerechtigkeitsprinzipien in einem „Urzustand“ unter einem „Schleier des Nichtswissens“ zu wählen, um Unparteilichkeit zu garantieren.
Was ist der Unterschied zwischen Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit?
Leistungsgerechtigkeit belohnt den individuellen Beitrag, während Bedarfsgerechtigkeit darauf abzielt, jedem ein würdevolles Leben gemäß seinen Bedürfnissen zu ermöglichen.
Wie sieht die utilitaristische Sicht auf Gerechtigkeit aus?
Der Utilitarismus bemisst Gerechtigkeit am größten Glück der größten Zahl, was im Einzelfall zu Lasten von Minderheiten gehen kann.
Welche Rolle spielt der Staat bei der sozialen Gerechtigkeit?
Der Staat greift durch Umverteilung, Steuerpolitik und soziale Sicherungssysteme ein, um Startchancen anzugleichen und Notlagen abzufedern.
Was besagt das Differenzprinzip von Rawls?
Soziale Ungleichheiten sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie den am wenigsten begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft den größten Vorteil bringen.
- Citar trabajo
- Diplomökonom Felix Genze (Autor), 2004, Das Problem sozialer Gerechtigkeit in der ökonomischen Theorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61912