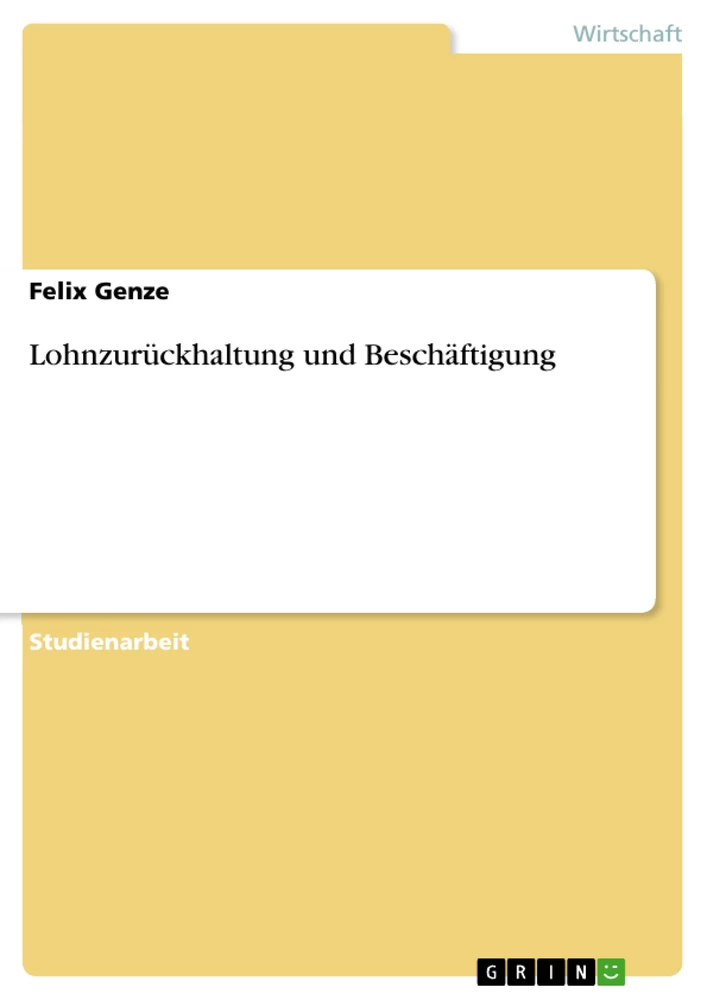In ihrer Argumentation gleichen alle Sozialwissenschaften, also auch die Ökonomie, einem zweischneidigen Schwert. Auf der einen Seite ermöglicht das hermeneutisch-historische Wesen sozialwissenschaftlicher Theoriebildung ein unbekümmertes Aufstellen von Gesetzmäßigkeiten nach dem Motto "Ausnahmen bestätigen die Regel". Auf der anderen Seite hingegen verleiht genau diese Eigenschaft jedem sozialwissenschaftlichen Diskurs zu einem gewissen Grad den Charakter einer "Never ending story".
Die Thematik der Lohnpolitik ist insbesondere deswegen ein „heißes Pflaster“, weil sie die Existenz der Tarifautonomie zu einem Wechselspiel verschiedenster Interessengruppen und Entscheidungsträger macht. Vor dem Hintergrund, dass zudem selbst innerhalb einer relativ überschaubaren ökonomischen Gruppierung – welche höchstes Ansehen unter dem Fachpublikum genießt – Uneinigkeit über elementare Ursache-Wirkungs-Beziehungen beschäftigungspolitischer Maßnahmen herrscht, lässt sich schlussfolgern, dass ein Ende der Debatte nicht in Sicht ist1. Verwunderlich ist gerade deswegen der oftmals geradezu apodiktisch anmutende Stil, in welchem Verlautbarungen zu dieser Problematik publik gemacht werden, deren wissenschaftlicher Status quo definitiv noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Dies trifft mit Sicherheit auch auf vorliegende Arbeit zu - sie erhebt daher also weniger Anspruch darauf, eine weitere in der Sammlung gut gemeinter Arbeitsmarkttheorien zu sein, sondern soll eher als eine Zusammenstellung des theoretisch- empirischen State-of-the-Art in Sachen „Lohnzurückhaltung und Beschäftigung“ verstanden werden.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich grob in drei Teilbereiche. Das folgende Kapitel soll dem Leser einen Überblick bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Wirkung von Löhnen geben. Im Weiteren werden die Wirkungen von Erwartungshaltungen auf den Märkten analysiert, es erfolgt ein Exkurs in den Diskurs um strukturelle Arbeitslosigkeit. Im dritten Kapitel wird die Wirkung nationaler Lohnpolitik hinsichtlich internationaler Wettbewerbsfähigkeit geprüft. Kapitel 4 beleuchtet die empirischen Entwicklungen und deren Kompatibilität mit vorgestellter Theorie. Hierbei wird insbesondere auch auf das exemplarische Beispiel Poldermodell eingegangen. Abschließend wird die deflationäre Wirkung von Lohnzurückhaltung vor dem Hintergrund der japanischen Rezession thematisiert und eine wirtschaftspolitische Schlussfolgerung gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Über den Nexus zwischen Lohn und Arbeit
- Die Janusköpfigkeit des Lohnes
- Exkurs: Erwartungen und akzellerierende Effekte
- ,,5% Inflation sind besser als 5% Arbeitslosigkeit“ – die NAIRU
- Globalisierungstendenzen - Chance oder Risiko?
- Die Wirkung von Produktivität und technischem Fortschritt
- Rückkopplungseffekte offener Volkswirtschaften
- Über Äpfel und Birnen – das Poldermodell
- Lohnpolitik im Test
- Empirische Evidenz – oder eher Auslegungssache?
- Die Deflationsgefahren zurückhaltender Lohnpolitik
- Zusammenfassung und wirtschaftspolitische Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen von Lohnzurückhaltung auf die Beschäftigung in einer Volkswirtschaft. Sie beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Lohnentwicklung, Produktivität, Inflation und Arbeitslosigkeit sowie die Rolle der Lohnpolitik in einem globalisierten Wirtschaftssystem.
- Der Einfluss von Lohnentwicklung auf die Beschäftigung
- Die Bedeutung von Erwartungen und akzellerierenden Effekten im Zusammenhang mit Lohnpolitik
- Die Rolle der Globalisierung für die Lohnpolitik und Beschäftigung
- Die empirische Evidenz für die Auswirkungen von Lohnzurückhaltung
- Die deflationären Gefahren zurückhaltender Lohnpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine einführende Betrachtung der Thematik und definiert den Begriff der Lohnzurückhaltung. Es betont den wissenschaftlichen Diskurs über die Beschäftigungswirkungen lohnpolitischer Maßnahmen und stellt die Argumentationslinien der Arbeit vor. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Nexus zwischen Lohn und Arbeit, indem es die Mikro- und Makroebene der Beschäftigung analysiert. Es thematisiert die "Janusköpfigkeit" des Lohnes, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Beschäftigung haben kann, und geht auf die Rolle von Erwartungen und akzellerierenden Effekten ein. Das dritte Kapitel widmet sich den globalen Herausforderungen für die Lohnpolitik und untersucht die Auswirkungen von Produktivität und technischem Fortschritt auf die Beschäftigung. Abschließend beleuchtet das vierte Kapitel die empirische Evidenz für die Auswirkungen von Lohnzurückhaltung und analysiert das "Poldermodell" als ein Beispiel für eine erfolgreiche Lohnpolitik.
Schlüsselwörter
Lohnzurückhaltung, Beschäftigung, Lohnpolitik, Globalisierung, Produktivität, Inflation, Arbeitslosigkeit, NAIRU, Poldermodell, Deflation, Wirtschaftspolitik, SVR
Häufig gestellte Fragen
Führt Lohnzurückhaltung zwangsläufig zu mehr Beschäftigung?
Das ist umstritten. Während es auf der Kostenseite Unternehmen entlasten kann, schwächt es auf der anderen Seite die Binnennachfrage, was negativ auf das Wachstum wirken kann.
Was versteht man unter der „Janusköpfigkeit des Lohnes“?
Lohn ist einerseits ein Kostenfaktor für Unternehmen, andererseits aber auch Einkommen und damit Kaufkraft für die privaten Haushalte.
Was ist das „Poldermodell“?
Es bezeichnet die niederländische Konsenspolitik, bei der Gewerkschaften und Arbeitgeber durch moderate Lohnabschlüsse und Flexibilisierung den Arbeitsmarkt stabilisierten.
Welche Gefahren birgt eine zu starke Lohnzurückhaltung?
Eine zentrale Gefahr ist die Deflation, wie sie in Japan zu beobachten war, da sinkende oder stagnierende Löhne zu einem Rückgang des allgemeinen Preisniveaus und wirtschaftlicher Rezession führen können.
Was bedeutet der Begriff NAIRU?
NAIRU steht für „Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment“ und bezeichnet die Arbeitslosenquote, bei der die Inflation stabil bleibt.
- Citar trabajo
- Diplomökonom Felix Genze (Autor), 2004, Lohnzurückhaltung und Beschäftigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61915