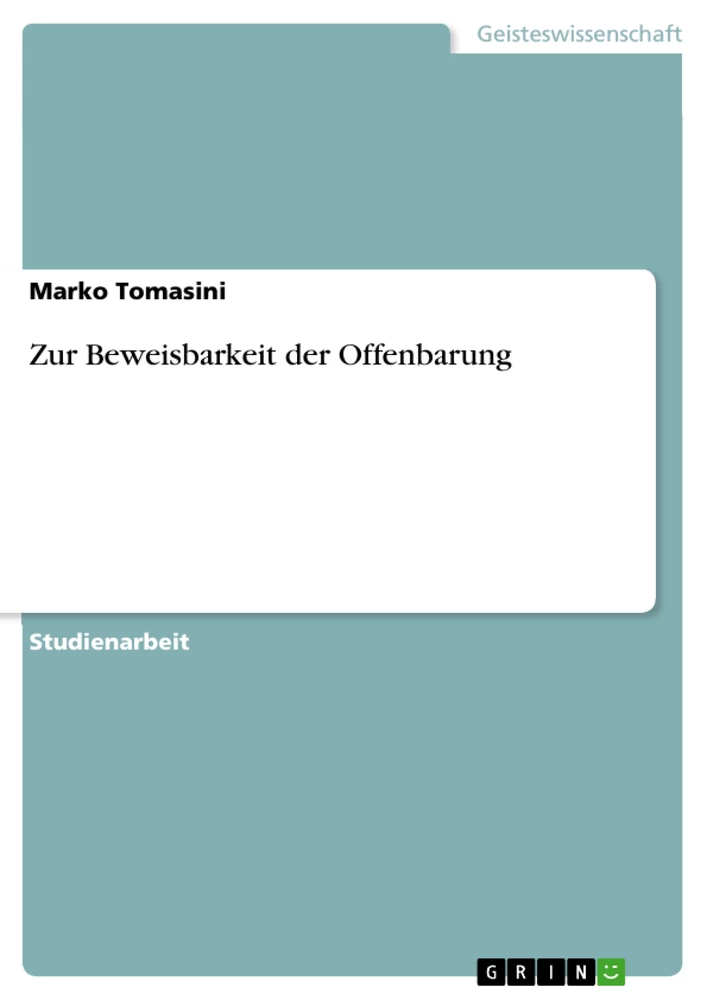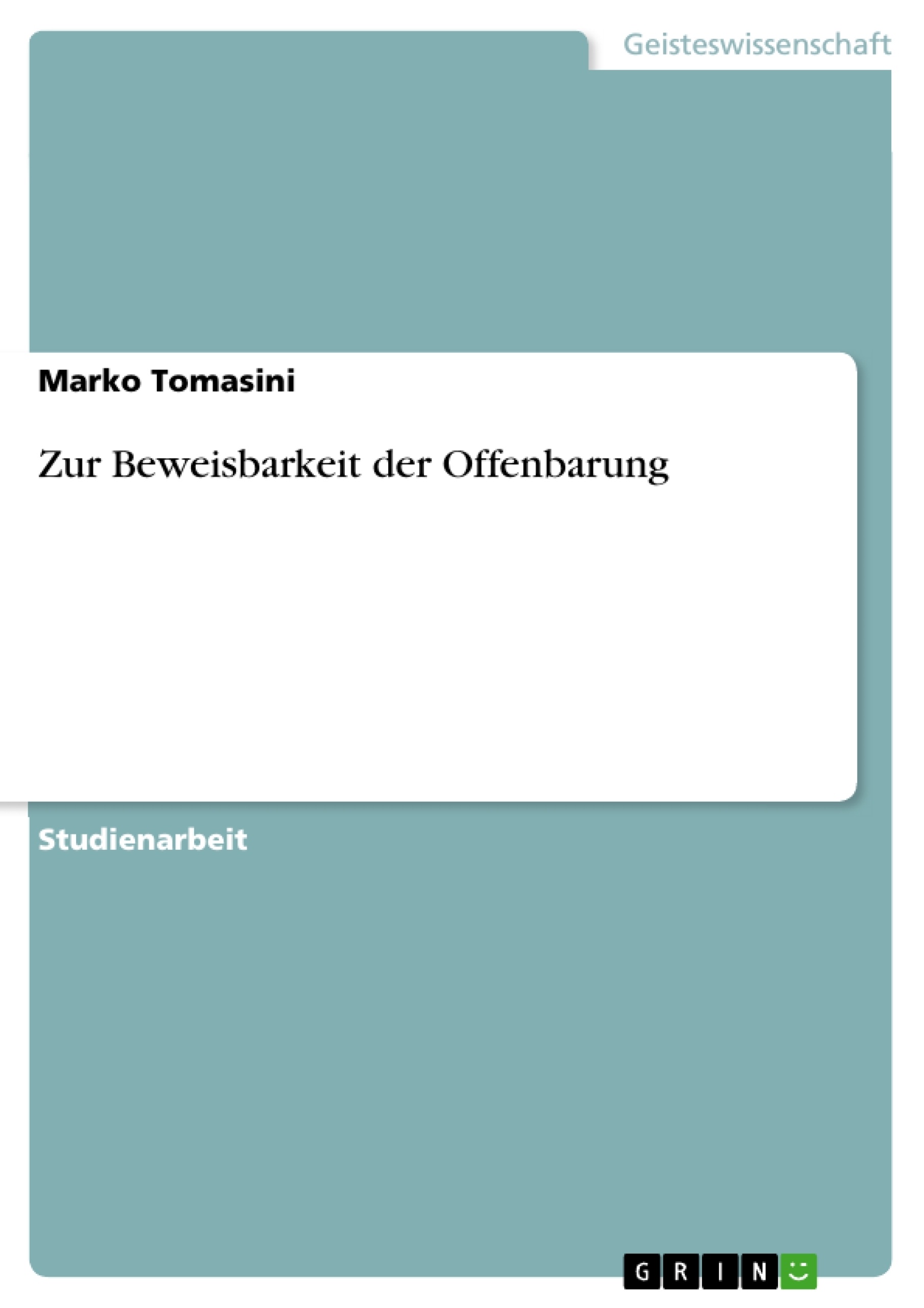Philosophie und Theologie sind im Grunde zwei Wissenschaften für sich und dennoch überschneiden sie sich des Öfteren in den Themen bzw. Fragen, die sie behandeln. Das war auch im Islam nicht anders. Besonders bis in das 12. Jahrhundert gab es regen Austausch zwischen diesen Wissenschaften, aber auch große Streitigkeiten. Zum Ersten kann man sagen, dass sich die Theologen immer wieder gern des philosophischen Werkzeuges bedienten, um ihre theologischen Standpunkte verteidigen zu können. So war zum Beispiel in der theologischen Schule der Mu´tazila die Demonstration und die Dialektik beliebt, wenn es darum ging ihre „Gegner“ innerhalb der eigenen Reihen und auch außerhalb derer zu widerlegen.7 Aber dennoch waren sie Theologen, also Wissenschaftler die in erster Linie die offenbarten Texte als Grundlage nahmen, um zu tieferen Wahrheiten vorzudringen. Die Wahrnehmbare Welt galt ihnen nur als Mittel der Beweisführung. Anders bei den Philosophen dieser Zeit. Für sie galt die Philosophie selbst als die Wissenschaft, mit deren Hilfe man die absolute Wahrheit würde finden können, auch wenn sie sich als gläubige Muslime sahen. Die Religion war ihnen für das einfache Volk mit weniger Bildung gedacht und hatte auch da ihre Berechtigung.
Es zeichnet sich also an dieser Stelle bereits ab, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Wissenschaften nicht immer das Beste war. Um diesen Umstand soll es in dieser Arbeit gehen. Dazu werden drei Gelehrte aus dem Islam vorgestellt, die als führende Vertreter ihrer Zeit hauptsächlich in diesem Streit verwickelt waren bzw. diesen stellvertretend für andere führten. Dies sind Ibn Sīnā (Avicenna), al-Ġazālī und der schon erwähnte Ibn Ruschd (Averroes). Die unterschiedlichen Stellungen hinsichtlich der Wissenschaften hatten logischer Weise auch zur Folge, dass die verschiedensten Theorien hinsichtlich theologischer und philosophischer Fragen entwickelt wurden. Eine solche Frage war zum Beispiel auch diejenige nach der Beweisbarkeit Gottes, welche neben den Divergenzen hinsichtlich der Wissenschaft im Allgemeinen in dieser Arbeit vorgestellt werden soll. Man kann sich denken, dass diese Beweise höchst unterschiedlich ausgefallen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ibn Sīnā
- Philosophie und Theologie
- Der Gottesbeweis des Ibn Sīnā
- Al-Ġazālī
- Theologie und Philosophie
- Al-Ġazālīs Gottesbeweis und ein Schritt zurück
- Ibn Rušd
- Harmonien zwischen Philosophie und Theologie
- Der Gottesbeweis des Ibn Rušd
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie im Islam des 10.-12. Jahrhunderts. Sie untersucht, wie drei prominente Gelehrte – Ibn Sīnā, al-Ġazālī und Ibn Rušd – die Beziehung zwischen diesen beiden Wissenschaften sahen und wie ihre Ansichten die Entwicklung des islamischen Denkens beeinflussten. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Debatte um die Beweisbarkeit Gottes, die zentrale Rolle im Diskurs zwischen Philosophie und Theologie spielte.
- Das Spannungsverhältnis zwischen Philosophie und Theologie im Islam des Mittelalters
- Die unterschiedlichen Ansätze der drei Gelehrten Ibn Sīnā, al-Ġazālī und Ibn Rušd
- Die Frage nach der Beweisbarkeit Gottes und die verschiedenen Beweise
- Die Bedeutung der Offenbarung und des Korans im Kontext philosophischer Argumente
- Der Einfluss dieser Debatten auf die Entwicklung des islamischen Denkens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Averroismus ein und erläutert, wie dieser in der Geschichte des christlichen Denkens wahrgenommen wurde. Sie stellt dar, dass der Averroismus in der Vergangenheit als Bedrohung für den katholischen Glauben angesehen wurde und dass diese Sichtweise bis heute besteht. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Verhältnisses zwischen Philosophie und Theologie im Islam hervorgehoben.
- Ibn Sīnā: Dieses Kapitel stellt die philosophischen und theologischen Ansichten des Ibn Sīnā dar. Es beleuchtet, wie Ibn Sīnā den Einfluss der Philosophie auf die Theologie sah und wie er einen Gottesbeweis aus der Philosophie ableitete.
- Al-Ġazālī: Al-Ġazālī, der in diesem Kapitel behandelt wird, repräsentiert eine kritische Position gegenüber der Philosophie. Es wird gezeigt, wie er den Gottesbeweis des Ibn Sīnā in Frage stellte und die Vorrangstellung der Offenbarung gegenüber der Philosophie betonte.
- Ibn Rušd: Im letzten Kapitel wird die Position des Ibn Rušd vorgestellt, der sich für eine harmonische Verbindung von Philosophie und Theologie einsetzte. Er entwickelte einen eigenen Gottesbeweis und argumentierte, dass beide Wissenschaften sich gegenseitig ergänzen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schnittstelle zwischen Philosophie und Theologie im Islam des Mittelalters. Im Zentrum stehen die drei bedeutenden Gelehrten Ibn Sīnā, al-Ġazālī und Ibn Rušd, deren unterschiedliche Ansätze zum Verhältnis von Vernunft und Offenbarung beleuchtet werden. Darüber hinaus spielen Themen wie der Gottesbeweis, die Koranauslegung und die Entwicklung des islamischen Denkens eine wichtige Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Wie standen Philosophie und Theologie im mittelalterlichen Islam zueinander?
Es gab ein Spannungsverhältnis: Während Theologen die Offenbarung als Basis nutzten, sahen Philosophen die Vernunft als Weg zur absoluten Wahrheit an.
Was war der Gottesbeweis des Ibn Sīnā (Avicenna)?
Ibn Sīnā entwickelte einen Beweis aus der reinen Vernunft und Logik, der Gott als das "notwendig Seiende" definiert.
Warum kritisierte Al-Ġazālī die Philosophen?
Al-Ġazālī betonte die Vorrangstellung der Offenbarung und hielt rein philosophische Gottesbeweise für unzureichend und potenziell gefährlich für den Glauben.
Welchen Ansatz verfolgte Ibn Rušd (Averroes)?
Ibn Rušd setzte sich für eine Harmonie zwischen Philosophie und Theologie ein und argumentierte, dass sich Vernunft und Offenbarung gegenseitig ergänzen.
Was sind die Taḥaddi-Verse im Kontext der Beweisführung?
Sie dienen als theologischer Beweis für die göttliche Herkunft des Korans, indem sie die Menschen herausfordern, etwas Gleichwertiges zu schaffen.
- Citar trabajo
- Marko Tomasini (Autor), 2006, Zur Beweisbarkeit der Offenbarung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62996