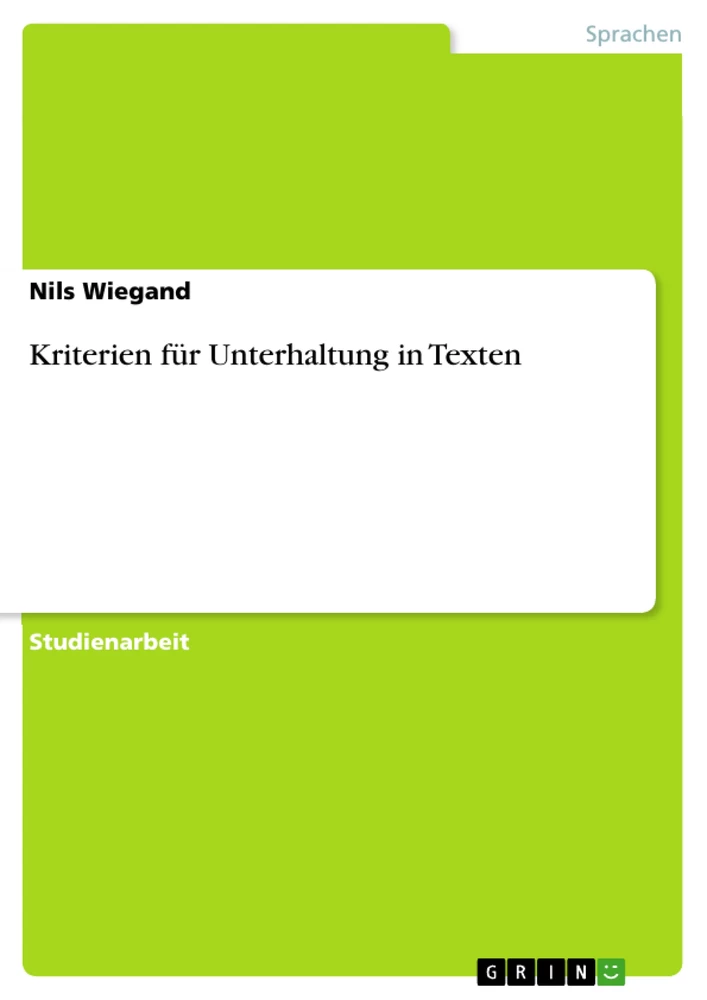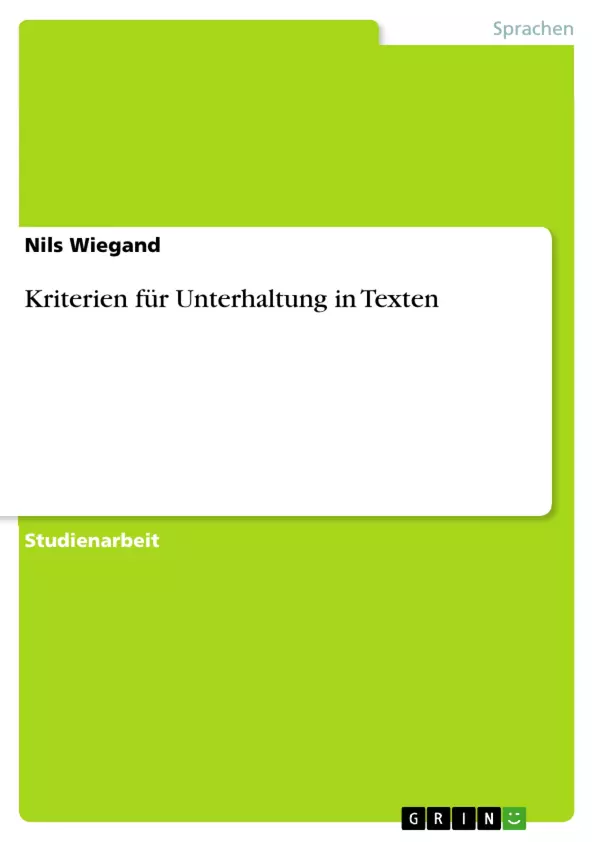Die theoretische Problematik der bisherigen Unterhaltungsforschung besteht in der schwierigen Übertragbarkeit der Ergebnisse aufeinander, da diese zumeist aus unterschiedlichen Forschungsbereichen kommen, so dass sowohl ein gemeinsamer Bezugsrahmen als auch eine gemeinsame Terminologie fehlen. 1 Ein Alltagsverständnis von Unterhaltung wirft zunächst die theoretische Schwierigkeit auf, dass bspw. nicht jede Comedyshow für jedermann gleichsam unterhaltend ist, dass es verschiedene Formate in verschiedenen Medien als „sozial distributive Tragflächen von verbalen oder nonverbalen Texten“ 2 gibt, die mitunter auch unfreiwillig komisch und somit unterhaltend sind. Harald Schmidt ließ nach den Anschlägen vom 11. September seine Late-Night-Talkshow (SAT 1) zunächst ausfallen, anlässlich des Afghanistan-Feldzuges konnte man jedoch auf seiner Homepage lesen: „Aus aktuellem Anlass findet die Sendung statt.“ Offenbar gibt es in der Praxis Kriterien, nach denen ein Unterhaltungsangebot funktionieren kann, und anhand dieser Kriterien müsste sich eine Theorie der Unterhaltung messen lassen. Zudem hat sich der Stellenwert des Unterhaltungsbegriffs maßgeblich verändert. Werner Früh verweist daher auch auf eine veränderte Wertigkeit der Unterhaltung, die sich bspw. in Form des Infotainments bzw. Entertainments als seriös behaupten kann: „Wichtige politische und sonstige Informationen, die nur wenige interessieren oder von kaum jemandem verstanden wurden, sollen durch unterhaltsame Aufarbeitung plötzlich so attraktiv werden, dass sich nicht nur sehr viel mehr Menschen ihnen zuwenden, sondern sie auch noch mit größerer Aufmerksamkeit wahrgenommen und dadurch besser verstanden werden.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kommunikationstheoretische Grundlegung
- Text - Kommunikation - Medialsystem
- Vertextung und Intertextualität
- Unterhaltung als rhetorischer Begriff
- Die Unterhaltung des Lesers
- Die Situativität und Ambivalenz der Unterhaltung.
- Unterhaltung aus oratorischer Perspektive.
- Unterhaltung als kommunikativer Prozess...
- Labeling als persuasive Strategie
- Schlussbemerkung.........
- Literaturverzeichnis:.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Kriterien in Texten für Unterhaltung gelten bzw. welche Kriterien Unterhaltungsangebote erfüllen müssen, um als solche auch angenommen zu werden. Darüber hinaus reflektiert diese Arbeit Unterhaltung als kommunikatives Geschehen, bei dem der rhetorische Orator intervenieren kann.
- Kriterien für Unterhaltung in Texten
- Unterhaltung als kommunikativer Prozess
- Die Rolle des rhetorischen Orators
- Bedeutung des Textbegriffs und des Kommunikationsprozesses
- Persuasive Strategien in der Unterhaltung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht die Kriterien für Unterhaltung in Texten und betrachtet Unterhaltung als kommunikatives Geschehen. Sie beleuchtet die Problematik der bisherigen Unterhaltungsforschung und die veränderte Wertigkeit des Unterhaltungsbegriffs.
- Kommunikationstheoretische Grundlegung: Dieses Kapitel definiert den Textbegriff und erläutert die Rolle von Zeichen, Zeichensystemen und Kodes in der Kommunikation. Es wird der Prozess der Bedeutungsproduktion durch den Kommunikator und die gemeinsame Kompetenz in Zeichensystemen für das Verstehen von Sinn hervorgehoben.
- Unterhaltung als rhetorischer Begriff: Dieses Kapitel untersucht die Unterhaltung des Lesers und die Situativität und Ambivalenz der Unterhaltung. Es analysiert die Bedeutung von Unterhaltung als persuasiver Prozess und als „Wechsel von einem mentalen Zustand in einen anderen“.
- Unterhaltung aus oratorischer Perspektive: Dieses Kapitel betrachtet Unterhaltung als kommunikativen Prozess, bei dem der rhetorische Orator interveniert. Es untersucht Labeling als persuasive Strategie in der Unterhaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Kommunikationstheorie, Rhetorik, Textanalyse, Unterhaltungsforschung, persuasive Kommunikation, Labeling und den Einfluss des Orators auf den Unterhaltungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kriterien machen einen Text unterhaltsam?
Unterhaltung wird oft durch den Wechsel mentaler Zustände, rhetorische Strategien und die Passgenauigkeit zum Vorwissen des Lesers erreicht.
Was versteht man unter "Infotainment"?
Die Verknüpfung von Information und Unterhaltung, um komplexe Themen attraktiver und verständlicher für ein breites Publikum zu machen.
Welche Rolle spielt die Rhetorik in der Unterhaltung?
Die Rhetorik nutzt persuasive Strategien wie das "Labeling", um die Aufmerksamkeit des Publikums zu steuern und Botschaften wirkungsvoll zu platzieren.
Warum ist Unterhaltung ein ambivalenter Begriff?
Weil sie subjektiv ist: Was eine Person als komisch oder unterhaltend empfindet, kann eine andere als langweilig oder unpassend wahrnehmen.
Was bedeutet Intertextualität im Kontext von Texten?
Es ist der Bezug eines Textes auf andere Texte, was oft als humorvolles oder erkennbares Element zur Unterhaltung beiträgt.
- Quote paper
- Nils Wiegand (Author), 2006, Kriterien für Unterhaltung in Texten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64120