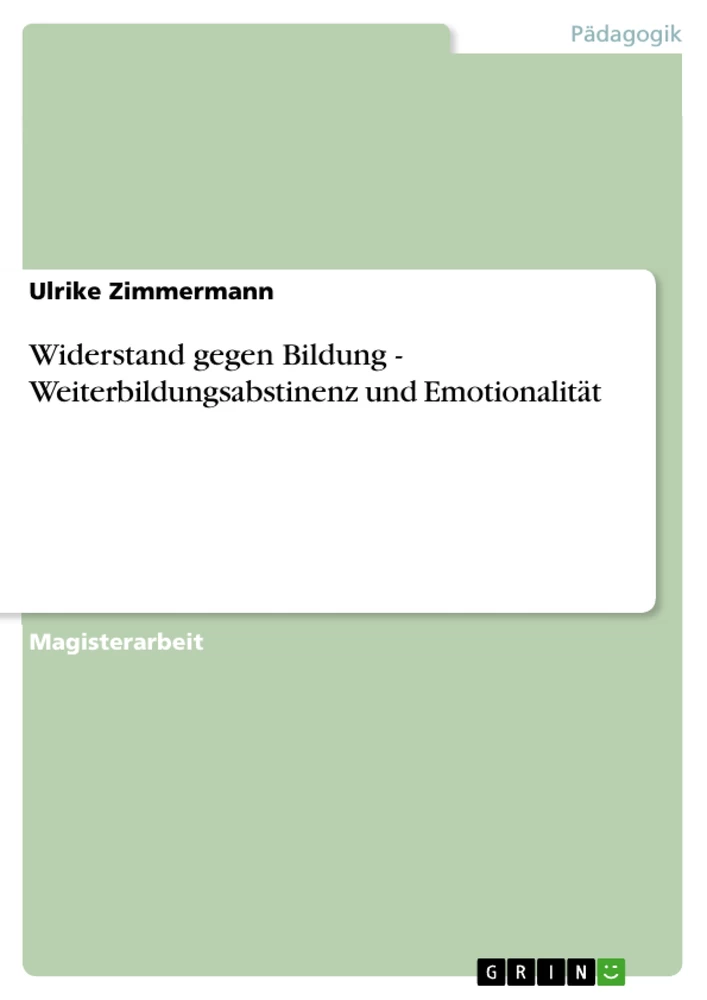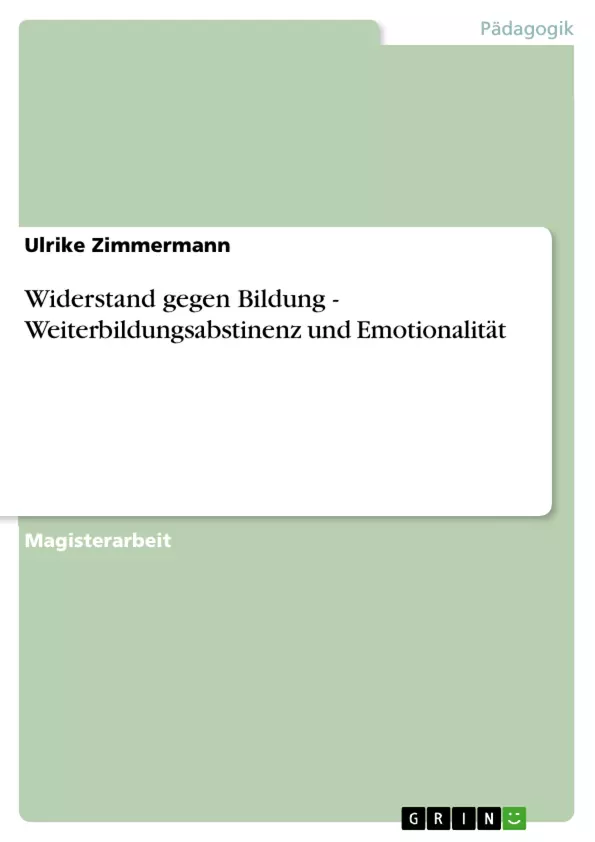Neue Techniken revolutionieren unsere Arbeitswelt und Gesellschaft. Dadurch verändert sich die Organisation von Arbeit. Im Kontext von Modernisierung wird daher die Notwendigkeit sich weiterzubilden als eine Adaptionsleistung des Individuums verstanden. Über unterschiedliche Interessen hinweg besteht Einigkeit darüber, dass die Einführung von neuen Techniken Konsequenzen für die Qualifikation der Einzelnen nach sich ziehen wird und das Schlagwort vom Lebenslangen Lernen gesellschaftliche Realität wird. Interessant ist die Frage, wie die Individuen mit dem als objektiv geltenden Erfordernis ihre Qualifikation zu modernisieren umgehen, denn zu beobachten ist eine Diskrepanz zwischen der allgemeinen Anerkennung des Postulats von Weiterbildung und der Umsetzung in die Tat. Berufliche Weiterbildung wird als Zwang wahrgenommen (Bolder 1994a, 200). Als Teilnehmer von beruflicher Weiterbildung stellt man sich diesem Zwang mit Einsicht in die Notwendigkeit. Solange keine konkrete Existenzbedrohung wahrgenommen wird und kein Arbeitgeber oder Vorgesetzter eine Veränderung der Arbeitsplatzsituation veranlasst oder anrät, wird berufliche Weiterbildung nicht ins Auge gefasst. Für die als „weiterbildungsfern“ Eingestuften ergibt sich für sie selbst keine Notwendigkeit, sich weiterzubilden. Ändert sich eine der beiden oben genannten Bedingungen, ändert sich die Ausgangssituation. „Man wird dann in aller Regel nicht umhin kommen, sich der Mühe beruflicher Weiterbildung zu unterziehen, die im Gegensatz zu allgemeinen Weiterbildungsveranstaltungen eher keinen Spaß zu machen und in Gestalt und Inhalt kaum auf die spezifischen Lebensbedürfnisse zugeschnitten scheint. Der Eindruck von Zwang und Fremdbestimmung überwiegt also. Er verfestigt sich schließlich, wenn Nicht-Teilnehmer die Auswahl von Teilnehmern an betrieblich veranlaßter Weiterbildung als ein System von Belohnung und Strafe wahrnehmen“.
Der Unterschied zwischen befragten Teilnehmern und Nichtteilnehmern liegt nicht in der Grundhaltung zu Weiterbildung selbst. Diese ist in beiden Gruppen eher abwartend. Meist ist die Teilnahme nicht längerfristig geplant und auf Aufstieg und Entfaltung gerichtet, sondern erfolgt defensiv und sicherheitsorientiert.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Zugänge, Abgrenzungen, Begrifflichkeiten
- 1.1 Nichtteilnahme, Widerstand und Abstinenz – begriffliche Abgrenzungen
- 1.2 Forschungsstand zum Thema Weiterbildungsabstinenz (Auswahl)
- 1.3 Weiterbildungsabstinenz – Eine Studie (Bolder et. al. 1994-2000)
- 1.3.1 Fragestellung
- 1.3.2 Methodologie und Ergebnisse
- 1.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 1.4 Ursachen und Gründe für Abstinenz – Interdependente Strukturen
- 1.4.1 Objektive Chancenstrukturen
- 1.4.2 Individuelle, biografisch vorgezeichnete Chancen
- 1.4.3 Relevanzsetzungen und Intentionen des wägenden, handelnden Subjekts
- 1.5 Weiterbildungsabstinente Personen und Personengruppen
- 1.5.1 Untersuchungen
- 1.5.2 Kumulation von Hinderungsgründen
- 2 Abstinenz als widerständiges Handeln
- 2.1 Widerstand in unterschiedlichen Kontexten
- 2.2 Widerstand in pädagogischen Kontexten
- 2.3 Pädagogische Widerstandsforschung im deutschsprachigen Raum
- 2.4 Formen von Widerstand
- 2.5 Widerstand als Stellungnahme
- 2.6 Widerstand als Unterlassungshandeln
- 3 Das Emotionale in pädagogischen Kontexten und seine Unterbewertung
- 4 Abgrenzung und Schnittstellen von Emotion und Kognition
- 4.1 Das Gefühl als spezifische Form der Weltvergegenwärtigung
- 4.2 Neurobiologische Evidenzen
- 4.3 Gefühle als ganzheitliche Stellungnahmen des Subjekts
- 5 Emotionsregulierung und Handlungskontrolle
- 5.1 Fühlen, Denken und Handeln
- 5.2 Emotionsregulierung und Kompetenz
- 5.3 Kompetenzerwartung und Handlungskontrolle
- 6 Implikationen
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Widerstands gegen Bildung, insbesondere im Kontext der Weiterbildungsabstinenz. Die Arbeit argumentiert, dass Weiterbildungsabstinenz ein bewusster und zielgerichteter Entscheidungsprozess ist, der auf emotionalen Grundlagen basiert. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen und Gründe für Weiterbildungsabstinenz zu erforschen, Widerstand als Handlungsform zu analysieren und die Rolle der Emotionalität in pädagogischen Kontexten zu beleuchten.
- Weiterbildungsabstinenz als Form des Widerstands
- Die Bedeutung der Emotionalität bei Bildungsentscheidungen
- Analyse von Ursachen und Gründen für Weiterbildungsabstinenz
- Widerstand als Handlungsform in pädagogischen Kontexten
- Emotionale Prozesse und ihre Auswirkungen auf das Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema „Widerstand gegen Bildung“ vor und erläutert den Zusammenhang zwischen Weiterbildungsabstinenz und Emotionalität. Kapitel 1 befasst sich mit den begrifflichen Abgrenzungen von Nichtteilnahme, Widerstand und Abstinenz und gibt einen Überblick über den Forschungsstand zum Thema Weiterbildungsabstinenz. Es werden verschiedene Studien und Forschungsergebnisse analysiert, um die Ursachen und Gründe für Abstinenz zu beleuchten. Kapitel 2 untersucht Widerstand als widerständiges Handeln in unterschiedlichen Kontexten, insbesondere in pädagogischen Kontexten. Es werden verschiedene Formen von Widerstand und die Rolle von Unterlassungshandeln als widerständiges Handeln diskutiert. Kapitel 3 widmet sich der Bedeutung der Emotionalität in pädagogischen Kontexten und stellt den Zusammenhang zwischen Fühlen und Denken dar. Kapitel 4 behandelt den Aspekt der Emotionsregulierung und Handlungskontrolle, wobei die Bedeutung negativer emotionaler Erfahrungen für handlungsimmanente Entscheidungsprozesse hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Weiterbildungsabstinenz, Widerstand, Emotionalität, pädagogische Kontexte, Handlungstheorie, Emotionsregulierung, Entscheidungsfindung und Bildungsforschung. Der Fokus liegt auf der Analyse des Zusammenspiels von kognitiven und emotionalen Prozessen im Zusammenhang mit Bildungsprozessen und der Frage, wie diese Prozesse zur Abstinenz von Weiterbildung führen können.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Weiterbildungsabstinenz?
Es bezeichnet die bewusste Nichtteilnahme an Bildungsangeboten, obwohl diese gesellschaftlich oder beruflich als notwendig erachtet werden.
Warum wird Weiterbildung oft als Zwang empfunden?
Viele Angebote wirken fremdbestimmt und sind kaum auf die spezifischen Lebensbedürfnisse der Lernenden zugeschnitten, was Gefühle von Widerstand auslöst.
Welche Rolle spielen Emotionen bei der Bildungsabstinenz?
Gefühle dienen als ganzheitliche Stellungnahmen des Subjekts. Negative Emotionen und geringe Kompetenzerwartungen führen oft zur Entscheidung gegen eine Teilnahme.
Was ist pädagogische Widerstandsforschung?
Dieser Forschungszweig untersucht Widerstand nicht als Defizit, sondern als aktive Stellungnahme oder Unterlassungshandlung des Individuums gegenüber Bildungsansprüchen.
Gibt es Unterschiede zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern?
Studien zeigen, dass die Grundhaltung oft ähnlich abwartend ist; Teilnehmer agieren jedoch meist defensiv und sicherheitsorientiert, wenn sie einen Zwang zur Anpassung wahrnehmen.
- Citation du texte
- Ulrike Zimmermann (Auteur), 2006, Widerstand gegen Bildung - Weiterbildungsabstinenz und Emotionalität , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64373