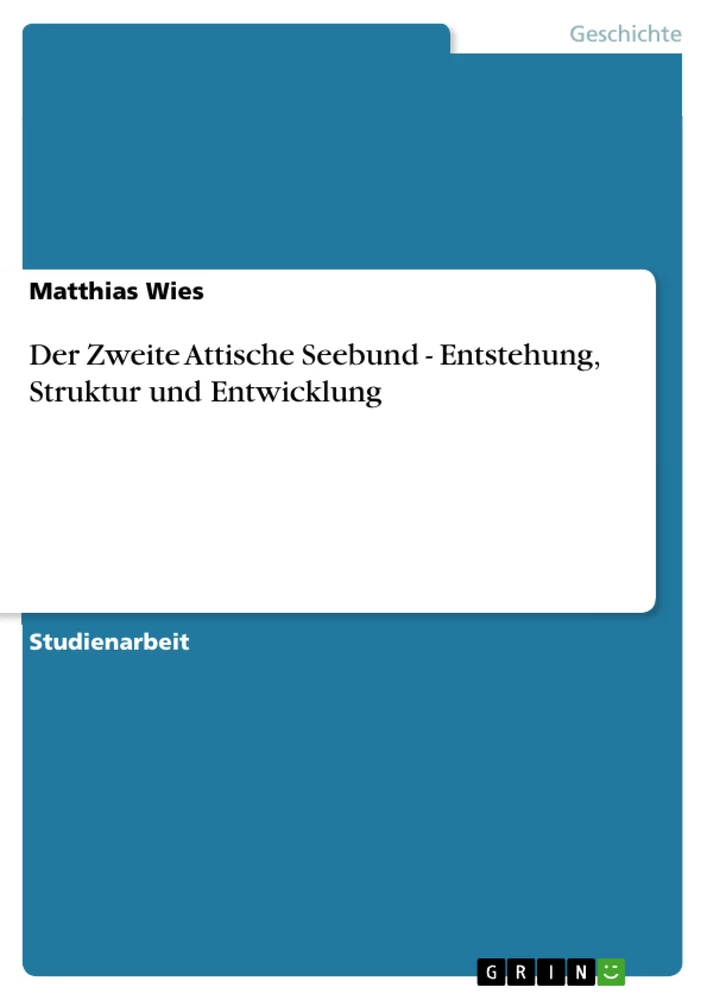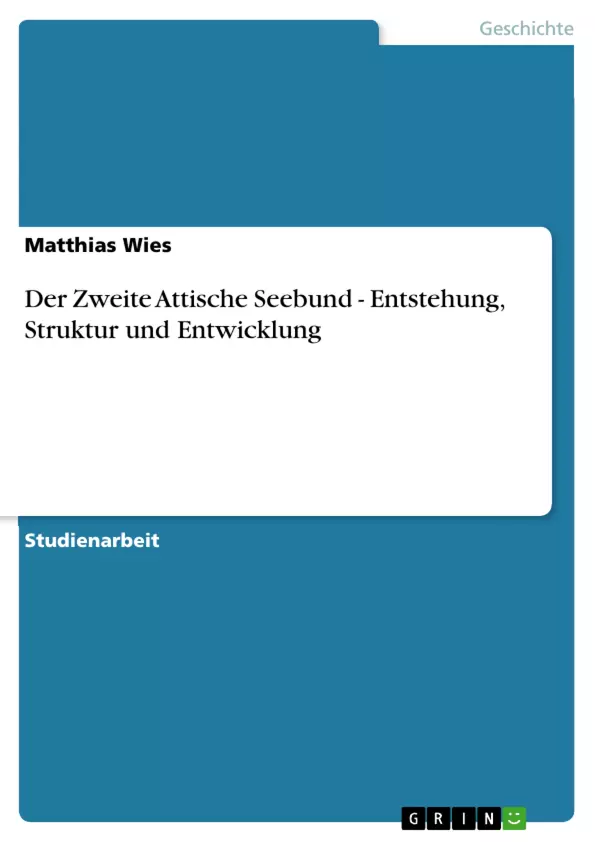Die Niederlage im Peloponnesischen Krieg und die Auflösung des Delisch-Attischen Seebundes war für Athen ein schwerer Schlag. Aber Spartas rigoroses Durchsetzen seiner Hegemonialpolitik führte zu einer immer größer werdenden Ablehnung in Griechenland, so dass Athen wieder die Möglichkeit besaß, ein neues Bündnissystem aufzubauen. Dieser neue Seebund war gegen Sparta gerichtet, sollte aber auch die alte Stellung der Athener, vor allem in der Ägäis, wieder herstellen. Über eine einheitliche Bezeichnung dieses Seebündnisses des vierten Jahrhunderts ist man sich in der Forschung nicht einig. Im englischsprachigen Raum konnte man sich zwar auf „The Second Athenian Confederacy“ und „The Second Athenian League“ verständigen, im deutschsprachigen Raum jedoch gibt es noch keinen einheitlichen Terminus. Schäfer spricht von dem „Athenischen Seebund“ oder einfach nur vom „Jüngeren Bund“, Höck und Dreher bezeichnen das Bündnis als „Zweiten Athenischen Seebund“, Busolt und Lenz als „Zweiten Athenischen Bund“, Ehrenberg als „Zweiten attischen Bund“ und in der neusten Forschung überwiegt die Bezeichnung „Zweiter Attische Seebund“. Es gibt also viele mögliche Kombinationen von „athenisch“, „attisch“, „Bund“ und „Seebund“, in dieser Arbeit wird das Bündnis durchweg als „Zweiter Attischer Seebund“ bezeichnet und schließt sich somit der neusten Forschung an. Hauptquellen für dieses Bündnis sind Xenophon, bei dem das Bündnis aber wenig erwähnt wird und Diodor. Er schließt zwar Lücken, ist aber bei der Datierung und den Fakten häufig fehlerhaft. Als weitere Quellen kann man noch Demosthenes, Isokrates und Aischines heranziehen, die aber teilweise nur sehr fragmentarisch erhalten geblieben sind. Zur Klärung vieler Ereignisse und Entwicklungen, aber auch zur Analyse der Struktur des Bundes dienen häufig Bündnisse und Verträge, die Hermann Bengston in seinen „Staatsverträgen des Altertums“ gesammelt hat. In einem ersten Teil werden die Politik und das Verhalten Spartas und Athens skizziert und die Vorraussetzungen und Ereignisse genannt, die zur Gründung des Zweiten Attischen Seebundes geführt haben. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Struktur des Bundes. Hier werden zuerst das Aristoteles-Dekret und weitere Quellen, die von der Gründung berichten, untersucht. Danach wird auf einzelne Institutionen und Verfahren eingegangen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- „Vorgeschichte“/Entstehung
- Spartas Hegemonialpolitik
- Athens Veralten
- Sphodrias-Affäre
- Struktur
- Gründung des Zweiten Attischen Seebundes im Frühjahr 377
- Inhalt des Vertragstextes
- IG II/III2 43 = StV 257
- Diodor XV, 28, 2-4; 29, 8
- Bezug auf Königsfrieden
- Das Synhedrion und seine Aufgaben
- Finanzielle Abgaben der Bündner
- Schiffskontingente und Heer
- Mitglieder und Aufnahme in den Bund
- Entwicklung
- Entwicklung bis 371/70
- Entwicklung bis zum Bundesgenossenkrieg
- Symmachie oder Arché?
- Der Bundesgenossenkrieg 357-355
- Entwicklung bis Chaironeia
- „Vorgeschichte“/Entstehung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung, Struktur und Entwicklung des Zweiten Attischen Seebundes im 4. Jahrhundert v. Chr. Ziel ist es, ein umfassendes Bild dieses wichtigen Bündnissystems im antiken Griechenland zu liefern und die bestehenden Forschungsdebatten zu beleuchten.
- Spartas Hegemonialpolitik und deren Einfluss auf die Gründung des Seebundes
- Die Struktur des Zweiten Attischen Seebundes, einschließlich seiner Institutionen und Finanzierungsmechanismen
- Die Entwicklung des Seebundes über verschiedene Phasen hinweg
- Die Rolle des Seebundes im Kontext der griechischen Politik des 4. Jahrhunderts v. Chr.
- Die Frage, ob der Seebund eine Symmachie oder eine Arché darstellte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die schwierige Lage Athens nach dem Peloponnesischen Krieg und die Notwendigkeit, ein neues Bündnissystem gegen Sparta aufzubauen. Sie diskutiert die unterschiedlichen Bezeichnungen des Bündnisses in der Forschung und wählt „Zweiter Attischer Seebund“ als einheitliche Bezeichnung für diese Arbeit. Die wichtigsten Quellen, insbesondere Xenophon und Diodor, werden vorgestellt und deren Stärken und Schwächen hinsichtlich der Rekonstruktion des Seebundes erörtert. Die Struktur der Arbeit mit ihren drei Hauptteilen wird umrissen.
„Vorgeschichte“/Entstehung: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorbedingungen zur Gründung des Zweiten Attischen Seebundes. Es beschreibt Spartas aggressive Hegemonialpolitik nach dem Sieg im Peloponnesischen Krieg, die zu wachsender Ablehnung in Griechenland führte. Der Korinthische Krieg und die Schlacht von Knidos werden als wichtige Wendepunkte dargestellt, die Athens Position stärkten. Der Antalkidas-Frieden wird analysiert, der zwar Sparta kurzfristig Vorteile brachte, aber die Spannungen nicht wirklich löste und letztlich die Grundlage für den neuen Seebund legte. Der Fokus liegt auf der zunehmenden Unzufriedenheit mit der spartanischen Herrschaft und dem daraus resultierenden Bedürfnis nach einem Gegengewicht.
Struktur: Dieses Kapitel analysiert die Struktur des Zweiten Attischen Seebundes. Es untersucht Gründungsdokumente und beleuchtet Institutionen wie das Synhedrion und die finanziellen Abgaben der Bündnismitglieder. Die Zusammensetzung des Bundesheeres und der jeweiligen Schiffskontingente wird detailliert betrachtet. Es wird die Aufnahme von Mitgliedern in den Bund und die damit verbundenen Bedingungen erörtert, um ein umfassendes Verständnis der inneren Organisation und Funktionsweise des Bündnisses zu vermitteln. Das Kapitel differenziert zwischen der politischen Organisation und dem militärischen Aspekt des Bündnisses.
Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Zweiten Attischen Seebundes von seiner Gründung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums. Die verschiedenen Phasen der Entwicklung werden aufgezeigt, wobei der Fokus auf den Bundesgenossenkrieg und dessen Bedeutung für den Bund liegt. Die Debatte über die Natur des Bündnisses (Symmachie oder Arché) wird ebenfalls thematisiert und die unterschiedlichen Perspektiven der Forschung dargestellt. Der Zusammenhalt und die inneren Konflikte innerhalb des Bundes werden in den Kontext der Gesamtentwicklung eingeordnet.
Schlüsselwörter
Zweiter Attischer Seebund, Sparta, Athen, Hegemonialpolitik, Königsfrieden, Symmachie, Arché, Bundesgenossenkrieg, griechische Geschichte, 4. Jahrhundert v. Chr., Bündnisstruktur, Finanzierung, militärische Organisation.
Häufig gestellte Fragen zum Zweiten Attischen Seebund
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend den Zweiten Attischen Seebund im 4. Jahrhundert v. Chr. Sie beleuchtet dessen Entstehung, Struktur und Entwicklung und diskutiert bestehende Forschungsdebatten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Spartas Hegemonialpolitik und deren Einfluss auf die Gründung des Seebundes, die Struktur des Bundes (Institutionen, Finanzen), dessen Entwicklung über verschiedene Phasen (inkl. Bundesgenossenkrieg), die Rolle des Seebundes in der griechischen Politik des 4. Jahrhunderts v. Chr. und die Frage, ob es sich um eine Symmachie oder eine Arché handelte.
Welche Quellen werden verwendet?
Wichtige Quellen sind Xenophon und Diodor. Die Arbeit diskutiert die Stärken und Schwächen dieser Quellen für die Rekonstruktion des Seebundes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil („Vorgeschichte“/Entstehung, Struktur, Entwicklung) und eine Zusammenfassung. Der Hauptteil analysiert die Vorbedingungen zur Gründung, die Struktur des Bundes (Institutionen wie das Synhedrion, finanzielle Abgaben, militärische Organisation) und die Entwicklung des Bundes über verschiedene Phasen bis zum Ende des Beobachtungszeitraums.
Was wird in der „Vorgeschichte“/Entstehung behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet Spartas aggressive Hegemonialpolitik nach dem Peloponnesischen Krieg, den Korinthischen Krieg, die Schlacht von Knidos und den Antalkidas-Frieden als wichtige Wendepunkte, die zur Gründung des Seebundes führten. Es konzentriert sich auf die wachsende Unzufriedenheit mit der spartanischen Herrschaft.
Was wird im Kapitel „Struktur“ analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Struktur des Zweiten Attischen Seebundes, untersucht Gründungsdokumente, beleuchtet Institutionen wie das Synhedrion, die finanziellen Abgaben, die Zusammensetzung des Bundesheeres und der Schiffskontingente, die Aufnahme von Mitgliedern und die Bedingungen dafür. Es differenziert zwischen der politischen Organisation und dem militärischen Aspekt.
Was beschreibt das Kapitel „Entwicklung“?
Das Kapitel beschreibt die Entwicklung des Seebundes von seiner Gründung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums, zeigt verschiedene Entwicklungsphasen auf, konzentriert sich auf den Bundesgenossenkrieg und die Debatte um die Natur des Bündnisses (Symmachie oder Arché).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Zweiter Attischer Seebund, Sparta, Athen, Hegemonialpolitik, Königsfrieden, Symmachie, Arché, Bundesgenossenkrieg, griechische Geschichte, 4. Jahrhundert v. Chr., Bündnisstruktur, Finanzierung, militärische Organisation.
Welche Quellen werden im Text explizit genannt?
Der Text nennt explizit IG II/III2 43 (= StV 257) und Diodor XV, 28, 2-4; 29, 8 als Quellen.
Was ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Bild des Zweiten Attischen Seebundes zu liefern und die bestehenden Forschungsdebatten zu beleuchten.
- Citation du texte
- Matthias Wies (Auteur), 2005, Der Zweite Attische Seebund - Entstehung, Struktur und Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64498