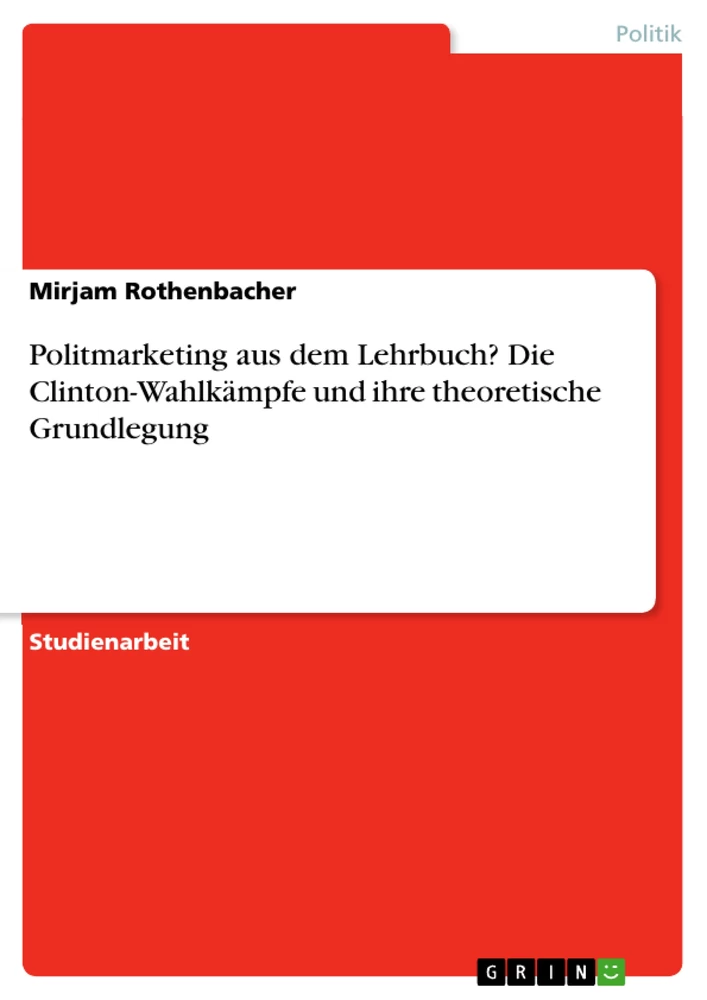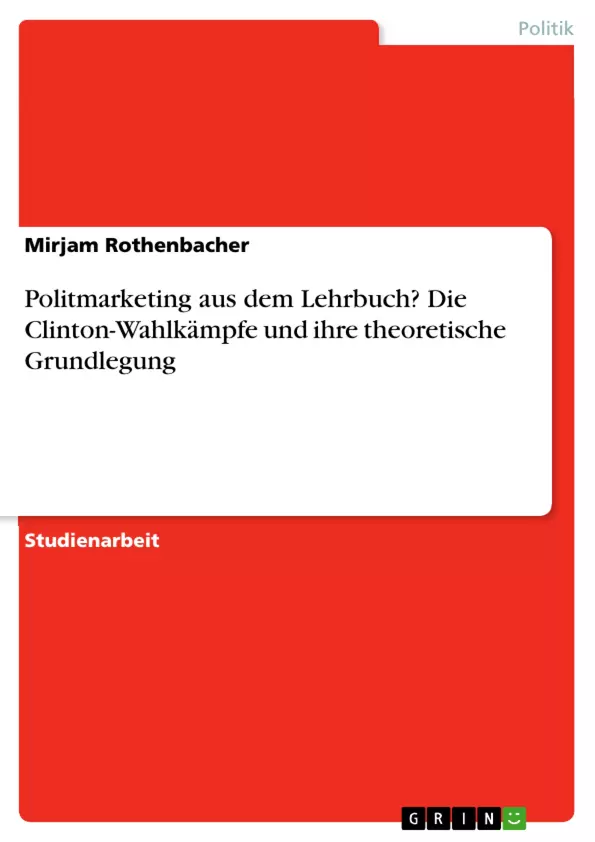„DREAM ON, DEMOCRATS“ titelte die US-Zeitung Newsweek noch Anfang 1992 und hat damit der scheinbaren Utopie treffend Ausdruck verliehen, sich als Demokrat ernsthaft Hoffnung auf einen Wahlsieg des eigenen Kandidaten bei den US-Präsidentschaftswahlen 1992 zu machen. Viel zu stark schien der politische Gegner, der Republikaner George Bush im Sattel zu sitzen. Aber getreu dem Motto „Erstens kommt alles anders, zweitens als man denkt“ wurde Bill Clinton, der Kandidat der demokratischen Partei, entgegen allen Unkenrufen der 42. Präsident der USA. Er hat mit seinem spektakulären Wahlerfolg, den er innerhalb eines knappen halben Jahres möglich machte, bei Politprofis und Marketingstrategen große Anerkennung ausgelöst. Ein demokratischer Herausforderer fügt einem republikanischen, amtierenden Präsidenten eine schmerzliche Niederlage zu - das hat es seit 1932, als Franklin Roosevelt über Herbert Hoover siegte, nicht mehr gegeben. „IN THE PRESIDENTIAL ELECTION of 1992, a president once acclaimed as unbeatable was defeated by a candidate initially declared unelectable.”
Mit diesem Satz kann man wohl die Sensation am Besten beschreiben. Dieser Umstand nötigte die Politologen und Marketingstrategen dazu, das Phänomen Clinton genauer zu betrachten: Wie war dieser unerwartete Sieg zustande gekommen? Wie konnte ein demokratischer Kandidat gegen einen Präsidenten, dessen Popularitätsvorsprung sich nach dem Golfkrieg 1991 in stratosphärischen Höhen bewegte (knapp 91% Zustimmung in der Bevölkerung)4, dermaßen an Boden gewinnen? Unstrittig ist, dass hierbei eine Reihe von Faktoren bemüht/herangezogen werden müssen (z. B. die außenpolitische Lage, die stagnierende Wirtschaft in den USA, nicht eingehaltene Wahlversprechen der Gegner, psychologische Aspekte auf der Wählerseite etc.). Es herrscht allerdings auch Einigkeit darüber, dass die hervorragend funktionierende und professionell geführte Wahlkampfmaschinerie des Clinton-Lagers den Erfolg entscheidend mit beeinflusst hat. Grund genug, sich dessen Wahlkampf näher anzusehen.
Diese Arbeit möchte zum einen die gängige Theorie eines erfolgreichen Politmarketings vorstellen (Soll-Zustand), anschließend sollen die Clinton-Wahlkämpfe 1992 und 1996 überblickartig auf ihre Marketingstrategie hin untersucht werden (Ist-Zustand).
Inhaltsverzeichnis
- „Bill... Wer?“ – Ein No-Name wird Präsident von Amerika.
- Was ist eigentlich Politmarketing?
- Die Rahmenbedingungen in den USA im...
- Wahljahr 1992
- Wahljahr 1996 als Amtsinhaber.
- Hauptmerkmale einer amerikanischen Kampagne am Beispiel der Clinton-Wahlkämpfe:
- Die Geschichte des Campaigning
- Wesentliche Bestandteile der Clinton-Kampagne......
- Negative Campaigning: Der Angriffswahlkampf.
- Die Geschichte des Negative Campaignings
- Die Ausprägungen im Clinton-Wahlkampf 1992
- Die Kampagne 1996.
- Negative Campaigning und die Medien....
- Negative Campaigning: Pro vs. Contra!
- Die Clinton-Wahlkämpfe: Eine gelungene Umsetzung der Theorie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Analyse der Clinton-Wahlkämpfe 1992 und 1996 unter dem Aspekt des Politmarketings. Sie strebt eine Gegenüberstellung von Theorie und Praxis an, um zu untersuchen, inwieweit die theoretischen Grundlegungen des Politmarketings in der Praxis umgesetzt wurden. Dabei wird ein besonderer Fokus auf das Negative Campaigning gelegt.
- Die Entstehung und Entwicklung des Politmarketings
- Die Anwendung von Marketingstrategien in amerikanischen Wahlkämpfen
- Die Rolle des Negative Campaignings in den Clinton-Wahlkämpfen
- Die Effektivität der Marketingstrategien der Clinton-Kampagnen
- Die ethischen und moralischen Implikationen des Negative Campaignings
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet den überraschenden Wahlsieg von Bill Clinton im Jahr 1992 und stellt den Kontext seiner Kampagne dar. Es wird auf die damaligen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in den USA eingegangen und der Kontrast zu den Erwartungen, die vor der Wahl an Clinton geäußert wurden, herausgestellt.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Politmarketing“ und setzt ihn in Relation zum traditionellen Marketing. Es werden die verschiedenen Marketinginstrumente vorgestellt und ihre Anwendbarkeit auf den politischen Kontext diskutiert. Kritische Stimmen zum Einsatz von Marketing in der Politik werden ebenfalls thematisiert.
- Das dritte Kapitel behandelt die spezifischen Rahmenbedingungen der amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 1992 und 1996. Es werden die Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems, die Rolle der Medien sowie die Bedeutung der politischen und gesellschaftlichen Situation beleuchtet.
- Das vierte Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Hauptmerkmale einer amerikanischen Präsidentschaftskampagne, am Beispiel der Clinton-Wahlkämpfe. Es werden die historischen Wurzeln des Campaigning sowie die wesentlichen Bestandteile der Clinton-Kampagnen erläutert.
- Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf das Negative Campaigning. Es werden die Ursprünge dieser Wahlkampfstrategie, ihre Anwendung in den Clinton-Wahlkämpfen sowie ihre ethischen und moralischen Implikationen diskutiert. Die Rolle der Medien im Kontext des Negative Campaignings wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Politmarketings, des Negative Campaignings und den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Die wichtigsten Begriffe sind: Politmarketing, Wahlkampfstrategie, Negative Campaigning, Medienkommunikation, amerikanische Politik, Präsidentschaftswahlen, Clinton-Wahlkämpfe, Wahlkampftaktiken.
Häufig gestellte Fragen
Wie konnte Bill Clinton 1992 die Wahl gewinnen?
Sein Sieg basierte auf einer professionellen Wahlkampfmaschinerie, die Themen wie die stagnierende Wirtschaft ("It’s the economy, stupid!") in den Fokus rückte und modernes Politmarketing nutzte.
Was versteht man unter "Negative Campaigning"?
Dabei handelt es sich um eine Angriffsstrategie, bei der gezielt Schwächen und Fehler des politischen Gegners thematisiert werden, um dessen Glaubwürdigkeit zu untergraben.
Was unterscheidet Politmarketing vom klassischen Marketing?
Politmarketing wendet Marketinginstrumente (Marktforschung, Branding, Kommunikation) auf den politischen Wettbewerb an, wobei der "Kunde" der Wähler und das "Produkt" der Kandidat oder das Programm ist.
Welche Rolle spielten die Medien in Clintons Wahlkämpfen?
Medien dienten als Kanal für die Marketingstrategien und wurden insbesondere für das Negative Campaigning genutzt, um Botschaften schnell und weitreichend zu verbreiten.
War Clintons Strategie eine "Umsetzung aus dem Lehrbuch"?
Die Analyse zeigt, dass Clintons Team theoretische Konzepte des Politmarketings nahezu ideal in die Praxis umsetzte, was den unerwarteten Sieg gegen George Bush ermöglichte.
- Citar trabajo
- Mirjam Rothenbacher (Autor), 2006, Politmarketing aus dem Lehrbuch? Die Clinton-Wahlkämpfe und ihre theoretische Grundlegung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65566