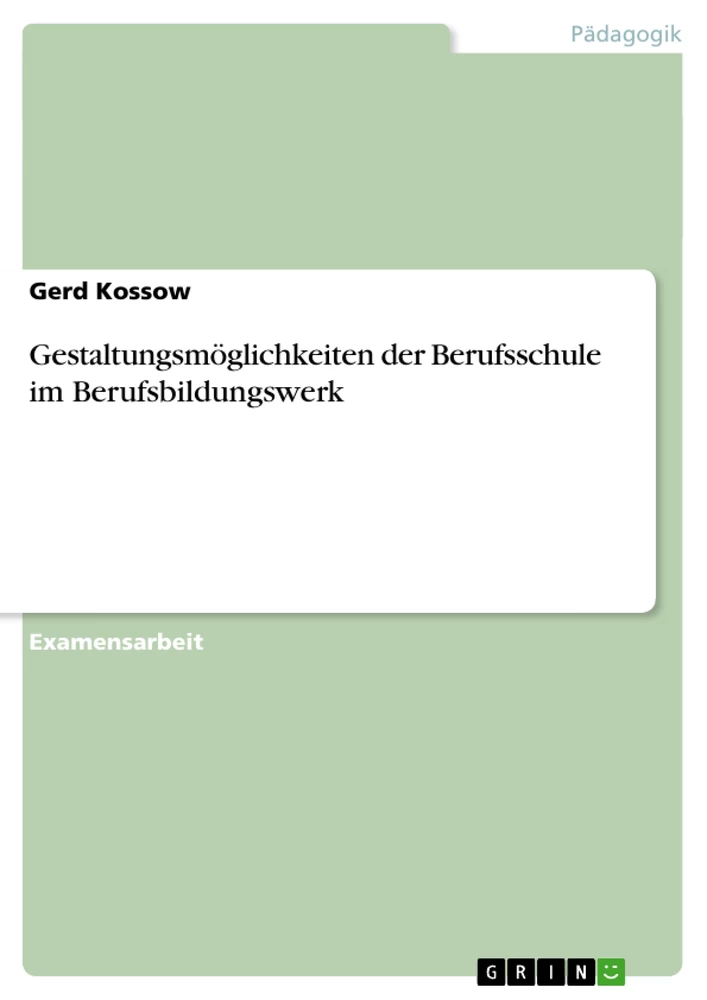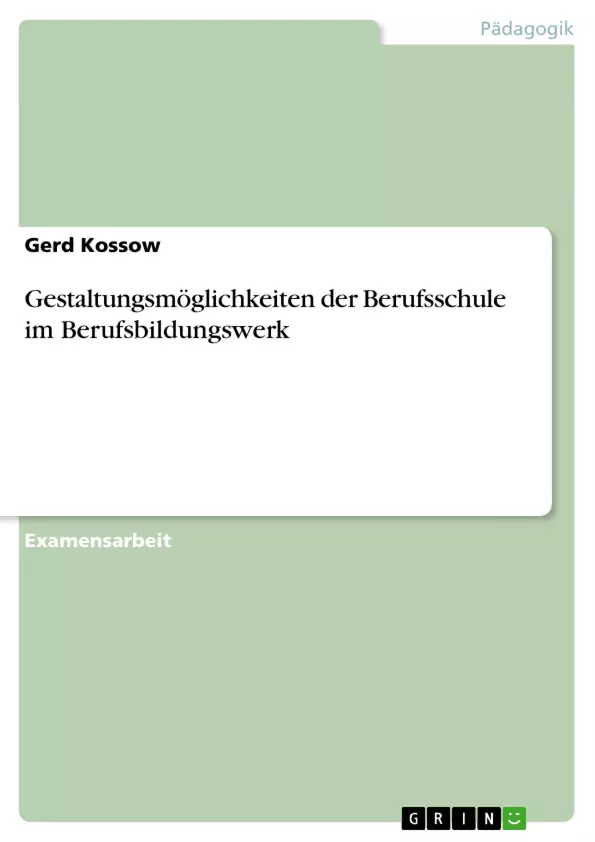Im dualen Berufsausbildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland stellen die
Berufsbildungswerke als Ausbildungsorte für Behinderte und Lernbeeinträchtigte die
Sonderform dar, die wohl am weitestgehendsten versucht, eine institutionelle Verbindung der
Lernorte "Betrieb" und "Schule" zu erreichen. Ähnlich eng dürfte die Verbindung der beiden
Ebenen allenfalls in den wenigen Betrieben mit eigenen Betriebsberufsschulen bzw. bei den
Schulen des Bergbaus sein.
Ihre Begründung fand diese "Sonderform" in dem Bestreben, im Rahmen der
Ausbildungsmöglichkeiten, die seit 1969 eine gesetzliche Regelung im Berufsbildungsgesetz
gefunden hatten, auch für Behinderte qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen und
so zu deren Integration ins Berufsleben beizutragen. Mit Dreisbach kann das 1970 vom
Bundesarbeitsminister Walter Arendt verkündete "Aktionsprogramm zur Förderung der
Rehabilitation von Behinderten" als die inhaltliche Grundlage gesehen werden, aufgrund
derer es zur Planung des Netzes der - zunächst 42, seit dem deutschen Einigungsprozeß 49 -
Berufsbildungswerke kam. Im Zuge dieser Planung wurde im
Hinblick auf die bestmögliche Integrationschance der Betroffenen die Entscheidung
zugunsten einer engen Anbindung der beruflichen Bildung Behinderter an die Regularien des
dualen Systems getroffen. Gleichzeitig wurde betont, daß die dort vorgesehene strikte
Trennung der Lernorte den besonderen Bedürfnissen bei der Ausbildung dieser Zielgruppe
nicht gerecht werden würde und daraus die
"Notwendigkeit eines schulischen Ausbildungsteils in den Berufsbildungswerken"
(Dreisbach, a.a.O.) abgeleitet. Dies brachte von vornherein institutionelle Schwierigkeiten mit
sich. "Der Bund als Koordinator und Initiator mischte sich hier in eine Angelegenheit, die
eine Sache der Länder war und auch später für einzelne Einrichtungen viel Unangenehmes
brachte, da einige Länder die Schulen wie allgemeine Privatschulen behandelten, obwohl sie
von der Aufgabenstellung her anders gelagert waren." Andere Länder
wiederum verzichteten ganz auf die Einheitlichkeit der Träger und gliederten öffentliche
Schulen bzw. Teile öffentlicher Schulen den Berufsbildungswerken an. In allen Fällen gibt es
wesentliche Strukturmerkmale, die die Schulen in und an Berufsbildungswerken1 von den
allgemeinen Berufsschulen unterscheiden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Entstehung und Geschichte der Berufsbildungswerke und der mit ihnen verbundenen Schulen
- 2.1. Die Diskussion über das duale System der Berufsausbildung im Vorfeld des Berufsbildungsgesetzes
- 2.2. Die Thematisierung der beruflichen Integration von Behinderten in den 60er und 70er Jahren
- 2.3. Zur Geschichte der Berufsbildungswerke
- 2.3.1. Die Entstehung der Berufsbildungswerke und die Schaffung einer rechtlichen Grundlage
- 2.3.2. Gemeinsame Charakteristika
- 2.3.3. Die Ausdifferenzierung des Systems in den 70er und 80er Jahren
- 2.3.4. Veränderungen nach der Integration des Bildungssystems der DDR
- 2.3.5. Kritik der Konzepte - alternative Vorstellungen
- 2.4. Zusammenfassung
- 3. Berufsschulen in und an Berufsbildungswerken - ein Schultyp eigener Prägung?
- 3.1. Ausbildung im dualen System in einer Institution - ein Paradox?
- 3.2. Der Stellenwert und das Zusammenspiel einzelner Teilsysteme im Zusammenhang des Berufsbildungswerkes
- 3.3. Die Berufsschule als Teil des Berufsbildungswerkes
- 3.3.1. Trägerschaft, dienstliche und fachliche Aufsicht
- 3.3.2. Die Rolle der Gesamtleitungen und der Träger
- 3.3.3. Kooperation im Berufsbildungswerk
- 3.3.3.1. Kooperation auf der Leitungsebene
- 3.3.3.2. Die Zusammenarbeit bei der Konzeptionsentwicklung
- 3.3.3.3. Die Zusammenarbeit bei der didaktischen Planung
- 3.3.3.4. Die Zusammenarbeit bei der Planung von Erziehungsmaßnahmen im Einzelfall
- 3.3.4. Die Berufsschule in der Sicht der anderen Abteilungen
- 3.3.4.1. Leitungsebene
- 3.3.4.2. Mitarbeiter- / Mitarbeiterinnenebene
- 3.3.5. Die Veränderung der Einbettung und Abgrenzung des Subsystems Berufsschule im Berufsbildungswerk im Entwicklungsprozeß der Berufsbildungswerke
- 3.4. Die Berufsschule im Berufsbildungswerk als Schule - ihre Verankerung im Schulsystem
- 3.4.1. Das "Programm" der Schulen im Berufsbildungswerk - Lehrpläne, Richtlinien und sonstige Arbeitsprogramme
- 3.4.1.1. Die vorläufigen Richtlinien in Nordrhein-Westfalen als Beispiel für institutionalisierte Zielsetzungen der Berufsschulen in Berufsbildungswerken
- 3.4.1.1.1. Das Spannungsfeld zwischen sonderpädagogischer und berufspädagogischer Zielsetzung
- 3.4.1.1.2. Allgemeinbildender und berufsbezogener Bildungsauftrag der Berufsschule im Berufsbildungswerk
- 3.4.1.2. Kenntnisvermittlung im "Lernfeld" Berufsschule und im "Lernfeld" Ausbildungswerkstatt
- 3.4.2. Gewachsene Profile der Schulen
- 3.4.3. Der pädagogische Auftrag der Berufsbildungswerke und die Zielsetzung der Berufsschule vor dessen Hintergrund
- 3.4.3.1. Die Rolle der Berufsausbildung als Zertifizierungsinstrument
- 3.4.4. Zielbestimmungen und Profile der Schulen in den Berufsbildungswerken als Systembedingungen
- 3.5. Die personellen und materiellen Arbeitsbedingungen an den Berufsschulen in Berufsbildungswerken
- 3.5.1. Die äußeren Rahmenbedingungen
- 3.5.1.1. Klassengrößen und Unterrichtsversorgung
- 3.5.1.2. Die räumliche und technische Ausstattung
- 3.5.1.3. Materielle Ressourcen als Systembedingungen
- 3.5.2. Die Lehrkräfte in den Berufsschulen in Berufsbildungswerken
- 3.5.2.1. Der berufliche Hintergrund der Lehrkräfte
- 3.5.2.2. Lehrkräfte an der Berufsschule im Berufsbildungswerk - Berufs- und/oder SonderpädagogInnen?
- 3.5.2.3. Besondere Anforderungen, die an Lehrkräfte in Berufsbildungswerken gestellt werden
- 3.5.3. Kooperation innerhalb der Lehrerkollegien
- 3.5.4. Die Problematik der arbeitsrechtlichen Stellung der Lehrkräfte in Schulen an Berufsbildungswerken
- 3.5.5. Die Arbeitsbedingungen innnerhalb der Berufsbildungswerk - Schulen als Systembedingungen
- 3.6. Berufsschulen in Berufsbildungswerken und allgemeine Berufsschulen - Gemeinsamkeiten und Differenzen
- 3.7. Prüfungen, Abschlüsse und Leistungsnachweise als limitierende und determinierende Faktoren
- 3.8. Zusammenfassung und Bewertung
- 4. Die besonderen Gestaltungsspielräume der Berufsschule in Berufsbildungswerken unter dem Gesichtspunkt ihrer pädagogisch-didaktischen Aufgabe
- 4.1. Pädagogische und zielgruppenbezogene Aufgaben des Unterrichts in der Berufsschule im Berufsbildungswerk
- 4.1.1. Die besondere Lernsituation behinderter und sozial benachteiligter Jugendlicher in der Ausbildung
- 4.1.2. Behinderungsspezifische Besonderheiten in der Zielsetzung des Unterrichts an der Berufsschule im Berufsbildungswerk
- 4.1.3. Zum besonderen Verhältnis berufsbezogener und allgemeinbildender Unterrichtsinhalte an der Berufsschule im Berufsbildungswerk
- 4.2. Didaktische Handlungsspielräume in der Berufsschule im Berufsbildungswerk
- 4.2.1. Zielgruppenspezifische Einflüsse auf die didaktische Planung - die Handlungsziele der Schülerinnen und Schüler
- 4.2.2. Die Bedeutung der Einbindung in die Institution für die didaktische Planung
- 4.2.3. Didaktische Vorteile, die sich aus der Nähe zur Ausbildungswerkstatt ergeben
- 4.3. Zur Methodik des Unterrichts in der Berufsschule im Berufsbildungswerk
- 4.4. Die Bedeutung einzelfallbezogener Förderung
- 4.5. Didaktische Erneuerungen im Berufsbildungswerk
- 4.6. Die Berufsschule im Berufsbildungswerk - ein Schultyp mit eigener didaktischer Prägung?
- 5. Entwicklungsperspektiven der Berufsschulen in Berufsbildungswerken
- 5.1. Funktionale Vor- und Nachteile der Integration der Berufsschulen im Berufsbildungswerk
- 5.1.1. Der Stellenwert der Integration der Schulen in den Berufsbildungswerken in berufspädagogisch-didaktischer Hinsicht
- 5.1.2. Die Bedeutung der Integration der Schulen unter dem Gesichtspunkt eines ganzheitlichen Erziehungsprozesses
- 5.2. Entwicklungsmöglichkeiten der Schulen im Berufsbildungswerk
- 5.2.1. Perspektiven für die Verzahnung des Systems Berufsschule im Gesamtsystem Berufsbildungswerk
- 5.2.2. Perspektiven für das Berufsbild der Lehrkraft an einer Schule im Berufsbildungswerk
- 5.2.3. Duales System im Berufsbildungswerk - seine Bedeutung unter der Perspektive der Handlungsspielräume und der Entwicklungschancen von Schülerinnen und Schülern
- 5.3. Berufsbildungswerke und ihre Berufsschulen - ein Modell für Kooperation im dualen System?
- 5.4. Abschlußüberlegung -Alternative Entwicklungsmöglichkeiten der Berufsausbildung von Behinderten und Benachteiligten
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe eines Berufsbildungswerkes (BBW)?
Ein BBW bietet behinderten und lernbeeinträchtigten Jugendlichen eine qualifizierte Berufsausbildung, um deren Integration in das Arbeitsleben zu fördern.
Wie funktioniert die Verzahnung von Schule und Betrieb im BBW?
Im Gegensatz zum klassischen dualen System sind Lernort Schule und Ausbildungsstätte oft institutionell eng verbunden, was eine bessere Abstimmung auf die Bedürfnisse der Jugendlichen ermöglicht.
Welche Rolle spielen die Lehrkräfte an diesen Schulen?
Lehrkräfte müssen sowohl berufs- als auch sonderpädagogische Kompetenzen mitbringen, um den besonderen Förderbedarf der Schüler gerecht zu werden.
Gibt es Unterschiede zu allgemeinen Berufsschulen?
Ja, die Klassen sind kleiner, die materielle Ausstattung ist oft spezialisierter und der pädagogische Auftrag umfasst eine ganzheitliche Erziehung und Einzelfallförderung.
Was sind die didaktischen Spielräume im BBW?
Die Nähe zur Ausbildungswerkstatt erlaubt praxisnahe Lernfelder und eine methodische Gestaltung, die stärker auf die Handlungsziele der behinderten Jugendlichen eingeht.
- Citar trabajo
- Gerd Kossow (Autor), 1996, Gestaltungsmöglichkeiten der Berufsschule im Berufsbildungswerk, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65623