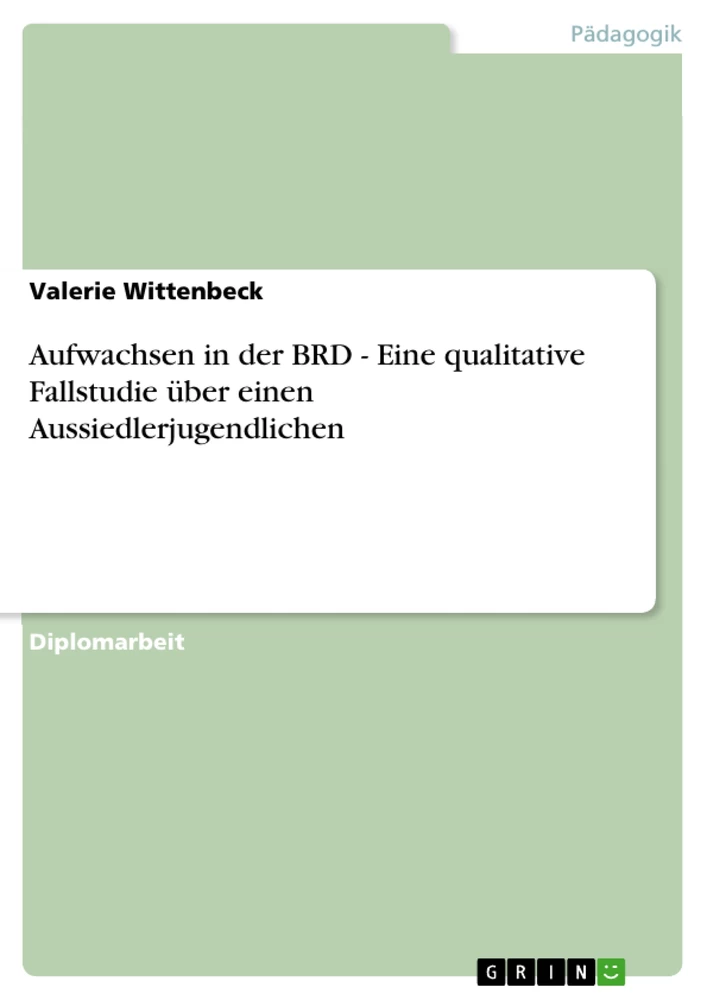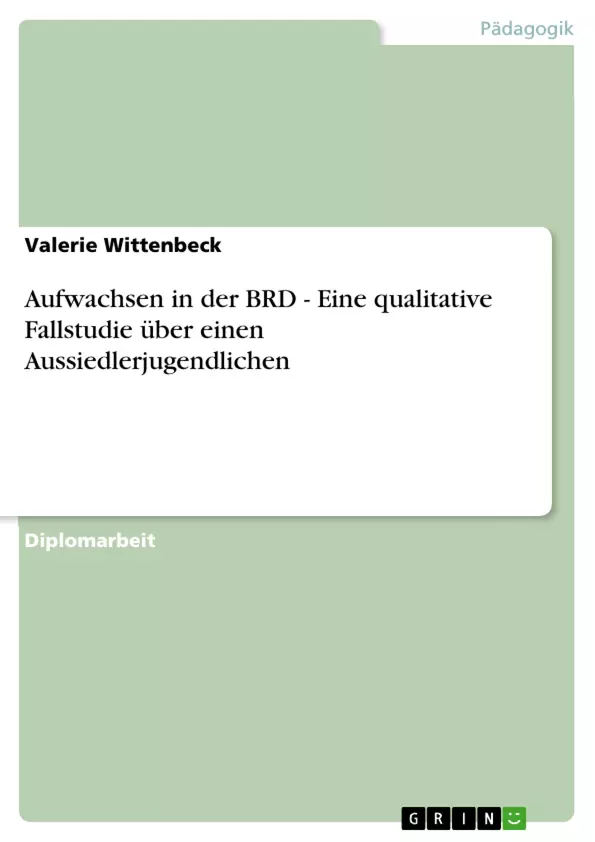Seit 1950 sind über vier Millionen Aussiedler aus den osteuropäischen Ländern in die Bundesrepublik gekommen. Bis Mitte der achtziger Jahre verlief ihre Integration erfolgreich, während in den neunziger Jahren eine Reihe von Entwicklungen und Veränderungen der Eingliederungssituation die Integration bestimmte (vgl. Information zur politischen Bildung 2000, S. 36). Da viele Aussiedler aus Ländern mit Modernisierungsrückständen und traditionellen Verhältnissen stammten und diese nicht aufgeben wollten, wurden sie von der einheimischen Bevölkerung als Fremde wahrgenommen. Mit der Zeit sank die Akzeptanz der Aussiedler in der Gesellschaft. Vorurteile und Unmut ihnen gegenüber breiteten sich immer weiter aus (vgl. Meister/Sander 2000, S. 114).
Auf die steigende Brisanz der fehlenden Integration reagierte die Bundesregierung mit der Einführung des Kriegsfolgebereinigungsgesetzes und der Änderung des Wohnraumgesetzes. Außerdem verpflichtete sich das Bundesverwaltungsamt, jährlich höchstens 220.000 Aussiedler in der Bundesrepublik aufzunehmen (vgl. Blahusch 1992, S. 170). Um dieses Versprechen halten zu können, wurde 1996 ein zusätzlicher Sprachtest im Aufnahmeverfahren integriert, welcher im Herkunftsland von den Vertretern des Bundesverwaltungsamtes durchgeführt wurde und bei Nichtbestehen nicht wiederholt werden konnte.
Auch wenn die Zahl der einreisenden Aussiedler aufgrund der oben beschriebenen Maßnahmen in den letzten Jahren stark zurückging, tauchen viele Aussiedlerjugendliche immer wieder durch negative Schlagzeilen in der Presse auf. Überwiegend handelt es sich um Raubüberfälle, Körperverletzungen sowie starken Drogen- und Alkoholmissbrauch (vgl. taz 2004; vgl. wams 2005).
Wie weit haben sich die Aussiedler in die Gesellschaft, ins deutsche Bildungssystem und die Berufswelt integriert? Halten sich Aussiedlerjugendliche nach einem langjährigen Aufenthalt in Deutschland immer noch für „Fremde“? Stehen diese immer noch unter einem besonderen Assimilationsdruck (vgl. Lingau 2000, S. 11)? Fühlen sich Aussiedlerjugendliche immer noch zwischen zwei Kulturen hin und her gerissen? Und werden sie von der Gesellschaft gezwungen sich für eine der beiden zu entscheiden? Welche Rolle spielen die Eltern und ihre traditionelle Erziehung bei der Integration ihrer Kinder? Um die oben genannten Fragestellungen kritisch zu beleuchten, wird in der folgenden Arbeit der Alltag eines Aussiedlerjugendlichen mit Hilfe wissenschaftlicher Mittel untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aussiedler in der Bundesrepublik
- Rechtliche Stellung der Aussiedler
- Zur Geschichte der Aussiedler
- Ausreisemotive
- Integration jugendlicher Aussiedler aus den ehemaligen GUS-Staaten
- Die Bedeutung der Familie im Integrationskontext
- Die ersten Freundschaften
- Ausbildungs- und Schulsituation
- Die Sprache als Voraussetzung für die Integration
- Die Bedeutung von Wohnumfeld und Wohnverhältnissen für die Integration
- Drogenproblematik
- Das wachsende Konfliktpotential
- Schlussfolgerungen
- Festlegung der Forschungsmethodik
- Qualitative Forschungsmethoden
- Fokussierte Interview
- Das narrative Interview
- Teilnehmende Beobachtung
- Fotografie
- Subjektive Landkarte
- Eigene methodische Vorgehensweise
- Auswahl der Methoden
- Schwierigkeiten während der methodischen Vorgehensweise
- Auswertung der Untersuchungsergebnisse
- Qualitative Forschungsmethoden
- Das gewonnene Material der Fallstudie
- Portrait von Sergej
- Kindheit in der ehemaligen Sowjetunion
- Der familiäre Kontext
- Wirtschaftliche Situation der Familie in der ehemaligen Sowjetunion
- Sergejs Freizeitverhalten in der ehemaligen UdSSR
- Aufwachsen in der Bundesrepublik Deutschland
- Übersiedlung nach Deutschland
- Die Sprachbarriere
- Die Erziehungskontroverse
- Freunde
- Die gewonnene Freizeit
- Beziehungen zum anderen Geschlecht
- Schulische Leistungen
- Suchtproblematik
- Der Umgang mit Gewalt
- Konsumverhalten
- Analyse des gewonnenen Materials
- Ankunft in der Bundesrepublik
- Sergejs Stellung in der Familie
- Entstehung einer neuen Szene
- Ich spreche Deutsch-Ich bin jetzt in Deutschland
- Zukunftsperspektiven
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Integration von Aussiedlerjugendlichen in die Bundesrepublik Deutschland. Ziel der Arbeit ist es, die Erfahrungen eines jugendlichen Aussiedlers anhand einer qualitativen Fallstudie zu beleuchten und die besonderen Herausforderungen und Chancen der Integration in den deutschen Alltag zu analysieren.
- Die Herausforderungen der Integration von Aussiedlerjugendlichen
- Der Einfluss der Familie und des familiären Hintergrunds auf die Integration
- Die Rolle der Sprache und des Bildungssystems in der Integration
- Die Herausbildung einer neuen Identität zwischen zwei Kulturen
- Zukunftsperspektiven und Chancen für die Integration von Aussiedlerjugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Situation von Aussiedlern in Deutschland, beschreibt die Problematik der Integration und die Fragestellungen, die im Zentrum der Untersuchung stehen. Sie gibt einen Überblick über die Forschungsmethodik und die wissenschaftlichen Ansätze, die in der Arbeit verwendet werden.
- Aussiedler in der Bundesrepublik: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die rechtliche Stellung, die Geschichte, die Ausreisemotive und die Integration jugendlicher Aussiedler aus den ehemaligen GUS-Staaten. Es beleuchtet verschiedene Aspekte des Integrationsprozesses, darunter die Rolle der Familie, Freunde, Bildung und Sprache.
- Festlegung der Forschungsmethodik: Dieses Kapitel erläutert die qualitative Forschungsmethodik, die in der vorliegenden Arbeit zum Einsatz kommt, insbesondere das fokussierte Interview, das narrative Interview, die teilnehmende Beobachtung und die Fotografie.
- Das gewonnene Material der Fallstudie: Dieses Kapitel präsentiert das Portrait von Sergej, dem Probanden der Fallstudie. Es beschreibt seine Kindheit in der ehemaligen Sowjetunion und sein Aufwachsen in der Bundesrepublik Deutschland.
- Analyse des gewonnenen Materials: Dieses Kapitel analysiert die Daten der Fallstudie und beleuchtet Themen wie die Ankunft in der Bundesrepublik, Sergejs Stellung in der Familie, die Entstehung einer neuen Szene, die Sprachentwicklung und Zukunftsperspektiven.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Aussiedler, Integration, Jugend, Identität, Kultur, Familie, Bildung, Sprache, Sozialisation, Qualitative Forschung, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Hürden für Aussiedlerjugendliche?
Zentrale Herausforderungen sind Sprachbarrieren, die Identitätsfindung zwischen zwei Kulturen und der Assimilationsdruck in Deutschland.
Welche Forschungsmethode wurde in der Fallstudie genutzt?
Es wurde eine qualitative Methodik angewendet, bestehend aus narrativen Interviews, teilnehmender Beobachtung und subjektiven Landkarten.
Wie beeinflusst die traditionelle Erziehung die Integration?
Die Arbeit zeigt eine „Erziehungskontroverse“ auf, bei der traditionelle Werte der Eltern oft im Konflikt mit dem westlichen Lebensstil der Jugendlichen stehen.
Warum sank die Akzeptanz von Aussiedlern in den 90er Jahren?
Viele Aussiedler wurden aufgrund kultureller Unterschiede als „Fremde“ wahrgenommen, was zu Vorurteilen und Unmut in der einheimischen Bevölkerung führte.
Welche Rolle spielen Drogen- und Gewaltprobleme?
Die Fallstudie untersucht negative Schlagzeilen über Suchtproblematik und Gewalt als mögliche Folgen misslungener Integration und Perspektivlosigkeit.
- Citar trabajo
- Valerie Wittenbeck (Autor), 2005, Aufwachsen in der BRD - Eine qualitative Fallstudie über einen Aussiedlerjugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66081