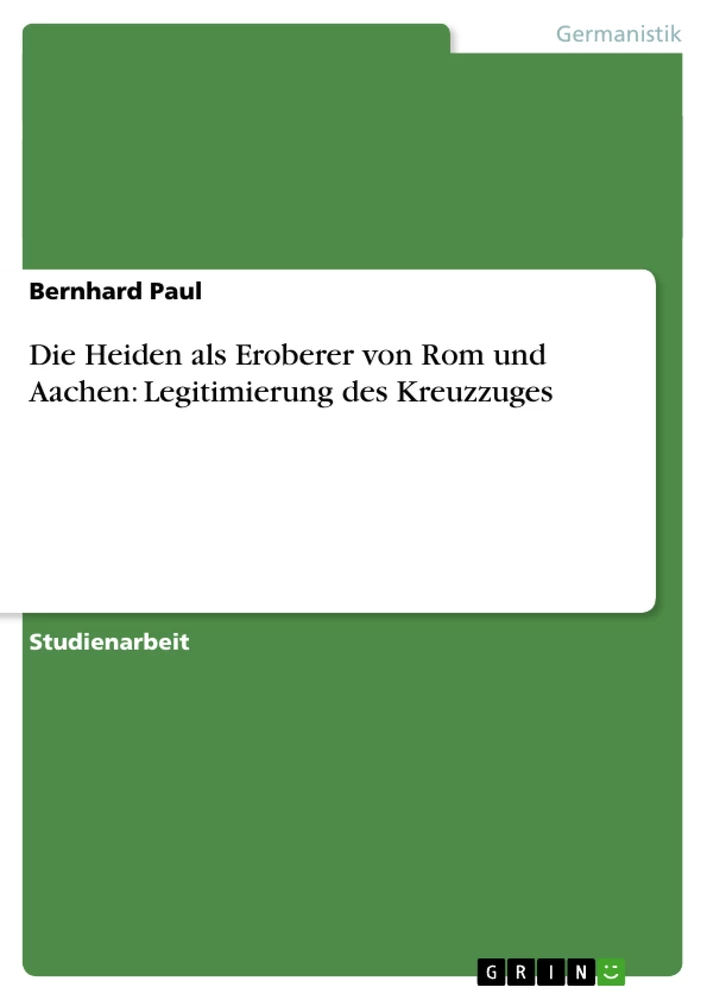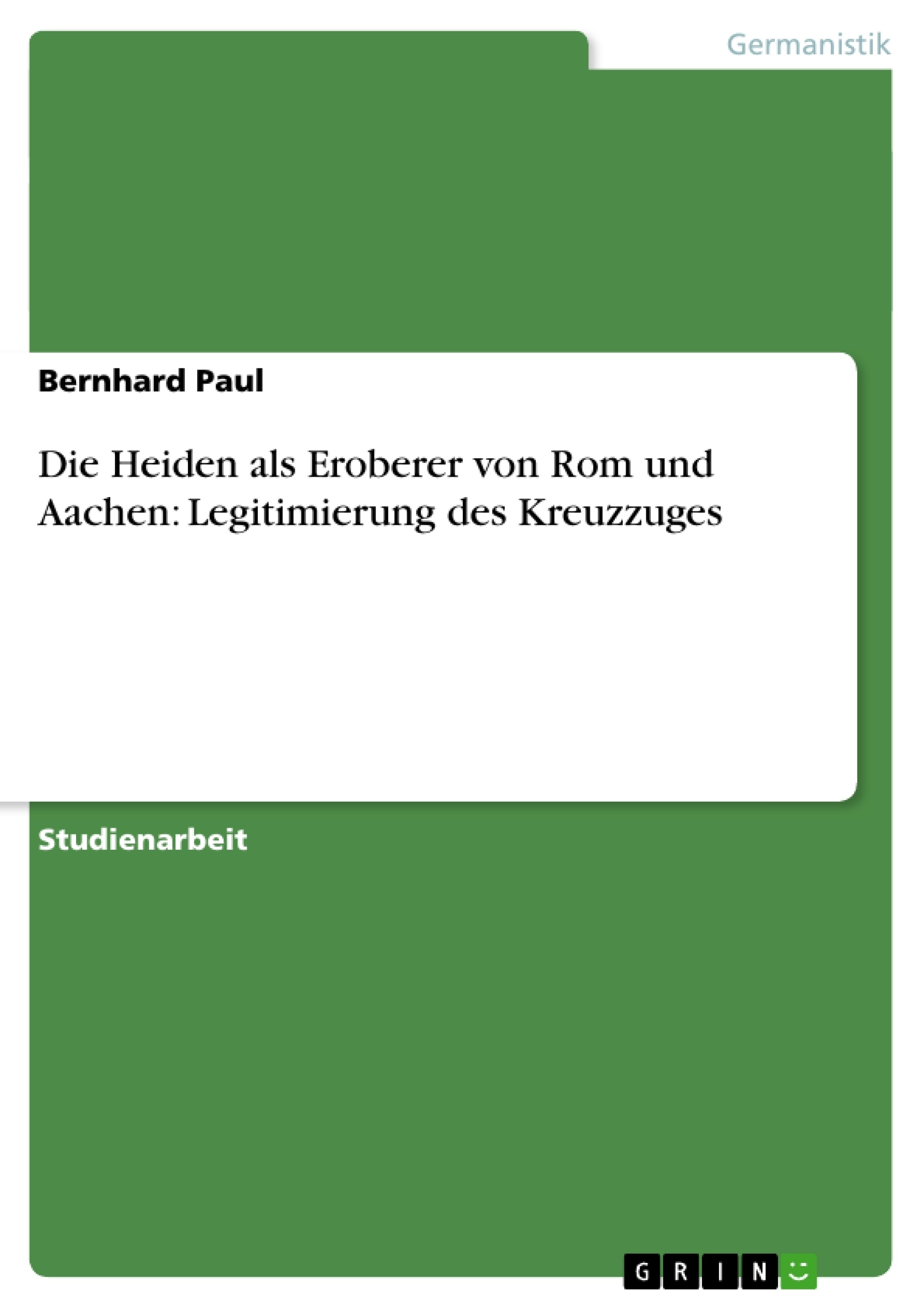„Das Mittelalter war eine finstere Zeit, in der sich alles nur um Religion und Kampf drehte, ohne jede Spur von aufgeklärtem Denken.“ So oder so ähnlich würden die Antworten wohl lauten, würde man eine Umfrage über das Mittelalter durchführen. In der Tat spielte die Religion für die Menschen eine so große Rolle wie in keinem anderen Zeitalter, und der Kampf stand im Mittelpunkt des Ritterlebens. Große religiös motivierte kriegerische Auseinandersetzungen fanden statt: Zwischen 1096 und 1270 kam es zu insgesamt sieben Kreuzzügen. Die heiligen Stätten in Palästina sollten von der Herrschaft der Moslems, der „Ungläubigen“ befreit werden. Bei diesen Unterfangen, die letztlich keine dauerhafte christliche Präsenz im Heiligen Land sichern konnten, wurde für beide Seiten großes Leid angerichtet. Intoleranz gegenüber den Ungetauften, den „Kindern des Teufels“, herrschte gewöhnlich vor. Doch trotz dieses „finsteren“ Eindrucks wurden im Mittelalter zahlreiche Grundlagen der neuzeitlichen Kultur gelegt: So entstand die deutschsprachige Literatur während dieser Zeit und gelangte um 1200 in der mittelhochdeutschen Klassik zu ihrer ersten Blüte. Autoren wie Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg oder Wolfram von Eschenbach verfassten ihre Werke häufig auf Basis altfranzösischer Vorlagen. Ein bedeutendes Thema im Chanson-degeste-Stoff ist der Kampf Karls des Großen und seiner Gefolgsleute bzw. Nachfolger gegen die Moslems in Spanien und Südfrankreich. Diese historischen Ereignisse werden im Nachhinein von den Dichtern als Kreuzzüge gedeutet und bilden das Thema der Kreuzzugsepik. So verhält es sich auch imWillehalm,dem nebenParzivalbedeutendsten Werk Wolframs von Eschenbach. Es steht der religiös motivierte Konflikt zwischen Heiden und Christen im Mittelpunkt. Der Heidenkönig Terramer rückt in das christliche Reich ein (9,1 - 41), um sich dafür zu rächen, dass seine Tochter Arabel - ihr christlicher Name lautet Gyburc - ihren Mann Tybalt und ihre Kinder verlassen hat, zum Christentum übergetreten ist, den Markgrafen Willehalm geheiratet hat und dieser Tybalts Land weggenommen hat (7,27 -8,7 und 9,13 - 20). In einer ersten Schlacht auf Alischanz unterliegen die Christen dem Heidenheer, nur Willehalm bleibt am Leben (13,2 - 57,28). Nachdem Willehalm unterdessen beim Hoftag in Munleun das Reichsheer zu Hilfe geholt hat (126,8 - 202,18), laufen die Ereignisse auf eine erneute Schlacht auf Alischanz zu, in der dann die Christen den Sieg erringen (360,29 - 445,13).
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik und den Kontext vor der zweiten Schlacht
- Die Kriegsziele der Heiden
- Historische und literarische Hintergründe von Terramers Anspruch
- Änderungen gegenüber der Vorlage
- Die historische Gestalt des Pompeius
- Der Kampf Orient - Okzident in der Literatur
- Darstellungen des Kampfes in der Antike
- Darstellungen des Kampfes in mittelalterlichen Dichtungen
- Interpretation der Konfrontation im Willehalm
- Fortsetzung des Rolandsliedes und der Geschichte der Kämpfe Ost - West
- Überlegenheit des Orients und des Heidentums im Willehalm
- Die Bedeutung von Terramers Eroberungszielen
- Legitimierung des Kreuzzugs
- Kreuzzugslegitimität und Schonungsgebot: differenzierte Heidendarstellung
- Die Enterbungsproblematik
- Die Entwicklung des Konflikts
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Heiden im Epos "Willehalm" von Wolfram von Eschenbach. Dabei stehen insbesondere die Eroberungsziele des Heidenkönigs Terramer und die Legitimierung des Kreuzzugs im Mittelpunkt der Analyse.
- Darstellung der Heiden im "Willehalm" und deren Motivationen
- Die Eroberungsziele des Heidenkönigs Terramer
- Die Verbindung des Kreuzzugs zur heidnischen Heeresführung und den religiösen Motiven
- Die literarischen und historischen Bezüge im "Willehalm"
- Die Bedeutung der Heidenthematik im Kontext der mittelalterlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und den Kontext vor der zweiten Schlacht zwischen Christen und Heiden. Anschließend werden die Kriegsziele des Heidenkönigs Terramer beleuchtet und in einen historischen und literarischen Kontext gestellt.
Es wird analysiert, inwiefern sich Wolfram von Eschenbach in seiner Darstellung des Kampfes zwischen Orient und Okzident von seinen Vorlagen unterscheidet. In weiterer Folge wird die Konfrontation im "Willehalm" interpretiert und die Bedeutung von Terramers Eroberungszielen herausgearbeitet.
Abschließend wird die Legitimierung des Kreuzzugs im "Willehalm" untersucht und diskutiert, wie die Heidenthematik in dieser Hinsicht eine differenzierte Darstellung erhält.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf folgende Themen und Konzepte: Heidentum, Kreuzzug, "Willehalm", Wolfram von Eschenbach, Terramer, Eroberungsziele, Legitimierung, Orient, Okzident, mittelalterliche Literatur, Historische und literarische Bezüge.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist die Figur Terramer im Epos „Willehalm“?
Terramer ist der Heidenkönig, der in das christliche Reich einfällt, um Rache für seine Tochter Gyburc zu nehmen und seinen Machtanspruch über Rom und Aachen geltend zu machen.
Wie wird der Kreuzzug im „Willehalm“ legitimiert?
Die Arbeit analysiert die religiösen und rechtlichen Begründungen für den Kampf der Christen gegen die Heiden, beleuchtet aber auch Wolframs differenzierte Darstellung der „Ungläubigen“.
Welche Rolle spielt die historische Gestalt des Pompeius?
Die Arbeit untersucht die literarischen Bezüge zur Antike, wobei Terramer seinen Anspruch auf europäische Gebiete historisch über die Nachfolge des Pompeius zu begründen versucht.
Was unterscheidet Wolframs „Willehalm“ von seinen französischen Vorlagen?
Wolfram von Eschenbach weicht in der Charakterisierung der Heiden und der Darstellung des Konflikts von den Chansons de geste ab, indem er ethische Fragen wie das „Schonungsgebot“ stärker betont.
Was ist die „Enterbungsproblematik“ im Werk?
Es geht um den rechtlichen und familiären Konflikt, der durch Gyburcs Übertritt zum Christentum und ihre Heirat mit Willehalm entstand, was Terramer als Raub und Enterbung ansieht.
Wie wird das Verhältnis zwischen Orient und Okzident dargestellt?
Das Epos thematisiert die Konfrontation zweier Weltmächte und Kulturen, wobei Wolfram dem Orient eine gewisse materielle und kulturelle Überlegenheit zuschreibt.
- Citation du texte
- Bernhard Paul (Auteur), 2004, Die Heiden als Eroberer von Rom und Aachen: Legitimierung des Kreuzzuges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66629