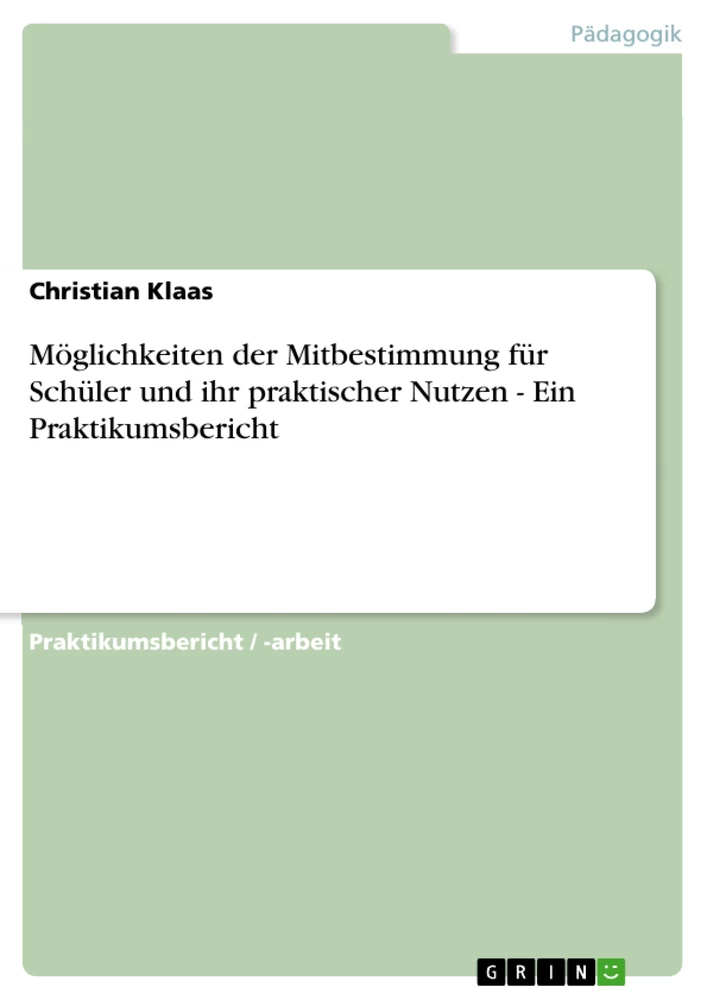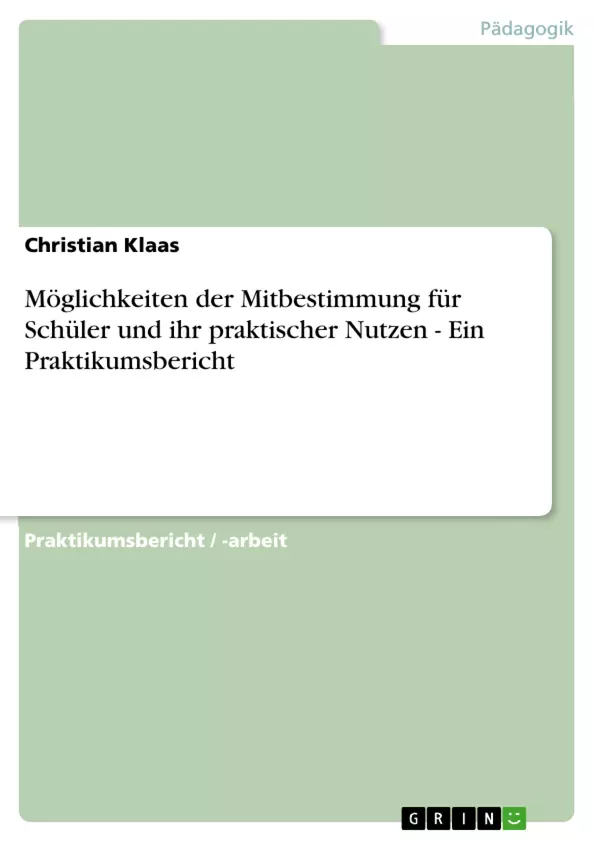Es wäre nun ein leichtes, schlichtweg allgemeine Aussagen aus dem Schulprogramm meiner Praktikumsschule, zu übernehmen, doch möchte ich bewusst auf solch unreflektierte Informationen verzichten und stattdessen einen kurzen Überblick geben, der aus meinen eigenen Beobachtungen resultiert. Die Schule ist zentral gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen, da sich eine Haltestelle für diverse Straßenbahnen und Stadtbusse direkt vor der Schule befindet und der städtische Knotenpunkt auch nur wenige 100m entfernt liegt. Daher ist es gewährleistet, dass nicht nur Kinder aus dem unmittelbaren Umfeld, sondern mehr oder minder aus der ganzen Stadt, das Gymnasium besuchen können. Nichtsdestotrotz kommt es m. E. an der Schule hinsichtlich der Schüler zu einem gewissen Ausleseprozess, da sie als altsprachliches Gymnasium Latein verbindlich als erste Fremdsprache anbietet und somit bestimmte Vorgaben gemacht sind, welche die Eltern bei der Auswahl der Schule berücksichtigen müssen. Sowohl meinen eigenen Eindrücken zu Folge, als auch nach Rücksprache mit diversen Lehrern, kann man wohl festhalten, dass die Schule dadurch in Bezug auf so genannte „Problemfälle“ oder „Geradenoch-Gymnasiasten“ begünstigt wird und hier außerdem überdurchschnittlich viele Kinder aus der Oberschicht zu finden sind.
Somit kämen wir auch schon zum nächsten Punkt, der interessanten Sprachenfolge. Wie bereits erwähnt beginnt man in der 5. Klasse mit Latein und neuerdings dann bereits ein Jahr später in der 6. Klasse mit Englisch (ursprünglich erst in der 7. Klasse). Um einen weichen Übergang zu gewährleisten, wird Englisch im ersten Jahr jedoch noch als Nebenfach (3 Stunden, 4 Arbeiten) betrachtet und besonders spielbetont bzw. man könnte auch sagen kindgerecht, wie ich selbst feststellen konnte, unterrichtet. Erst im 7. Schuljahr erlangt das Fach Englisch Hauptfachstatus (4 Stunden, 6 Arbeiten). In der 9. Klasse kann dann zwischen Altgriechisch oder Französisch als dritter Fremdsprache bzw. Informatik, für nicht so Sprachbegeisterte, gewählt werden. Damit nicht genug, besteht ab dem 10. Schuljahr die Möglichkeit Französisch, Italienisch oder Hebräisch, als eventuell vierte Fremdsprache in einer Arbeitsgemeinschaft zu erlernen. Ein Paradies für den Sprachbegeisterten, sozusagen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulbeschreibung
- Tabellarischer Praktikumsverlauf
- Die erste Praktikumswoche - Orientierungswoche
- Die zweite Praktikumswoche - Hospitationswoche
- Die dritte Praktikumswoche - Erste Unterrichtswoche
- Die vierte Praktikumswoche - Erste eigene Klassenarbeit
- Die fünfte Praktikumswoche - Abschiedswoche
- Hospitation - Beobachtungen und Eindrücke
- Beobachtung einiger Lehrer im Überblick
- Resümierende Aussagen
- Hospitation im Sportunterricht – Eine Gegenüberstellung
- Eigene Unterrichtsversuche
- Unterrichtsversuch im Fach Mathematik
- Unterrichtsversuch im Fach Sport
- Schwerpunktthema: Möglichkeiten der Mitbestimmung für Schüler und ihr praktischer Nutzen
- Die SV-Stunde - Ein guter Ansatz mit Problemen
- Schülermitbestimmung bei der Themenauswahl fürs Schuljahr
- Schülereinfluss auf den Unterricht über Feedbackrunden
- Résumé
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Praktikumsbericht analysiert die Möglichkeiten der Schülermitbestimmung an einer altsprachlichen Schule und untersucht den praktischen Nutzen dieser Mitbestimmung. Dabei wird der Fokus auf die Erfahrungen des Praktikanten während seiner Zeit an der Praktikumsschule gelegt, um die verschiedenen Aspekte der Schülerbeteiligung aus einer praxisnahen Perspektive zu beleuchten.
- Möglichkeiten der Schülermitbestimmung an der Praktikumsschule
- Praktischer Nutzen der Schülermitbestimmung für den Schulalltag
- Analyse der SV-Stunde und ihrer Herausforderungen
- Einfluss der Schüler auf die Themenauswahl und den Unterricht
- Bewertung der Wirksamkeit von Feedbackrunden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in das Thema des Praktikumsberichts ein und stellt die grundlegende Fragestellung nach den Möglichkeiten der Schülermitbestimmung und deren praktischer Bedeutung dar.
- Schulbeschreibung: In diesem Kapitel wird ein detaillierter Einblick in die Praktikumsschule gegeben. Der Autor beschreibt die Besonderheiten der Schule, ihre räumliche Lage und ihre Ausstattung, sowie das pädagogische Konzept und die spezifischen Lehrpläne.
- Hospitation - Beobachtungen und Eindrücke: Der Praktikant präsentiert seine Beobachtungen und Eindrücke während der Hospitation in verschiedenen Unterrichtsfächern. Er analysiert die Unterrichtsmethoden und die Interaktion zwischen Lehrern und Schülern.
- Eigene Unterrichtsversuche: Hier beschreibt der Praktikant seine eigenen Unterrichtserfahrungen in Mathematik und Sport. Er reflektiert seine Methoden und Ergebnisse sowie die Herausforderungen, die sich während des Unterrichts gestellt haben.
- Schwerpunktthema: Möglichkeiten der Mitbestimmung für Schüler und ihr praktischer Nutzen: In diesem Kapitel untersucht der Praktikant die konkreten Möglichkeiten der Schülermitbestimmung an der Schule. Er analysiert die Wirksamkeit der Schülervertretung (SV), die Einflussmöglichkeiten der Schüler bei der Themenauswahl und die Bedeutung von Feedbackrunden im Unterricht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen des Praktikumsberichts sind: Schülermitbestimmung, Schulalltag, Praktikumsschule, altsprachliches Gymnasium, SV-Stunde, Feedbackrunden, Unterrichtsqualität, Lehrer-Schüler-Interaktion, pädagogisches Konzept, praktische Erfahrungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Möglichkeiten der Schülermitbestimmung gibt es?
Zu den Möglichkeiten zählen die SV-Stunde (Schülervertretung), Mitsprache bei der Themenauswahl für das Schuljahr und Feedbackrunden zum Unterricht.
Was ist der praktische Nutzen von Mitbestimmung für Schüler?
Sie fördert die Motivation, verbessert das Lehrer-Schüler-Verhältnis und ermöglicht eine kindgerechtere Gestaltung des Lernalltags.
Warum ist die SV-Stunde oft problematisch?
Die Analyse zeigt, dass trotz guter Ansätze oft organisatorische Probleme oder mangelndes Interesse die effektive Mitbestimmung in der SV-Stunde erschweren.
Wie beeinflussen Feedbackrunden die Unterrichtsqualität?
Feedbackrunden geben Lehrkräften direkte Rückmeldung über die Wirksamkeit ihrer Methoden und ermöglichen Anpassungen an die Bedürfnisse der Klasse.
Welche Besonderheit hat die Praktikumsschule bei den Sprachen?
Es handelt sich um ein altsprachliches Gymnasium, an dem Latein verbindlich ab der 5. Klasse unterrichtet wird, gefolgt von Englisch in der 6. Klasse.
- Quote paper
- Christian Klaas (Author), 2003, Möglichkeiten der Mitbestimmung für Schüler und ihr praktischer Nutzen - Ein Praktikumsbericht , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66759