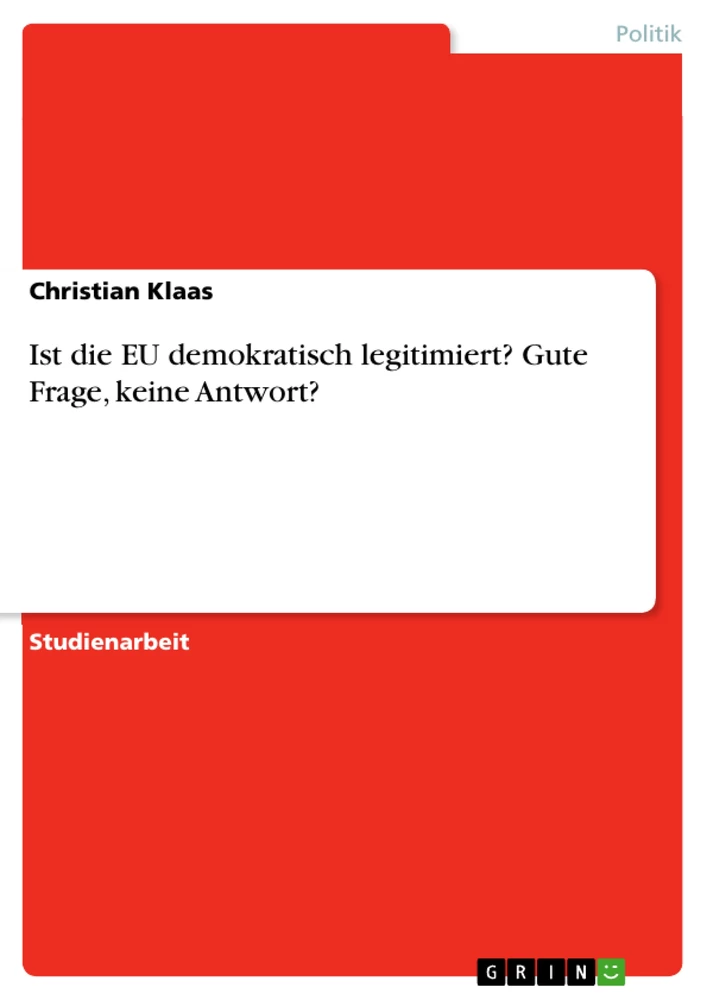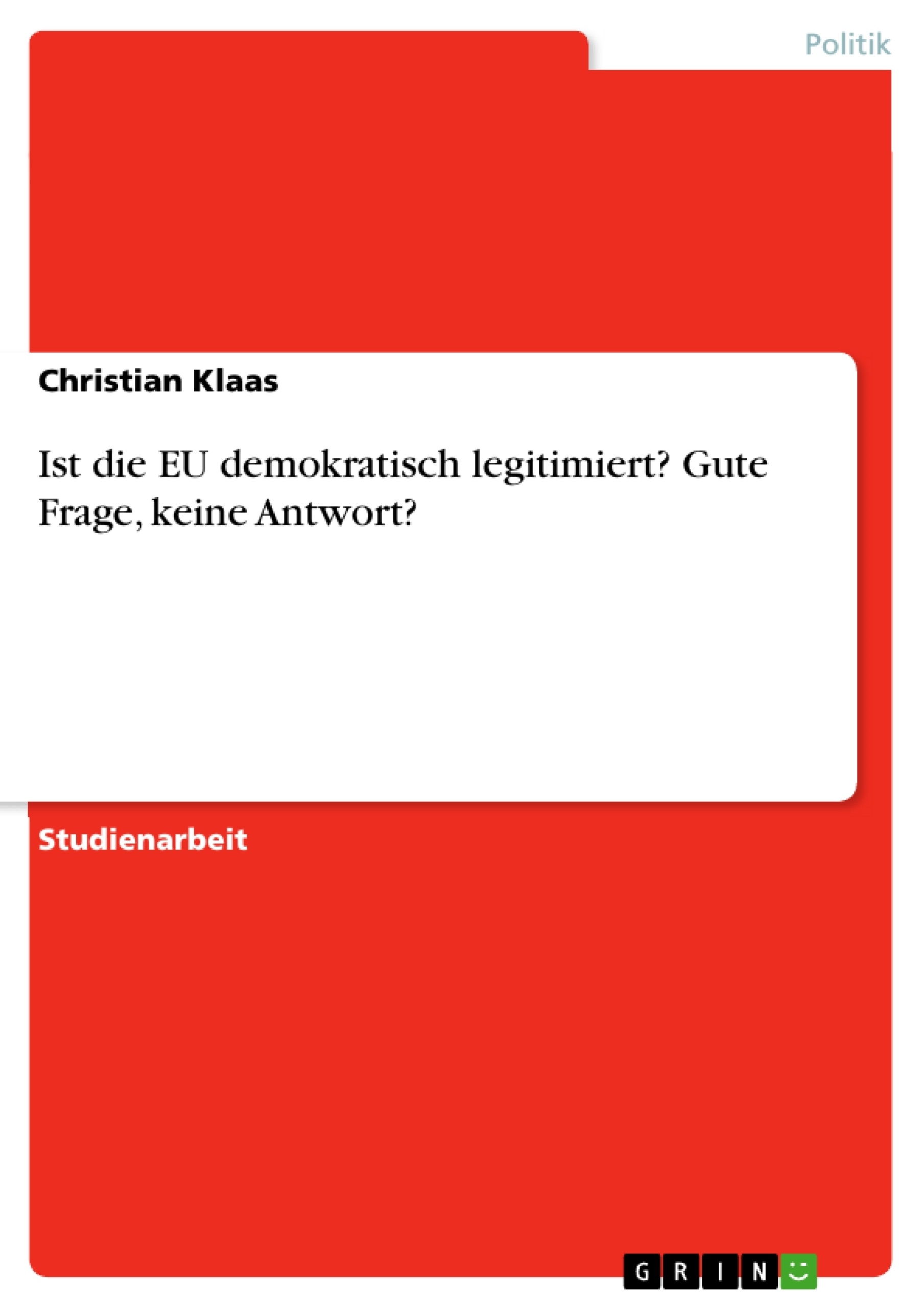Mit der Entstehung vielfältiger internationaler Organisationen wie z.B. der UNO oder der WTO hat sich der Horizont der Politischen Theorie zunehmend verschoben bzw. erweitert. Untersuchungen und Überlegungen wie Regieren jenseits des Nationalstaats demokratisch legitimiert werden kann, rücken immer mehr in den Fokus. Besondere Aufmerksamkeit wird hier vor allem der Europäischen Union (EU) zuteil, dem bisher ehrgeizigsten Projekt Souveränität unter dem Dach einer internationalen Institution zu bündeln (vgl. Moravcsik 2004: 337). Ursprünglich vor dem Hintergrund einer immanenten Friedensidee gegründet, entwickelte sich in der Folgezeit für die heutige EU immer mehr das Motiv der Wohlstandmehrung zur Triebfeder weiterer Integration und Erweiterung. Da die Staaten sich im Laufe der Zeit alle auf die eine oder andere Weise zu Wohlfahrts- und Sozialstaaten entwickelt hatten, sie alleine jedoch unter den Bedingungen einer wirtschaftlichen Globalisierung nicht mehr in der Lage waren, die an sie herangetragenen Erwartungen bzw. materiellen Aufgaben zu erfüllen, gaben die Nationalstaaten schrittweise Teile ihrer Souveränität an die EU ab, um auf diese Weise ihre Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen (vgl. Beck & Grande 2004: 123f). Die so genannte „negative Integration“, die Politik der Marktöffnung und Wettbewerbsgleichheit umfasst, war und ist daher sehr erfolgreich, während die marktkorrigierende oder marktergänzende „positive Integration“ dagegen in der Regel nur im Schneckentempo voran kam, sofern sie überhaupt von der Stelle kam. Besonders schwer tat sich die EU bislang auch in der Außenpolitik, weil in diesem Feld besonders weit auseinander strebende Interessen der Mitgliedsstaaten einer gemeinsamen Politik in die Quere kommen (vgl. Schmidt 2000: 425). Kurzum, die wirtschaftliche und rechtliche Integration in der EU sind weit vorangeschritten, während die politische Integration mit großem Abstand hinterher hinkt. Das hat, wie wir später sehen werden, Konsequenzen für die Legitimitätsdebatte um die EU. Umso weiter die Integration insgesamt fortgeschritten ist, desto komplexer und unübersichtlicher wurde die EU für ihre Bürger.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Legitimität, Legitimationsbedarf, Legitimationsfaktoren
- Input-Legitimität
- Output-Legitimität
- Legitimationsfaktoren
- Input-bezogene Legitimationsfaktoren
- Output-bezogene Legitimationsfaktoren
- Die gängige Demokratiedefizit-Argumentation
- Die Argumente der Demokratiethese
- Die Gegenargumente - ein endloses Demokratiedefizit
- Europäische Identität im Fokus
- Weg vom Staatsverständnis - Quo vadis Europa?
- Demokratische Legitimierung der EU – falsche Maßstäbe
- Demokratische Legitimierung der EU – ein neuer Versuch
- Auswirkungen der EU auf die Legitimität der Nationalstaaten
- Exekutivlastigkeit der EU
- Beschränkung der nationalen Problemlösungsfähigkeit durch die EU
- Lösungsvorschläge und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage der demokratischen Legitimität der Europäischen Union (EU). Sie untersucht die gängige Demokratiedefizit-Argumentation und analysiert, ob die EU tatsächlich an einem Demokratiedefizit leidet, oder ob die Kritik auf falschen Maßstäben und Voraussetzungen beruht. Die Arbeit beleuchtet auch die Auswirkungen der EU auf die Legitimität der Nationalstaaten und stellt Lösungsvorschläge zur Behebung der Probleme vor.
- Legitimität der EU
- Demokratiedefizit
- Input- und Output-Legitimität
- Europäische Identität
- Auswirkungen der EU auf die Legitimität der Nationalstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik der demokratischen Legitimität von internationalen Organisationen, insbesondere der EU, ein. Sie beleuchtet die Entwicklung der EU und die wachsende Bedeutung der Frage nach ihrer Legitimität im Kontext von Integration und Erweiterung.
- Legitimität, Legitimationsbedarf, Legitimationsfaktoren: Dieses Kapitel behandelt die unterschiedlichen Konzeptionen von Legitimität und definiert zentrale Begriffe wie Legitimitätsargumente, Legitimationsbedarf und Legitimationsfaktoren. Es wird die Unterscheidung in input- und output-Legitimität als Grundlage für die spätere Analyse der EU-Legitimität eingeführt.
- Die gängige Demokratiedefizit-Argumentation: Das Kapitel stellt die typischen Argumente der Demokratiethese, die von der ausreichenden demokratischen Legitimität der EU ausgeht, den Argumenten der These des strukturellen Demokratiedefizits gegenüber. Es werden die verschiedenen Argumente beider Positionen beleuchtet und erste Schlussfolgerungen hinsichtlich der Legitimität der EU gezogen.
- Weg vom Staatsverständnis - Quo vadis Europa?: Dieses Kapitel hinterfragt die Gültigkeit der gängigen Maßstäbe zur Bewertung der Legitimität der EU. Es argumentiert, dass die Anwendung von Konzepten des Nationalstaats zur Beurteilung der EU zu falschen Schlussfolgerungen führt und stellt die Frage nach der Legitimität der EU neu.
- Auswirkungen der EU auf die Legitimität der Nationalstaaten: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der EU auf die Legitimität der Nationalstaaten. Es werden die Probleme der Exekutivlastigkeit der EU und der Beschränkung der nationalen Problemlösungsfähigkeit durch die EU beleuchtet. Abschließend werden Lösungsvorschläge vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie demokratische Legitimität, Demokratiedefizit, Input- und Output-Legitimität, Europäische Identität und den Auswirkungen der EU auf die Legitimität der Nationalstaaten. Dabei werden wichtige Konzepte wie das Pareto-Kriterium und die Unterscheidung in prozedurale/institutionelle und substantielle Legitimität behandelt. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise der EU und ihre Legitimationsgrundlagen im Kontext der Integration und Erweiterung sowie der zunehmenden Komplexität der europäischen Institutionen.
Häufig gestellte Fragen
Leidet die Europäische Union an einem Demokratiedefizit?
Die Arbeit untersucht die gängige Argumentation, wonach die EU aufgrund ihrer komplexen Strukturen und der Distanz zum Bürger nicht ausreichend demokratisch legitimiert sei.
Was ist der Unterschied zwischen Input- und Output-Legitimität?
Input-Legitimität speist sich aus der Beteiligung der Bürger (Wahlen). Output-Legitimität entsteht durch die Wirksamkeit und den Nutzen der politischen Ergebnisse (Wohlstand, Sicherheit).
Warum ist eine europäische Identität für die Legitimität wichtig?
Ein gemeinsames Identitätsgefühl gilt oft als Voraussetzung für ein funktionierendes demokratisches System, da es die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen über Grenzen hinweg erhöht.
Wie beeinflusst die EU die Legitimität der Nationalstaaten?
Durch die Abgabe von Souveränität an die EU verlieren Nationalstaaten Teile ihrer Handlungsfähigkeit, was ihre eigene demokratische Legitimität gegenüber den Bürgern schwächen kann.
Was bedeutet „Exekutivlastigkeit“ der EU?
Es beschreibt das Problem, dass Entscheidungen in der EU primär durch Regierungen und Beamte (Exekutive) und weniger durch direkt gewählte Parlamente (Legislative) getroffen werden.
- Quote paper
- Christian Klaas (Author), 2006, Ist die EU demokratisch legitimiert? Gute Frage, keine Antwort?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66761