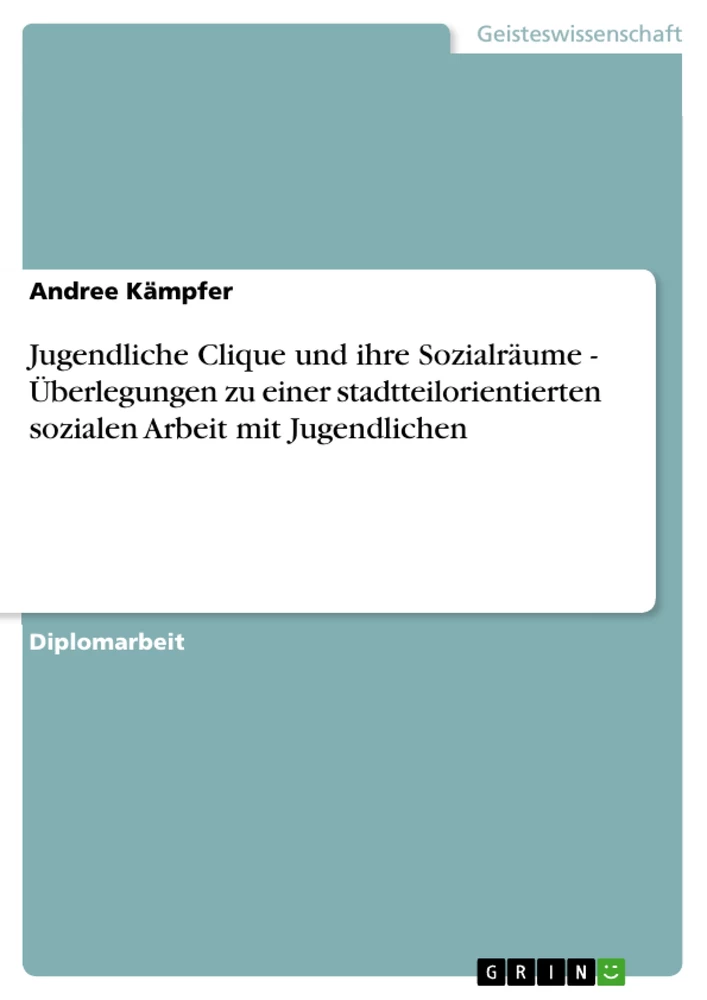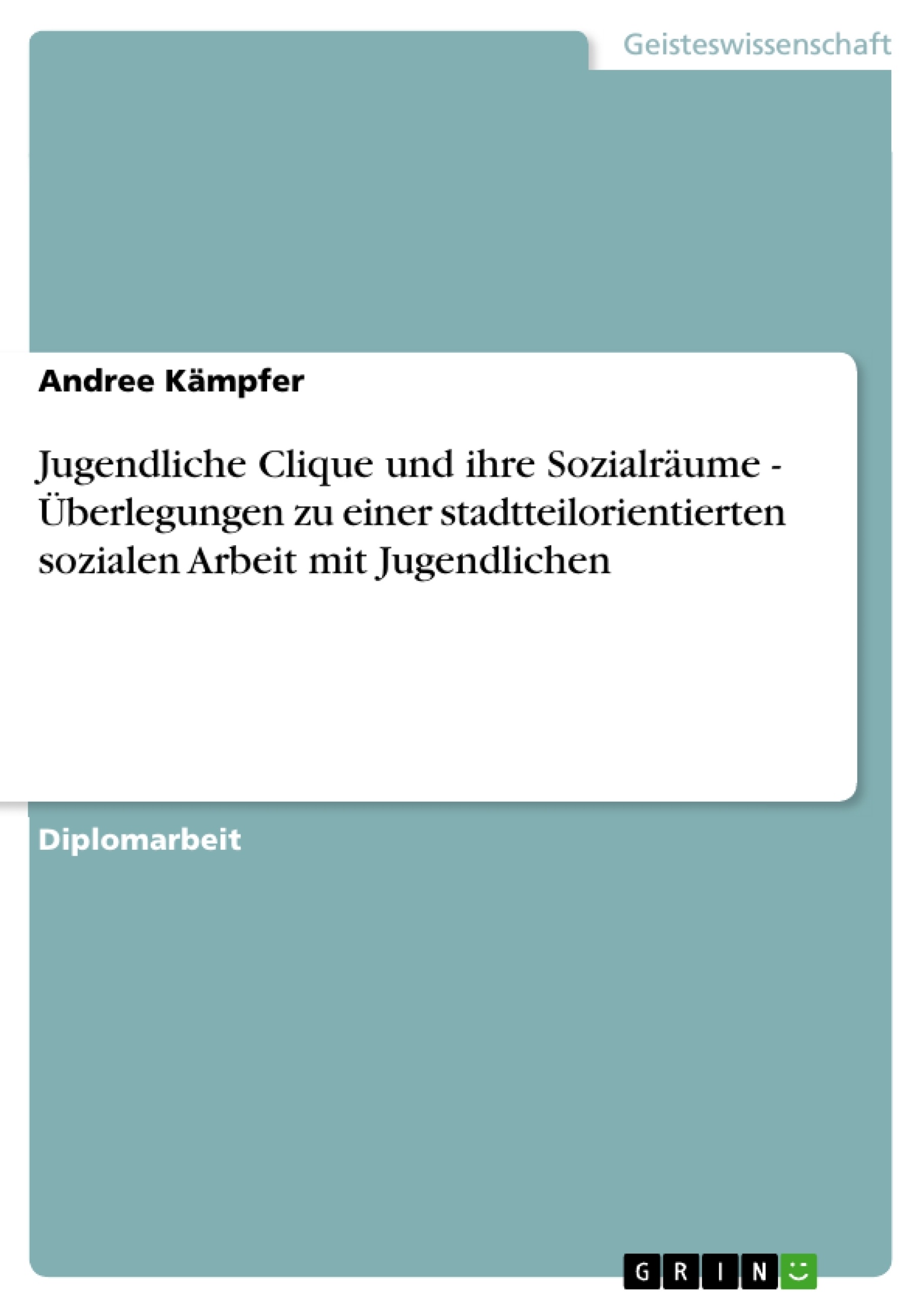Was ist „Jugend“ heute? Was bedeutet es, in der heutigen modernen Gesellschaft „Jugendlicher“ zu sein? Wie leben Jugendliche heute angesichts des gesellschaftlichen Wandels und wie sieht dieser aus? Wie organisieren diese ihr Leben bzw. „Überleben“? Welche Strategien werden dabei angewandt? So kontrovers die Auseinandersetzung mit der Situation und der Zukunft der Jugend zurzeit geführt wird, so unterschiedlich ist scheinbar auch die öffentliche Meinung über diese. Sie hat (und hatte) viele Gesichter: von „Rumgammlern“, der „Null-Bock-No-Future-Generation“ in den frühen 1980ern, der „Problemjugendlichen“ bis hin zum positiven Bild des „Zukunftsträgers“. Die Jugendforschung erkannte in den letzten 20 Jahren Jugend(sub)kulturen und Cliquen als Feld vielfältiger Ausdrucks- und Bewältigungsformen von Jugendlichen für sich. Es ergeben sich aber nach wie vor Fragen, vielleicht sogar mehr denn je. Denn, welche Bedeutung kann man Jugend(sub)kulturen heute beimessen? Welche Differenzierungen sind zu beachten?
So erfährt auch das alltägliche Leben der Jugendlichen im Stadtteil und der Sozialraumbegriff zunehmende Beachtung. Was bedeuten Räume für unterschiedliche jugendliche Cliquen (bzw. für den Jugendlichen als Teil der Clique)? Wie und warum eignen sich Jugendliche diese an? Auf welche Probleme stoßen sie dabei? Wie entsteht Sozialraum?
Aus Sicht einer sozialraumorientierten Jugendarbeit stellt sich somit in der Auseinandersetzung mit dem Thema die Frage, welche Ziele dieser Ansatz sich setzen sollte, wie diese zu realisieren sein könnten, und was dabei zu beachten ist. Eine weitere Frage, die gerade in der aktuellen Debatte oft gestellt wird: befindet sich die Jugendarbeit wirklich „in einer Krise“ oder bietet ein sozialräumlicher Ansatz wichtige Impulse? Und: können oder müssen sozialräumliche Ansätze im Sinne einer Erweiterung des Aufgabenbereichs der Jugendarbeit mit Ansätzen stadtteilorientierter Sozialarbeit kombiniert werden?
Somit auch: welche Anhaltspunkte für diese „gemeinsame Zukunft“ sind in der aktuellen Literatur bisher erarbeitet? Wie kann sich Stadtteilorientierung in einer sozialräumlichen Jugendarbeit ausdrücken?
Diese Diplomarbeit geht den Fragen nach, inwieweit die jugendliche Clique, Jugend(sub)kulturen und deren Raumverhalten Eingang in die soziale Arbeit mit Jugendlichen im Stadtteil gefunden haben, welche Bedeutung dem Sozialraumbegriff zukommt, und was der Stadtteil als Gefüge von Sozialräumen für diese Jugendlichen bedeutet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Grundlagen.
- 2.1 Jugend heute......
- 2.1.1 Was ist los mit der Jugend?.....
- 2.1.2 Gesellschaftlicher Wandel und die Folgen für Jugendliche heute .......
- 2.1.3 Betrachtung der Lebensphase Jugend heute........
- 2.1.4 Peergroup, Clique, Jugend(sub)kultur..\n
- 2.2 Jugend und Sozialraum......
- 2.2.1 Sozialraum und Lebenswelt - Zwei Begriffe, eine Richtung?
- 2.2.2 Zwei sozialökologische Modelle..\n
- 2.2.3 Der Stadtteil als Sozialraum
- 3. Sozialräumliche Jugendarbeit im Stadtteil
- 3.1,,Zu Gast im Sozialraum“.
- 3.1.1 Jugendliche Aneignung des Sozialraums......
- 3.1.2 Der sozialräumliche Ansatz in der Jugendarbeit...\n
- 3.2 Ansätze sozialräumlich orientierter Jugendarbeit im Stadtteil
- 3.2.1 Straßensozialarbeit und Mobile Jugendarbeit -\n,,Streetwork im Stadtteil\"\n
- 3.2.2 Offene Jugendarbeit im Stadtteil -\n,,Stützpunkt und sicherer Hafen\"\n
- 3.2.3 Cliquenorientierte Jugendarbeit\n
- 4. Überlegungen zu einer sozialraum- und stadtteilorientierten\nJugendarbeit..\n
- 4.1 Sozialräumliche Jugendarbeit im Stadtteil.
- 4.1.1 Jugendarbeit in der Krise?
- 4.1.2 Die Konkurrenz zum Freizeitsektor
- 4.1.3 Mobilität – Ein bisher zu wenig beachteter Faktor sozialräumlicher\nJugendarbeit?
- 4.1.4 Ausländische Jugendclique und sozialräumliche Jugendarbeit.........
- 4.2 Stadtteilorientierung in der sozialräumlichen Jugendarbeit
- 4.2.1 Öffentlichkeitsarbeit - Nicht nur Imagepflege .....
- 4.2.2 „Advokat und Vermittler“ – Den Konfliktlinien begegnen\n
- 4.2.3 Vernetzung und Kooperation.....\n
- 5. Ergänzende Überlegungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, die Bedeutung von Jugend(sub)kulturen, jugendlichen Cliquen und deren Raumverhalten für die soziale Arbeit mit Jugendlichen im Stadtteil zu untersuchen.
- Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Lebenswelt von Jugendlichen.
- Die Rolle von Cliquen und Jugend(sub)kulturen in der Bewältigung von Herausforderungen.
- Die Bedeutung von Sozialräumen und deren Aneignung durch Jugendliche.
- Die Herausforderungen und Potenziale sozialräumlicher Jugendarbeit im Stadtteil.
- Die Verbindung von sozialräumlichen und stadtteilorientierten Ansätzen in der Jugendarbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage der Diplomarbeit vor: Wie können jugendliche Cliquen, Jugend(sub)kulturen und deren Raumverhalten in die soziale Arbeit mit Jugendlichen im Stadtteil integriert werden?
Kapitel 2 untersucht die Grundlagen des Themas. Es analysiert die Situation und Lebenswelt Jugendlicher in der heutigen Gesellschaft, beleuchtet die Bedeutung von Cliquen und Jugend(sub)kulturen sowie den Zusammenhang zwischen Jugend und Sozialraum.
Kapitel 3 beleuchtet die sozialräumliche Jugendarbeit im Stadtteil und zeigt verschiedene Ansätze auf, wie diese in der Praxis umgesetzt werden kann.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit Überlegungen zu einer sozialraum- und stadtteilorientierten Jugendarbeit. Es untersucht die Herausforderungen und Potenziale dieser Herangehensweise, beleuchtet den Einfluss von Mobilität und die Zusammenarbeit mit ausländischen Jugendcliquen.
Schlüsselwörter
Jugendliche, Clique, Jugend(sub)kultur, Sozialraum, Stadtteil, sozialräumliche Jugendarbeit, Stadtteilorientierung, Mobilität, Ausländische Jugendclique, Vernetzung, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Cliquen für Jugendliche in der heutigen Gesellschaft?
Cliquen und Jugend(sub)kulturen dienen Jugendlichen als wichtige Felder für Ausdrucks- und Bewältigungsformen, um den Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels zu begegnen.
Was bedeutet der Begriff „Sozialraum“ im Kontext der Jugendarbeit?
Der Sozialraum beschreibt den Stadtteil als Gefüge von Lebenswelten, die sich Jugendliche aneignen. Die Arbeit untersucht, wie Räume für Cliquen entstehen und welche Bedeutung sie für das tägliche Leben haben.
Wie eignen sich Jugendliche ihren Sozialraum an?
Jugendliche eignen sich Räume durch physische Präsenz und soziale Interaktion an, stoßen dabei jedoch oft auf Barrieren oder Konflikte mit anderen Nutzergruppen im Stadtteil.
Was sind die Ziele einer sozialraumorientierten Jugendarbeit?
Ziele sind die Förderung der Selbstbestimmung, die Unterstützung bei der Raumaneignung und die Vermittlung zwischen den Bedürfnissen der Jugendlichen und den Strukturen des Stadtteils.
Welche Ansätze der Jugendarbeit werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit thematisiert Streetwork (mobile Jugendarbeit), offene Jugendarbeit als „sicheren Hafen“ sowie spezifisch cliquenorientierte Ansätze.
Befindet sich die Jugendarbeit aktuell in einer Krise?
Die Arbeit diskutiert, ob die Jugendarbeit durch Konkurrenz zum Freizeitsektor in der Krise ist oder ob sozialräumliche Ansätze neue, wichtige Impulse zur Weiterentwicklung bieten.
- Citation du texte
- Dipl.-Sozialarbeiter Andree Kämpfer (Auteur), 2003, Jugendliche Clique und ihre Sozialräume - Überlegungen zu einer stadtteilorientierten sozialen Arbeit mit Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67390