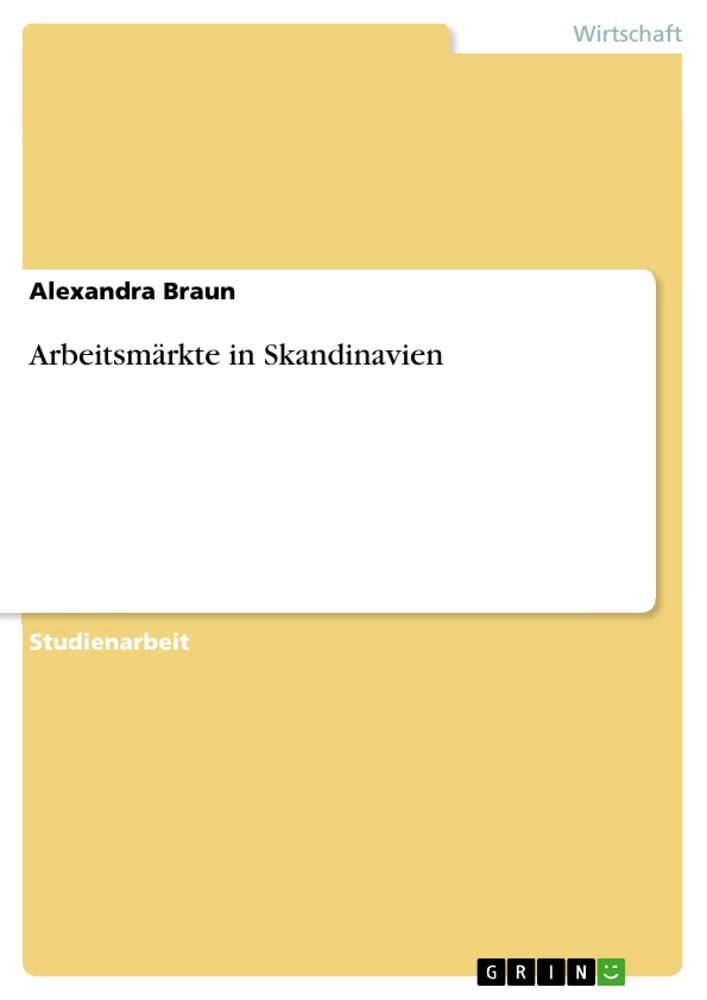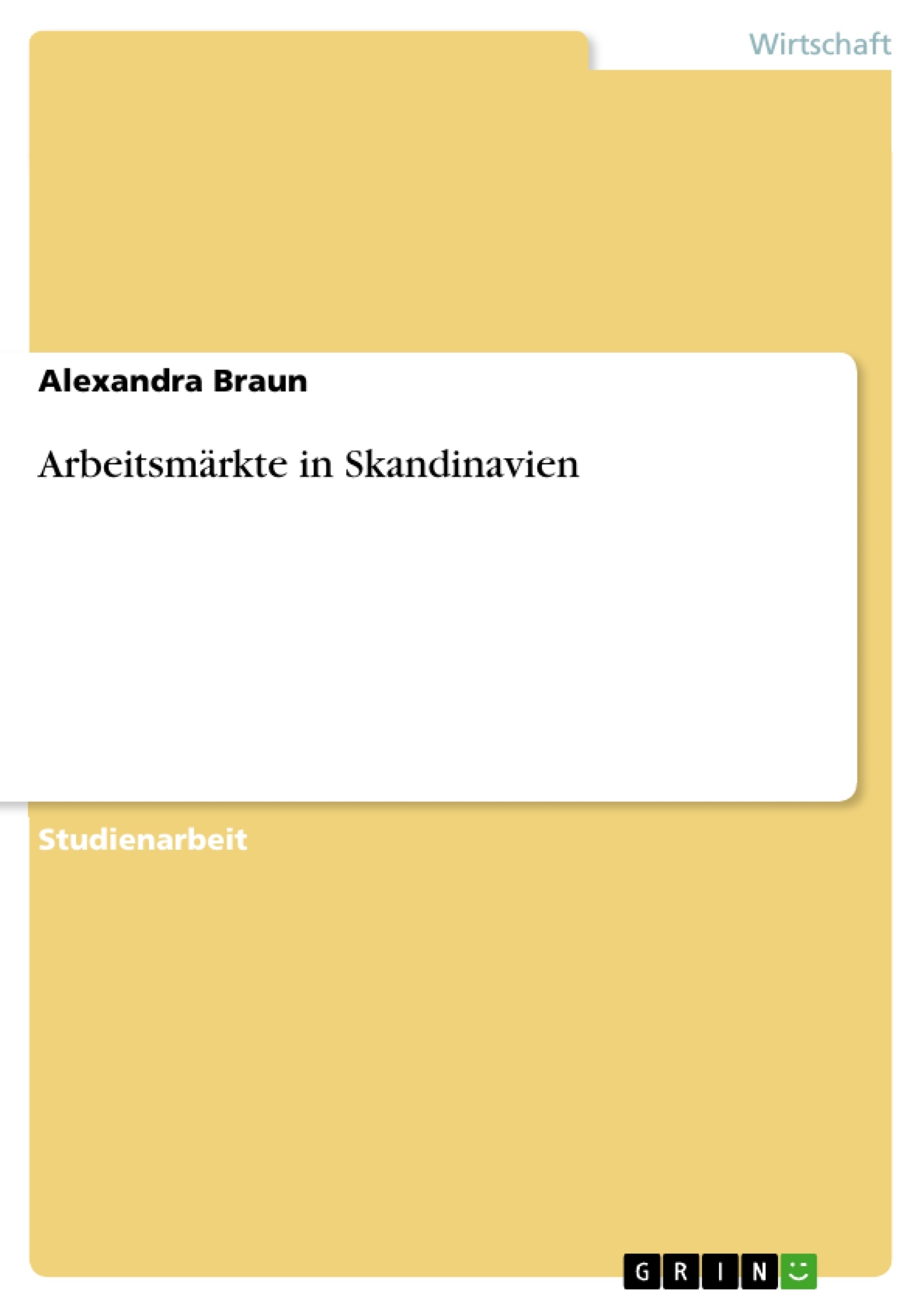Die ständig ansteigende hohe Arbeitslosigkeit stellt seit Jahren eines der größten Probleme aller OECD Länder dar. Betrug die durchschnittliche Arbeitslosenquote aller OECD Länder 1973 noch 3 Prozent, so stieg diese auf durchschnittlich 7,8% im Jahr 1993, konnte jedoch bis Ende der 90er Jahre wieder auf durchschnittliche 6,2% gesenkt werden. (HELLSTRÖM (2006), S. 314) Mit der Unterzeichung des „Nationale[n] Aktionsplan[s] für Beschäftigte“ im Jahr 2000 (BERTELSMANN STIFTUNG (2000), S. 172) setzt der schwedische Staat die über 100jährige lange Tradition beim Einsatz von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (AAMP) fort. Besonders angesichts der demografischen Entwicklungen und der generell schwachen konjunkturellen Lage Mitte der 90er Jahre, die zu einem plötzlichen und steilen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Skandinavien führte, standen und stehen noch immer die Mittel der AAMP im Zentrum der Politik. (HELLSTRÖM (2006), S. 314) Nicht zuletzt der Erfolg der skandinavischen Politik macht diese zu einem Denkmodell ganz Europas. Die politische Erfahrung mit den Effekten von AAMP und deren Wirkungsweise auf die einbezogenen Arbeitslosen sollen hier in wesentlichen Grundzügen dargestellt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten
- Entstehung und Entwicklung bis Mitte der 90er Jahre
- Situation nach den Reformen von 1994 bis heute
- Der Arbeitsmarkt und seine Besonderheiten in Schweden
- Grundprinzipien des Modells des „Volksheims“
- Passive Arbeitsmarktpolitik
- Aktive Arbeitsmarktpolitik
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, mit besonderem Fokus auf Schweden, und analysiert die Entwicklung und Herausforderungen des schwedischen Arbeitsmarktes. Sie beleuchtet die traditionellen und modernen Ansätze der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden, um die Entstehung und Bewältigung der Arbeitslosigkeit in diesem Land zu verstehen.
- Die Entstehung und Entwicklung des skandinavischen Modells des Wohlfahrtsstaates
- Die Rolle der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden
- Die Herausforderungen der Arbeitslosigkeit in Schweden
- Der Einfluss demographischer und wirtschaftlicher Veränderungen auf den schwedischen Arbeitsmarkt
- Die Bedeutung des „Volksheims“-Modells für den schwedischen Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung präsentiert die Problematik der Arbeitslosigkeit in den OECD-Ländern, beleuchtet die Rolle der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden und erklärt die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit.
Geschichte der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten
Entstehung und Entwicklung bis Mitte der 90er Jahre
Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung und Entwicklung der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden, beginnend mit der Errichtung des ersten öffentlichen Arbeitsamts im Jahr 1906. Er beleuchtet das „Rehn-Meidner-Modell“, das die Grundlage für die skandinavische Wohlfahrtspolitik bildet, und analysiert die erfolgreiche Bewältigung der Arbeitslosigkeit in den 1960er und 1970er Jahren.
Situation nach den Reformen von 1994 bis heute
Dieser Abschnitt untersucht die Herausforderungen, die sich durch den demographischen Wandel, die wirtschaftliche Krise der 1990er Jahre und den Anstieg der Arbeitslosigkeit in Schweden ergaben. Er analysiert die Gründe für den Anstieg der Arbeitslosigkeit, darunter die Höhe der Lohnersatzrate, die Dauer der staatlichen Unterstützung und die Kündigungsschutzregelungen.
Der Arbeitsmarkt und seine Besonderheiten in Schweden
Grundprinzipien des Modells des „Volksheims“
Dieser Abschnitt erklärt die Prinzipien des „Volksheims“-Modells, das die Grundlage für den schwedischen Sozialstaat und den schwedischen Arbeitsmarkt bildet. Er betont die Wichtigkeit der Solidarität, der Gleichheit und der sozialen Sicherung im schwedischen Arbeitsmarktmodell.
Passive Arbeitsmarktpolitik
Dieser Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Instrumente der passiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden, die darauf abzielen, Arbeitslose finanziell zu unterstützen und die Folgen der Arbeitslosigkeit zu mildern. Er diskutiert die Vor- und Nachteile dieser Maßnahmen.
Aktive Arbeitsmarktpolitik
Dieser Abschnitt analysiert die verschiedenen Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden, die darauf abzielen, Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Er stellt die wichtigsten Programme und Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Schweden vor.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: skandinavischer Wohlfahrtsstaat, aktive Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosigkeit, Schweden, „Volksheim“-Modell, Rehn-Meidner-Modell, demographischer Wandel, Wirtschaftskrise, Lohnersatzrate, Kündigungsschutz, Arbeitsvermittlung, Qualifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das schwedische Modell des „Volksheims“?
Das „Volksheim“ (Folkhemmet) ist die Grundlage des schwedischen Wohlfahrtsstaates und basiert auf Prinzipien wie Solidarität, Gleichheit und umfassender sozialer Sicherung.
Was unterscheidet aktive von passiver Arbeitsmarktpolitik?
Passive Politik bietet finanzielle Unterstützung (z.B. Arbeitslosengeld), während aktive Arbeitsmarktpolitik (AAMP) auf Integration durch Qualifizierung und Vermittlung setzt.
Was besagt das Rehn-Meidner-Modell?
Es ist ein wirtschaftspolitisches Konzept, das Vollbeschäftigung, niedrige Inflation und gerechte Lohnstrukturen durch staatliche Eingriffe und aktive Arbeitsmarktpolitik kombinieren wollte.
Warum stieg die Arbeitslosigkeit in Skandinavien in den 90er Jahren an?
Gründe waren eine schwache konjunkturelle Lage, wirtschaftliche Krisen und demografische Veränderungen, die das traditionelle Modell unter Druck setzten.
Welche Rolle spielt die Qualifizierung in Schweden?
Qualifizierung ist ein Kerninstrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik, um Arbeitslose an die sich ändernden Anforderungen des Marktes anzupassen und langfristig zu integrieren.
- Quote paper
- Alexandra Braun (Author), 2006, Arbeitsmärkte in Skandinavien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67460