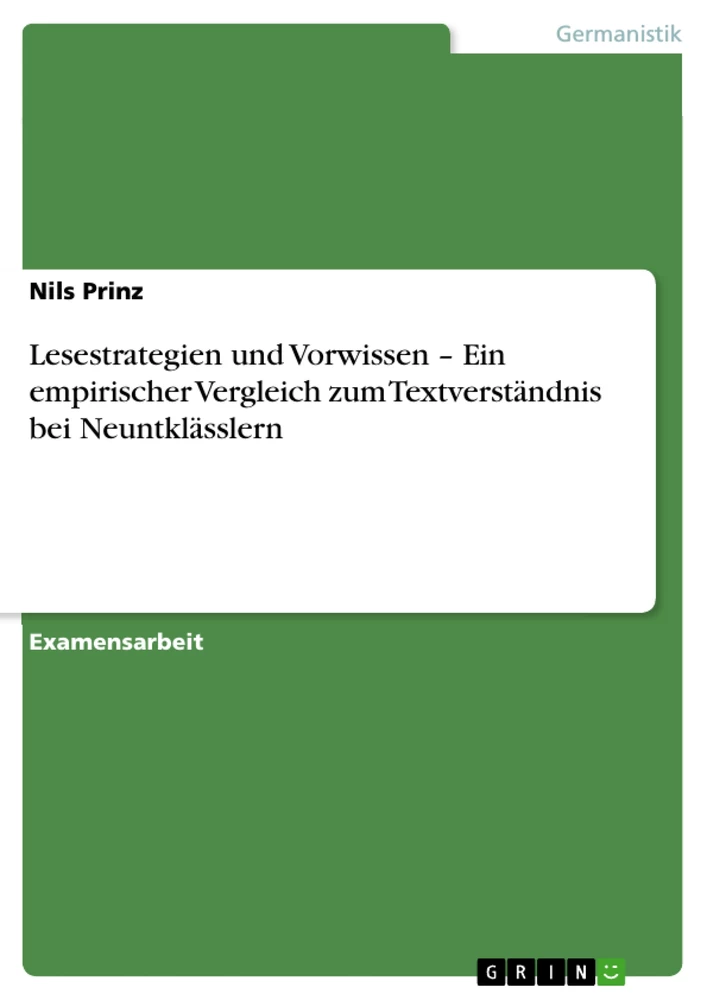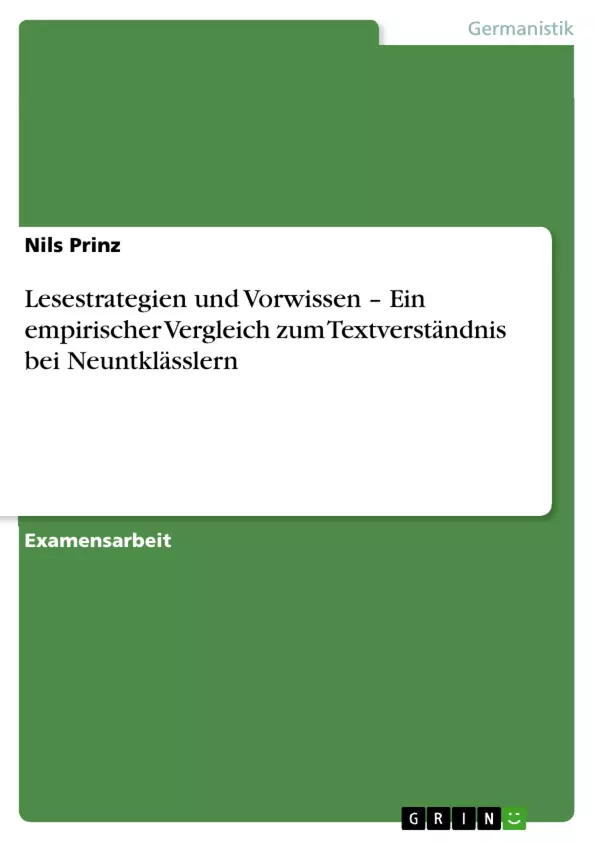Die Veröffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse im Dezember 2001 stieß in der Öffentlichkeit auf großes Interesse und dokumentierte das bestenfalls mittelmäßige Abschneiden deutscher Schüler im internationalen Vergleich. PISA 2000 erfasste im Millenniumsjahr speziell die ‚Lesekompetenz’ 15jähriger Schüler in den Mitgliedstaaten der OECD3 mit dem Zweck, die Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme vergleichend in Augenschein zu nehmen.
Zum Erstaunen vieler lag Deutschland relativ deutlich unter dem Mittelwert aller OECDLänder.
Beinahe 23% der untersuchten Neuntklässler erreichten auf einer fünfstufigen
(Lese-)Kompetenzskala höchstens die unterste Stufe. Im oberen Leistungsbereich entsprachen deutsche Schüler zwar dem internationalen Standard, lieferten aber in keinem Bereich überdurchschnittliche Ergebnisse. Besondere Schwächen fanden sich beim Reflektieren und Bewerten von Texten, immerhin eine angenommene Domäne des Literaturunterrichts hierzulande.
Die Deutschdidaktiker diskutierten die Frage, welche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Leseprozess gegeben sein müssen, selbstverständlich lange vor der Veröffentlichung dieser Ergebnisse, doch erst die Diskussionen um die „PISA-Katastrophe“ machten plötzlich einen richtungsweisenden Paradigmenwechsel möglich: die sog. „Empirische Wende der Bildungspolitik“.
Zentral ist bei dieser (Richtungs-)Weisung die (Neu-)Orientierung am Ertrag
der Schule – an ihrem ‚output’ – und die Evaluierung des Lernzuwachses der Schüler.
Über die Notwendigkeit einer Evaluierung des Lernzuwachses sind sich mittlerweile Bildungspolitiker, maßgebliche Vertreter der Schulpraxis, Elternverbände und nicht zuletzt auch die Bildungsforschung einig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Theoretischer Hintergrund
- Mentale Verarbeitung
- Kognition
- Horizontale und vertikale Informationsverarbeitung
- Wissen
- Anwärmphasen und ihre Bedeutung für das Leseverstehen
- Wissensebenen
- Lesen und Textverstehen
- Schwierigkeitsbereiche literarischer Texte
- Metakognition und ihre Bedeutung für das Lesen
- Emotionen und ihre Bedeutung für die Lesemotivation
- Bedeutung von Motivation für das Leseverstehen
- Exkurs I: Allgemeine Leseinteressen jugendlicher Leser
- Literaturdidaktik und Leseforschung
- Einfluss der Werkinterpretation
- Exkurs II: Literaturdidaktische Positionen seit 1945
- Erziehender Literaturunterricht
- Sachstrukturell orientierte Literaturdidaktik
- Kritische Literaturdidaktik
- Rezeptionsorientierung
- Produktionsorientierte Literaturdidaktik
- Die Empirische Wende
- PISA
- DESI
- Strukturelle Unterschiede von PISA und DESI
- Bildungsstandards im Vergleich zu den Lehrplänen
- Allgemeines zu (DESI-)Kompetenzen
- Leseprozessmodell und Lesekompetenzenförderung nach DESI
- Das Leseprozessmodell
- Vorwissen
- Lokale Informationsentnahme
- Inferenzen bilden
- Fokussieren um lokale Kohärenz herzustellen
- Wissen
- Globale Kohärenz
- Mentales Modell
- Vergleich zweier Texte
- Zusammenfassung
- Das Leseprozessmodell als Instrumentarium
- Exkurs III: (Fachdidaktische Kontroverse über den) Zweck von Lesestrategietrainings im Deutschunterricht
- Das Leseprozessmodell
- Fragestellung
- Ablauf und Methode der Untersuchung
- Zielgruppe
- Untersuchungsdesign und Analyseverfahren
- Analyse
- Zur Kurzgeschichte „Der Feind“
- Analyse: Transkript I
- Analyse: Transkript II
- Analyse: Transkript III
- Zusammengefasste Ergebnisse der Unterrichtsanalysen
- Gesamtergebnisse
- Wirksamkeit von Lesestrategien und Vorwissen
- Zwischenfazit zur Lehrerrolle
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examenshausarbeit untersucht den Einfluss von Lesestrategien und Vorwissen auf das Textverständnis von Neuntklässlern. Der Fokus liegt auf der empirischen Analyse von Unterrichtssequenzen, in denen verschiedene Lesestrategien angewendet werden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit dieser Strategien und den Einfluss von Vorwissen auf das Textverständnis zu evaluieren.
- Die Rolle von Lesestrategien im Deutschunterricht
- Die Bedeutung von Vorwissen für das Textverständnis
- Empirische Analyse von Unterrichtssequenzen
- Evaluierung der Wirksamkeit von Lesestrategien
- Die Rolle des Lehrers bei der Förderung des Textverständnisses
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der Lesekompetenz im gesellschaftlichen Kontext dar und beleuchtet die Ergebnisse der PISA-Studie, die eine mittelmäßige Lesekompetenz deutscher Schüler im internationalen Vergleich aufzeigten. Sie führt die "Empirische Wende" der Bildungspolitik ein, die eine verstärkte Fokussierung auf den Lernerfolg und die Evaluation des Lernzuwachses fordert.
- Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die kognitiven Prozesse des Lesens, die Rolle von Vorwissen und die Bedeutung von Lesestrategien für das Textverständnis. Es werden verschiedene Modelle des Leseprozesses und der mentalen Verarbeitung von Texten vorgestellt und die Bedeutung von Emotionen und Motivation für die Leseaktivität diskutiert.
- Literaturdidaktik und Leseforschung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze der Literaturdidaktik und ihrer Entwicklung. Es werden unterschiedliche literaturdidaktische Positionen seit 1945 vorgestellt, darunter der erziehende Literaturunterricht, die sachstrukturell orientierte Literaturdidaktik, die kritische Literaturdidaktik, die Rezeptionsorientierung und die produktionsorientierte Literaturdidaktik.
- Die Empirische Wende: Dieses Kapitel widmet sich der "Empirischen Wende" der Bildungspolitik und analysiert die Bedeutung von PISA und DESI für die Lesekompetenzförderung. Es beleuchtet die strukturellen Unterschiede zwischen PISA und DESI, die Bildungsstandards im Vergleich zu den Lehrplänen und die Bedeutung von Lesekompetenzen im Sinne von DESI.
- Ablauf und Methode der Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Zielgruppe der Untersuchung, das Untersuchungsdesign und die Analyseverfahren, die für die empirische Untersuchung der Wirksamkeit von Lesestrategien angewendet wurden.
- Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Analyse von Unterrichtssequenzen, in denen verschiedene Lesestrategien angewendet wurden. Es werden Transkripte der Unterrichtssequenzen analysiert und die Ergebnisse der Analyse dargestellt. Die Ergebnisse beleuchten die Wirksamkeit der Lesestrategien und den Einfluss von Vorwissen auf das Textverständnis.
- Gesamtergebnisse: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und beleuchtet die Wirksamkeit von Lesestrategien und den Einfluss von Vorwissen auf das Textverständnis. Es bietet ein Zwischenfazit zur Rolle des Lehrers bei der Förderung des Textverständnisses.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Lesestrategien, Vorwissen, Textverständnis, empirische Forschung, Unterrichtsanalyse, Deutschunterricht, PISA, DESI und Lesekompetenz. Die Arbeit untersucht den Einfluss von Lesestrategien und Vorwissen auf das Textverständnis von Schülern im Deutschunterricht, wobei sie sich auf die Ergebnisse der empirischen Analyse von Unterrichtssequenzen stützt. Die Studie bezieht sich auf relevante Konzepte und Studien der Bildungsforschung und Literaturdidaktik, insbesondere im Kontext der internationalen Studien wie PISA und DESI.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „PISA-Katastrophe“ im Jahr 2000?
Es war das enttäuschende Abschneiden deutscher Schüler im internationalen Vergleich der Lesekompetenz, was zu weitreichenden Bildungsreformen führte.
Welche Rolle spielt Vorwissen beim Leseverstehen?
Vorwissen ist eine entscheidende Voraussetzung, um Informationen aus Texten zu integrieren und ein mentales Modell des Inhalts aufzubauen.
Was versteht man unter der „Empirischen Wende“ in der Bildungspolitik?
Ein Paradigmenwechsel hin zur Orientierung am tatsächlichen Lernerfolg (Output) und der regelmäßigen Evaluierung von Schülerleistungen.
Wie unterscheiden sich PISA und DESI?
Die Arbeit analysiert strukturelle Unterschiede in der Erfassung von Kompetenzen und den zugrundeliegenden Bildungsstandards dieser Studien.
Helfen Lesestrategietrainings im Deutschunterricht?
Die Untersuchung evaluiert die Wirksamkeit solcher Trainings anhand von Transkripten aus dem Unterricht der neunten Klasse.
- Mentale Verarbeitung
- Citar trabajo
- Nils Prinz (Autor), 2007, Lesestrategien und Vorwissen – Ein empirischer Vergleich zum Textverständnis bei Neuntklässlern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67958