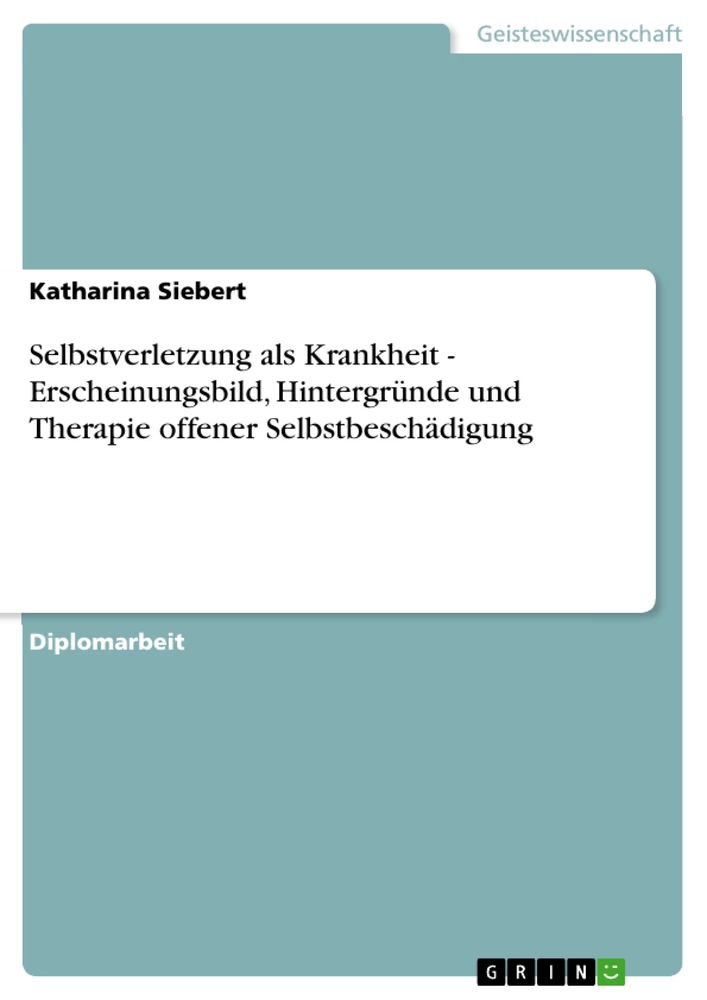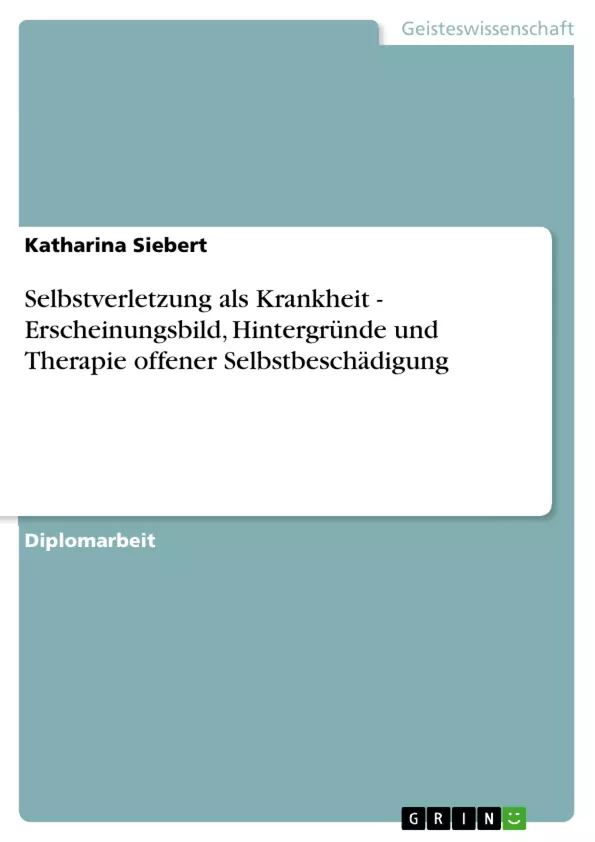Im Anschluß an das vorliegende Einleitungskapitel werden zunächst einige grundlegende Informationen zum Thema „selbstverletzendes Verhalten“ gegeben. Zu diesem Zweck werden im zweiten Kapitel verschiedene Formen der Selbstverletzung dargestellt, wobei einerseits die fließenden Übergänge zwischen akzeptierter und krankhafter Selbstbeschädigung verdeutlicht und andererseits einige Besonderheiten der pathologischen Selbstverletzung aufgezeigt werden. In Kapitel drei wird das Phänomen der krankhaften Selbstverletzung begrifflich näher bestimmt und eingeordnet. Zudem erfolgt eine Abgrenzung zu anderen pathologischen Varianten selbstverletzenden Verhaltens. Das vierte Kapitel liefert einen Überblick über relevante epidemiologische Daten zur Problematik der Selbstverletzung. Auf das Erscheinungsbild des selbstverletzenden Verhaltens wird im fünften Kapitel eingegangen. Neben der Art und Schwere der Symptome wird in diesem Zusammenhang die Häufigkeit und Lokalisation der Verletzungen beschrieben. Des weiteren werden einige typische Begleiterkrankungen aufgeführt und der Aspekt der diagnostischen Zuordnung behandelt. Das sechste Kapitel befaßt sich mit den verschiedenen Modellen, die zur Erklärung selbstverletzenden Verhaltens herangezogen werden können. Dabei werden biologische, lerntheoretische und psychoanalytisch-psychodynamische Ansätze vorgestellt und diskutiert. Die Auseinandersetzung mit der Frage, welche Bedeutung das selbstverletzende Verhalten für die betroffenen Patienten haben kann, erfolgt in Kapitel sieben. Hier werden die verschiedenen intrapersonellen und interpersonellen Funktionen des Verhaltens erläutert. Das achte Kapitel liefert einen Überblick über relevante therapeutische Verfahren und stellt verschiedene Möglichkeiten zur Selbsthilfe bei selbstverletzendem Verhalten vor. Im neunten Kapitel soll abschließend der Frage nachgegangen werden, wie sich Angehörige, Freunde und professionelle Helfer gegenüber den betroffenen Patienten verhalten sollten, um sie bei der Überwindung des selbstverletzenden Verhaltens möglichst gut zu unterstützen. In diesem Zusammenhang werden einige Hinweise zum angemessenen Umgang mit den Betroffenen und ihrer Erkrankung gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen der Selbstverletzung
- Religiöse und rituelle Selbstverletzung
- Alltägliche Selbstverletzung
- Selbstverletzung als Krankheit
- Begriffliche Einordnung und Abgrenzung von anderen Begriffen
- Begriffsklärung
- Abgrenzung von artifiziellen Krankheiten
- Abgrenzung von indirekten Selbstverletzungen
- Abgrenzung vom Suizid
- Epidemiologie
- Erscheinungsbild und diagnostische Zuordnung
- Art und Schwere der Symptome
- Häufigkeit und Lokalisation der Symptomhandlungen
- Begleiterkrankungen
- Diagnostische Zuordnung
- Erklärungsmodelle
- Biologische Erklärungsmodelle
- Lerntheoretische Erklärungsmodelle
- Psychoanalytisch-psychodynamische Erklärungsmodelle
- Funktionen der Selbstverletzung
- Allgemeine Aspekte
- Intrapersonelle Funktionen
- Interpersonelle Funktionen
- Therapie und Selbsthilfe
- Medikamentöse Therapie
- Traumatherapie
- Dialektisch-Behaviorale Therapie
- Sonstige Therapieformen
- Selbsthilfemöglichkeiten
- Zum Umgang mit Selbstverletzung
- Im privaten Umfeld
- Auf der Station
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen der Selbstverletzung umfassend zu beschreiben und das Verständnis für Betroffene zu fördern. Sie beleuchtet das Erscheinungsbild, die Hintergründe und mögliche Therapieansätze. Ein weiterer Fokus liegt auf den Funktionen, die Selbstverletzung für die Betroffenen erfüllt.
- Erscheinungsformen und Verbreitung von Selbstverletzung
- Ursachen und Erklärungsmodelle für selbstverletzendes Verhalten
- Funktionen von Selbstverletzung für Betroffene
- Diagnose und Therapieansätze
- Umgang mit Selbstverletzung im privaten und professionellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die steigende Häufigkeit selbstverletzenden Verhaltens (SVV) in den Mittelpunkt und hebt die Notwendigkeit eines besseren Verständnisses für dieses Phänomen hervor. Sie betont den schockierenden Aspekt von SVV für Außenstehende und beschreibt das Ziel der Arbeit, über die Problematik zu informieren und das Verständnis für Betroffene zu fördern. Die Arbeit fokussiert auf das Erscheinungsbild, die Hintergründe, Ursachen, Funktionen und Therapieansätze von SVV.
Formen der Selbstverletzung: Dieses Kapitel differenziert verschiedene Formen von Selbstverletzung, wobei die fließenden Übergänge zwischen akzeptierter und krankhafter Selbstbeschädigung herausgearbeitet werden. Es werden Besonderheiten pathologischer Selbstverletzung beleuchtet und die verschiedenen Ausprägungen des SVV eingeordnet. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zu anderen Verhaltensweisen und der Hervorhebung der pathologischen Aspekte.
Begriffliche Einordnung und Abgrenzung von anderen Begriffen: Dieses Kapitel widmet sich der klaren Definition von Selbstverletzung und grenzt sie von ähnlichen Konzepten ab, wie artifiziellen Krankheiten, indirekten Selbstverletzungen und Suizid. Es klärt begriffliche Unklarheiten und liefert eine präzise Einordnung von SVV im Kontext anderer psychischer Störungen. Die Abgrenzungen sind essentiell für eine korrekte Diagnose und Therapie.
Epidemiologie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbreitung und Häufigkeit von selbstverletzendem Verhalten in der Bevölkerung. Es analysiert statistische Daten und beleuchtet mögliche Risikofaktoren und demographische Muster. Die Darstellung der epidemiologischen Daten untermauert die Relevanz des Themas und die Notwendigkeit weiterer Forschung.
Erscheinungsbild und diagnostische Zuordnung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Erscheinungsbild von SVV, einschließlich der Art, Schwere und Lokalisation der Symptome. Es analysiert Begleiterkrankungen und diskutiert verschiedene diagnostische Ansätze. Die detaillierte Beschreibung unterstützt eine frühzeitige Erkennung und Intervention.
Erklärungsmodelle: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Erklärungsmodelle für selbstverletzendes Verhalten, darunter biologische, lerntheoretische und psychoanalytisch-psychodynamische Ansätze. Die verschiedenen Perspektiven werden miteinander in Beziehung gesetzt und tragen zu einem umfassenderen Verständnis der komplexen Ursachen bei.
Funktionen der Selbstverletzung: Dieses Kapitel erörtert die Funktionen, die selbstverletzendes Verhalten für die Betroffenen erfüllt, sowohl auf intrapersonaler als auch interpersonaler Ebene. Es analysiert die möglichen motivations- und funktionsbezogenen Aspekte des SVV und liefert Einblicke in die subjektive Bedeutung des Verhaltens für die Betroffenen.
Therapie und Selbsthilfe: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Therapie- und Selbsthilfemöglichkeiten für Menschen mit selbstverletzendem Verhalten. Es beschreibt verschiedene Therapiemethoden wie medikamentöse Therapien, Traumatherapie und dialektisch-behaviorale Therapie, sowie Selbsthilfegruppen und deren Bedeutung im therapeutischen Prozess. Das Kapitel beleuchtet die Vielfältigkeit der Behandlungsansätze.
Zum Umgang mit Selbstverletzung: Dieses Kapitel bietet praktische Hinweise zum Umgang mit Selbstverletzung im privaten Umfeld und in professionellen Kontexten wie z.B. auf einer psychiatrischen Station. Es liefert konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen für Angehörige, Freunde und Fachkräfte im Umgang mit Betroffenen.
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten (SVV), Selbstbeschädigung, Epidemiologie, Erklärungsmodelle, Therapie, Selbsthilfe, Biologische Faktoren, Psychodynamik, Lerntheorie, Diagnostik, Begleiterkrankungen, Umgang mit Betroffenen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Selbstverletzendes Verhalten
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über selbstverletzendes Verhalten (SVV). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Die Arbeit beschreibt Erscheinungsformen, Hintergründe, Ursachen, Funktionen und Therapieansätze von SVV. Sie richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von SVV.
Welche Arten von Selbstverletzung werden behandelt?
Das Dokument unterscheidet verschiedene Formen von Selbstverletzung, von religiöser und ritueller Selbstverletzung über alltägliche Selbstverletzung bis hin zu Selbstverletzung als Krankheit. Es werden die fließenden Übergänge zwischen akzeptierter und krankhafter Selbstbeschädigung herausgearbeitet und pathologische Aspekte beleuchtet.
Wie wird Selbstverletzung von anderen Begriffen abgegrenzt?
Ein Kapitel widmet sich der klaren Definition von Selbstverletzung und grenzt sie von ähnlichen Konzepten ab, wie artifiziellen Krankheiten, indirekten Selbstverletzungen und Suizid. Die Abgrenzungen sind essentiell für eine korrekte Diagnose und Therapie.
Welche epidemiologischen Daten werden präsentiert?
Das Dokument befasst sich mit der Verbreitung und Häufigkeit von selbstverletzendem Verhalten in der Bevölkerung. Es analysiert statistische Daten und beleuchtet mögliche Risikofaktoren und demographische Muster.
Wie wird das Erscheinungsbild von Selbstverletzung beschrieben?
Das Erscheinungsbild von SVV wird detailliert beschrieben, einschließlich der Art, Schwere und Lokalisation der Symptome. Es werden Begleiterkrankungen analysiert und verschiedene diagnostische Ansätze diskutiert.
Welche Erklärungsmodelle für Selbstverletzung werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert verschiedene Erklärungsmodelle für selbstverletzendes Verhalten, darunter biologische, lerntheoretische und psychoanalytisch-psychodynamische Ansätze. Die verschiedenen Perspektiven werden miteinander in Beziehung gesetzt.
Welche Funktionen erfüllt Selbstverletzung für Betroffene?
Das Dokument erörtert die Funktionen, die selbstverletzendes Verhalten für die Betroffenen erfüllt, sowohl auf intrapersonaler als auch interpersonaler Ebene. Es analysiert motivations- und funktionsbezogene Aspekte.
Welche Therapie- und Selbsthilfemethoden werden beschrieben?
Es wird ein Überblick über verschiedene Therapie- und Selbsthilfemöglichkeiten gegeben, darunter medikamentöse Therapien, Traumatherapie, dialektisch-behaviorale Therapie und Selbsthilfegruppen.
Wie kann man mit Selbstverletzung im privaten und professionellen Kontext umgehen?
Das Dokument bietet praktische Hinweise zum Umgang mit Selbstverletzung im privaten Umfeld und in professionellen Kontexten wie z.B. auf einer psychiatrischen Station. Es liefert konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter umfassen: Selbstverletzendes Verhalten (SVV), Selbstbeschädigung, Epidemiologie, Erklärungsmodelle, Therapie, Selbsthilfe, Biologische Faktoren, Psychodynamik, Lerntheorie, Diagnostik, Begleiterkrankungen, Umgang mit Betroffenen.
- Quote paper
- Dipl.-Sozialarbeiterin // Magister Artium Katharina Siebert (Author), 2005, Selbstverletzung als Krankheit - Erscheinungsbild, Hintergründe und Therapie offener Selbstbeschädigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67985