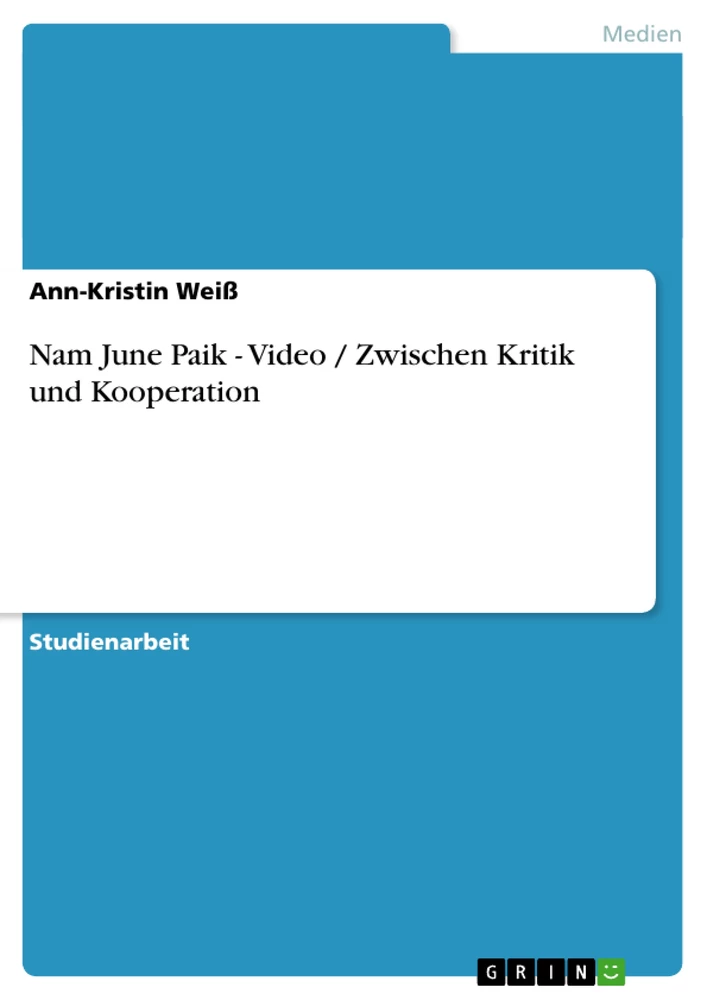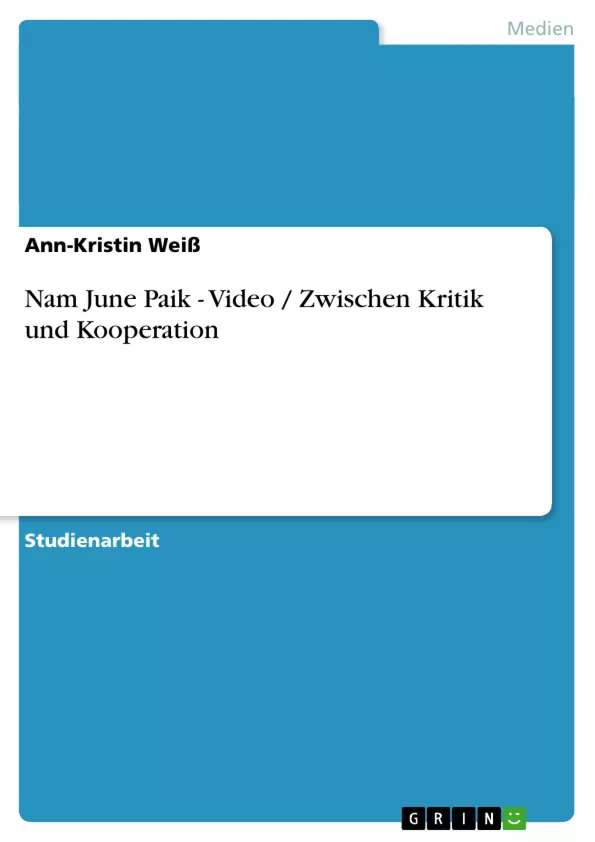Der Medientheoretiker Marshall McLuhan entwarf 1962 die Theorie des „global village“, der weltweiten Kommunikation im globalen Dorf. Mit der Entwicklung des Fernsehens zum Massenmedium und spätestens seit der Allgegenwärtigkeit des Internets ist diese Vision Wirklichkeit geworden. Neben dem technischen Fortschritt, der durch die Industrie vorangetrieben wurde, begannen Künstler in den frühen sechziger Jahren das Fernsehen in ihre Kunst einzubeziehen
Einer dieser frühen Pioniere war der Koreaner Nam June Paik, der zu immer neuen Mitteln griff, um sich mit dem beherrschenden Massenmedium der Zeit auseinander zu setzen. Ab 1965 begann er dann als einer der ersten Künstler mit dem gerade erst verfügbar gewordenen Medium Video zu arbeiten. Im Laufe seines Schaffens entwickelte er eine große Vielfalt von Einsatzmöglichkeiten und zeigte damit schon viele Aspekte der Medienkunst auf, die sich bis heute weiterentfalten. Mit seinen Fernsehprojekten,Installationen, Performances, Gemeinschaftsarbeiten und der Entwicklung neuer künstlerischer Werkzeuge setzte Paik Maßstäbe für die Produktion und Wahrnehmung von Videokunst. Heute gilt er als wichtigster Vertreter der Medienkunst und ist weltweit der einzige Künstler, der seit Beginn der sechziger Jahre bis zu seinem Tod im Januar 2006 kontinuierlich mit Fernsehen und Video gearbeitet hat.
Nam June Paik ist einem internationalen Publikum vor allem durch seine Installationen und Videoskulpturen bekannt. Auch wenn er vorwiegend durch diese Arbeiten Weltruhm erlangt hat, wäre sein Werk ohne die Auseinandersetzung mit der europäischen Musik des zwanzigsten Jahrhunderts nicht denkbar gewesen. Das folgende Kapitel geht daher knapp auf seine Anfänge als Komponist ein, veranschaulicht seinen Weg von „Global Village“ ist ein Begriff aus der Medientheorie, der 1962 von Marshall McLuhan in seinem Buch The Gutenberg Galaxy geprägt wurde. McLuhan bezieht sich damit auf die moderne Welt, die durch die elektronischen Massenmedien ihre räumliche und zeitlichen Barrieren in der menschlichen Kommunikation verliert, und somit zu einem „Dorf“ zusammenwächst. Heute wird der Begriff zumeist als Metapher für das Internet und das World Wide Web gebraucht. Vgl. McLuhan, 1997, S. 84 ff., 223 ff. 2 Unter dem Oberbegriff „Medienkunst“, die ihre Wurzeln in der Videokunst der sechziger Jahre hat, werden heute eine Reihe von künstlerischen Ansätzen zusammengefasst, die den Verzicht traditioneller Mittel bei der Bildproduktion gemeinsam haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Von der elektronischen Musik zum elektronischen Bild
- 2.1 Musikalische Grenzgänge
- 2.2 Aktionsmusik und Fluxus-Performance
- 2.3 Geburtsstunde der Videokunst
- 2.3.1 Exposition of Music - Electronic Television, 1963
- 3. Fernsehen
- 3.1 Entwicklung zum Massenmedium
- 3.2 Fernsehen und (Video)Kunst.
- 4. Videoinstallationen 1963-1982
- 4.1 Partizipationsfernsehen
- 4.1.1 Magnet TV, 1965
- 4.1.2 Partizipation TV, 1963-66
- 4.2 Closed-Circuit-Installationen
- 4.2.1 TV-Buddha, 1974 / TV-Rodin, 1978
- 4.2.2 Zenith/TV Looking Glass, 1974
- 4.2.3 TV Chair, 1968 / 1974
- 4.2.4 Real Plant/Live Plant, 1978-82
- 4.2.5 Real Fish/Live Fish, 1982
- 4.2.6 Three Eggs, 1981
- 4.2.7 Resümee
- 4.3 Multi-Monitor-Installationen
- 4.3.1 Moon is the oldest TV, 1965-1976
- 4.3.2 TV Clock, 1963 - 1981
- 4.3.3 TV Cross, 1966/68 und TV Garden, 1974
- 4.3.4 Fish Flies on Sky, 1975
- 4.3.5 Video Laser Environment, 1981
- 4.3.6 V-yramid, 1982
- 4.3.7 Video Gate, 1982
- 4.3.8 Resümee
- 4.4 Videoobjekte für Charlotte Moorman
- 4.4.1 TV Bra for Living Sculpture, 1969
- 4.1 Partizipationsfernsehen
- 5. Videobänder
- 5.1 Sony Portapak – Übergang in ein neues Zeitalter
- 5.2 Paik/Abe Synthesizer, 1970
- 5.3 Global Groove, 1973
- 6. Good Morning, Mr. Orwell, 1984
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Werk des koreanisch-amerikanischen Künstlers Nam June Paik und seiner bedeutenden Rolle in der Entwicklung der Videokunst. Die Arbeit untersucht Paik's künstlerische Entwicklung von seinen frühen Experimenten mit elektronischer Musik und Fluxus-Performances bis hin zu seinen innovativen Videoinstallationen und Videobändern.
- Die Bedeutung von Paik's Einfluss auf die Entstehung der Videokunst als eigenständige Kunstform.
- Die Beziehung zwischen Musik, Technologie und bildender Kunst in Paik's Werk.
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Medium Fernsehen und seine Rezeption in Paik's Arbeiten.
- Die Entwicklung und die verschiedenen Arten von Videoinstallationen, die Paik in seiner Karriere realisierte.
- Die Verwendung von Video als Mittel zur künstlerischen Ausdruck, Kommunikation und Interaktion.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die einen kurzen Überblick über das Leben und Werk von Nam June Paik gibt. Sie legt den Fokus auf Paik's Einfluss auf die Entwicklung der Videokunst und stellt die Forschungsfragen der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet Paik's künstlerische Anfänge im Bereich der elektronischen Musik und seine frühen Arbeiten mit Fluxus-Performances. Es beschreibt die Entstehung der Videokunst und Paik's wegweisende Arbeit "Exposition of Music - Electronic Television". Kapitel 3 befasst sich mit dem Medium Fernsehen und seiner Entwicklung zum Massenmedium. Es analysiert die Beziehung zwischen Fernsehen und (Video)kunst und die Herausforderungen, die Paik mit dem Medium Fernsehen konfrontierte. In Kapitel 4 wird ein detaillierter Überblick über Paik's Videoinstallationen gegeben, die in verschiedenen Phasen seiner Karriere entstanden sind. Es werden die verschiedenen Formen von Videoinstallationen – Partizipationsfernsehen, Closed-Circuit-Installationen und Multi-Monitor-Installationen – sowie ihre Bedeutung im Kontext von Paik's künstlerischen Entwicklung analysiert. Kapitel 5 behandelt Paik's Videobänder und beleuchtet die Rolle des Sony Portapak als entscheidenden Schritt in der Entwicklung der Videokunst. Es analysiert Paik's Videobänder "Paik/Abe Synthesizer" und "Global Groove" und untersucht deren Bedeutung im Kontext seiner künstlerischen Entwicklung. Abschließend wird in Kapitel 6 Paik's Videoband "Good Morning, Mr. Orwell" vorgestellt, das die kritische Auseinandersetzung des Künstlers mit den sozialen und politischen Auswirkungen der Technologie reflektiert.
Schlüsselwörter
Nam June Paik, Videokunst, elektronische Musik, Fluxus, Fernsehen, Videoinstallationen, Partizipationsfernsehen, Closed-Circuit-Installationen, Multi-Monitor-Installationen, Videobänder, Sony Portapak, "Exposition of Music - Electronic Television", "TV Buddha", "Good Morning, Mr. Orwell", Medienkritik.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Nam June Paik?
Nam June Paik war ein koreanisch-amerikanischer Künstler und Pionier der Videokunst, der ab den 1960er Jahren das Fernsehen und Video als künstlerische Medien etablierte.
Was ist die Bedeutung von "Global Village" in Paiks Werk?
Basierend auf Marshall McLuhan visionierte Paik eine weltweite Kommunikation durch elektronische Medien, was er in Projekten wie "Global Groove" künstlerisch umsetzte.
Was ist das "TV-Buddha"-Kunstwerk?
Es ist eine berühmte Closed-Circuit-Installation von 1974, bei der eine Buddha-Statue ihr eigenes, live übertragenes Bild auf einem Monitor betrachtet.
Welche Rolle spielte die Musik in seiner Karriere?
Paiks Anfänge lagen in der elektronischen Musik und der Fluxus-Bewegung; sein Weg zur Videokunst ist ohne die Auseinandersetzung mit der Musik des 20. Jahrhunderts nicht denkbar.
Was war der Einfluss des Sony Portapak?
Die Verfügbarkeit der ersten tragbaren Videokamera (Sony Portapak) im Jahr 1965 ermöglichte Paik und anderen Künstlern den Übergang von der Studiotechnik zur freien Videokunst.
Was thematisiert "Good Morning, Mr. Orwell"?
Dieses Satellitenprojekt von 1984 reflektiert kritisch die sozialen und politischen Auswirkungen von Technologie im Kontrast zu Orwells dystopischer Vision.
- Citation du texte
- Ann-Kristin Weiß (Auteur), 2007, Nam June Paik - Video / Zwischen Kritik und Kooperation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68067