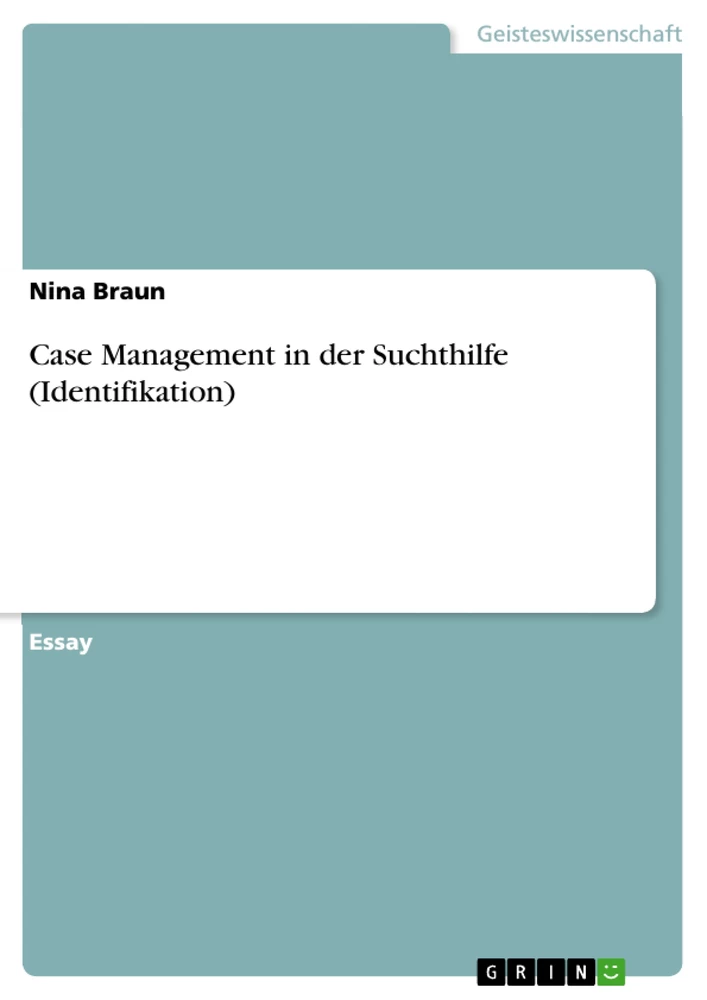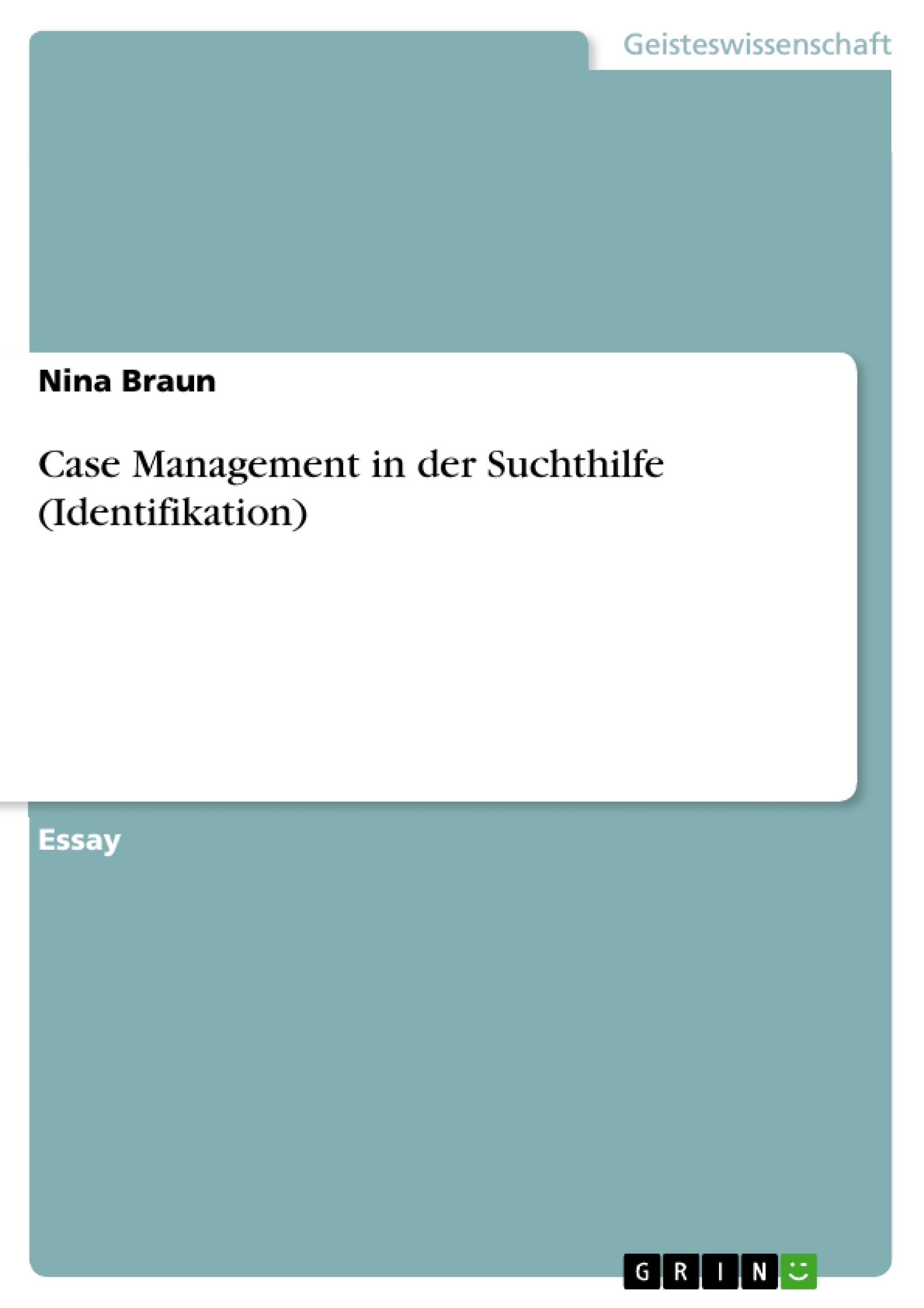Seit einigen Jahren wird Case Management, nachdem es in den USA schon Ende der 70erJahre entwickelt wurde, in Deutschland vermehrt angewendet. Auch im Bereich der Suchtkranken- und Drogenhilfe. Case Management wird meist bei komplexen Problemlagen und Handlungsbedarf von mehreren Personen, Einrichtungen und/oder Diensten angewendet. Die Aufgabe des Case Managers ist hierbei die Steuerung und Koordination der verschiedenen Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hinweg. Je nach Programm variiert die Intensität in welcher der Case Manager selbst mit dem Klienten arbeitet bzw. ihn an andere Stellen vermittelt.
Case Management hat immer die Aufgabe, Desintegration und Diskontinuität zu vermeiden. Es soll sichergestellt werden, dass die Klienten zu allen nötigen Leistungen Zugang bekommen und dass Leistungserbringer aufeinander abgestimmt anstatt kurzfristig und episodenhaft handeln. Auch durch Medikalisierung (im vielen Bereichen entsprechend Psychologisierung oder Pädagogisierung) und Ökonomisierung ist Case Management beeinflusst. Während ersterem entgegengesteuert werden soll, hat letzteres, durch Innovationsdruck, die Verbreitung von Case Management eher gefördert. Gerade bei der Arbeit mit hochbelasteten Klientengruppen – dazu zählen beispielsweise Suchtkranke mit einer weiteren psychischen Erkrankung oder chronisch Mehrfachabhängige – hat sich Case Management, wie Studien belegen, bewährt.
Inhaltsverzeichnis
- Case Management in der Suchthilfe (Identifikation)
- Case Management – Ein Überblick
- Ziel und Aufgaben
- Die Entwicklung von Case Management
- Der Case Management Regelkreis
- Die Phase der Identifikation
- Theoretische Grundlagen
- Outreach
- Access
- Intake
- Das (imaginäre) Projekt
- Zielgruppe und Motivation
- Methoden und Herangehensweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Identifikationsphase im Case Management-Regelkreis, insbesondere im Kontext der Suchtkrankenhilfe. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der Identifikation von Klienten im Rahmen eines Case Management-Programms zu beleuchten und die spezifischen Herausforderungen in der Arbeit mit komplexen Patientengruppen zu verdeutlichen.
- Definition und Bedeutung von Case Management in der Suchthilfe
- Die Rolle der Identifikation im Case Management-Regelkreis
- Die drei Funktionen der Identifikationsphase: Outreach, Access und Intake
- Die Besonderheiten der Identifikation von Klienten mit Mehrfachproblemlagen
- Die Umsetzung der Identifikationsphase in einem konkreten (imaginären) Projekt
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil des Essays beleuchtet die generelle Bedeutung von Case Management in der Suchthilfe, skizziert die historische Entwicklung des Ansatzes und erläutert den Case Management-Regelkreis mit seinen sechs Stufen. Dabei werden die verschiedenen Aufgaben und Ziele von Case Managern hervorgehoben.
- Der zweite Teil widmet sich ausführlich der Identifikationsphase im Case Management-Regelkreis. Die theoretischen Grundlagen der drei Funktionen Outreach, Access und Intake werden erläutert und die jeweiligen Herausforderungen im Detail dargestellt.
- Im dritten Teil wird ein (imaginäres) Projekt zur Suchtkrankenhilfe vorgestellt, auf das sich die Diskussion der Identifikationsphase bezieht. Die Zielgruppe des Projekts, die Motivation und die methodische Herangehensweise werden kurz erläutert.
Schlüsselwörter
Case Management, Suchthilfe, Identifikation, Outreach, Access, Intake, Mehrfachproblemlagen, komplexe Patientengruppen, Zielgruppe, Suchtkrankenhilfe, psychische Erkrankung, Interventionstechniken, Regelkreis, Bedarfserhebung, Versorgungsplan, Evaluation, Projekt, Modellprojekte.
- Citation du texte
- Diplom-Sozialpädagogin (FH) Nina Braun (Auteur), 2005, Case Management in der Suchthilfe (Identifikation), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68187