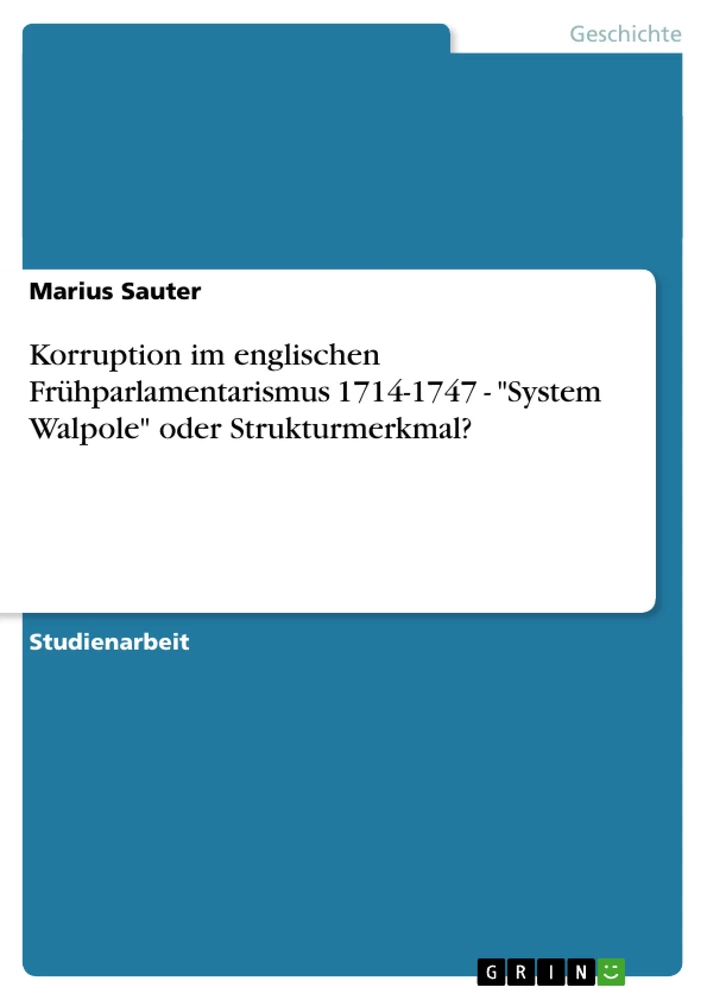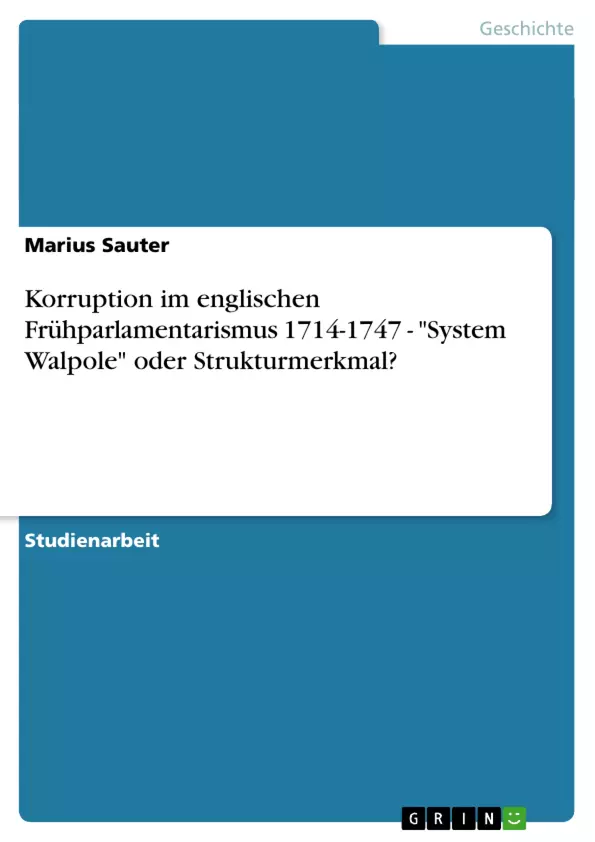Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, welche Rolle Korruption und die Debatten um Korruptionsvorwürfe im englischen Frühparlamentarismus der Ära Walpoles spielte, wobei der Fokus dabei insbesondere auf dem Zeitraum 1714-1742 liegt. Dazu soll unter anderem die These von Christine LANDFRIED überprüft werden, nach der aus dem Fehlen eines ausgeprägten Parteiensystems und der Notwendigkeit parlamentarischer Mehrheiten für die Regierungsfähigkeit des von der Krone berufenen Kabinetts ein ausgeprägtes Patronagewesen und systematische Bestechung von Parlamentariern resultierte. Es stellt sich also die Frage, inwieweit Korruption und korrupte Praktiken systemimmanente Phänomene sind; ob die Handlungsweise Walpoles lediglich Notwendigkeiten des politischen Systems widerspiegeln. Unter dem Begriff „politisches System“ soll in der vorliegenden Untersuchung die englische Verfassun dieser Zeit, sowie die politische Landschaft der Zeit von 1714-1742 verstanden werden. Neben der parlamentarischen Dimension dieser These soll hier auch die Rolle der Korruption und Patronage auf Wahlkreisebene mit in den Blick einbezogen werden, denn ohne diese Betrachtung würde sonst ein wichtiges, wenn nicht gar konstitutives Element des Einflusses der Krone auf die Politik vernachlässigt werden. Um die Rahmenbedingungen des politischen Handelns in der Zeit Walpoles zu verstehen soll einleitend das politische System Englands im frühen 18. Jahrhundert erläutert werden. Dabei sollen die Verfassung und die wichtigsten politischen Institutionen, deren Funktionen und Bezug zueinander, erklärt werden.
Das Verständnis der Parteiinteressen und Parteienkonflikte zwischen Whigs und Tories, sowie die gegensätzlichen Interessen von ländlicher und höfischer bzw. städtischer Elite ist grundlegend, um politisches Verhalten in dieser Zeit verstehen zu können. Deswegen richtet sich der Blick im Folgenden auf die politische Landschaft dieser Zeit. Dazu sollen diese Gruppierungen (es handelt sich trotz der Bezeichnung „Party“ nicht um Parteien im heutigen Sinne) kurz vorgestellt und die Geschichte des Parteienstreits kurz skizziert werden. Auch die vermeintliche Herausbildung einer „Courtpartei“ durch Walpoles Betreiben, sowie die Bemühungen Bolingbrokes dieser die gebündelten Interessen einer „Countrypartei“ entgegenzusetzen, sollen hier im Kontext des Parteienstreits und der daraus resultierenden Korruptionsbezichtigungen durch die Opposition betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das politische System Englands im frühen 18. Jahrhundert
- III. „The Rage of Party“? - Whigs, Tories, Court und Country
- IV. Korruption und Patronage in der Ära Walpole
- V. Korruptionsvorwürfe als Symptom des Parteienkonflikts?
- VI. Korruption als systembedingte Erscheinung oder Zeichen des Niedergangs der politischen Tugend?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Korruption und den damit verbundenen Debatten im englischen Frühparlamentarismus während der Ära Walpoles (1714-1742). Im Fokus steht die Frage, ob Korruption ein systemimmanentes Phänomen war oder ein Zeichen des Niedergangs politischer Tugend. Die Arbeit prüft die These, dass das Fehlen eines ausgeprägten Parteiensystems und der Bedarf an parlamentarischen Mehrheiten zu Patronage und Bestechung führten.
- Das politische System Englands im frühen 18. Jahrhundert
- Parteienkonflikte zwischen Whigs und Tories
- Korruption und Patronage unter Walpole
- Korruptionsvorwürfe als Ausdruck des Parteienkonflikts
- Korruption als systembedingtes Phänomen oder Zeichen des moralischen Verfalls
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle von Korruption im englischen Frühparlamentarismus während der Ära Walpoles. Sie benennt die These von Christine Landfried, wonach das Fehlen eines ausgeprägten Parteiensystems zu systematischer Bestechung führte, und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die die englische Verfassung und die politische Landschaft dieser Zeit berücksichtigt. Der Einfluss von Sir Robert Walpole, dessen Politik von seinen Gegnern als korrupt bezeichnet wurde, trotz gleichzeitig anerkannter Fähigkeiten, bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit, den Korruptionsbegriff im zeitgenössischen Kontext zu verstehen und analysieren.
II. Das politische System Englands im frühen 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt das politische System Englands im frühen 18. Jahrhundert, einschließlich der Verfassung und der wichtigsten politischen Institutionen. Es analysiert deren Funktionen und gegenseitige Beziehungen und legt damit die Grundlage für das Verständnis des politischen Handelns in der Ära Walpoles. Die Abwesenheit einer schriftlich fixierten Verfassung wird thematisiert, und die Besonderheiten des englischen Regierungssystems werden herausgearbeitet, um den Kontext für die folgenden Kapitel zu schaffen. Die Beschreibung der politischen Strukturen dient als essentieller Hintergrund für die Analyse der Korruptionsvorwürfe und -praktiken.
III. „The Rage of Party“? - Whigs, Tories, Court und Country: Dieses Kapitel analysiert die Parteienkonflikte zwischen Whigs und Tories im frühen 18. Jahrhundert, einschliesslich der Rolle der Korruption und Patronage auf Wahlkreisebene. Es untersucht die Interessen der verschiedenen politischen Gruppen, einschließlich der „Courtpartei“ unter Walpole und der gegnerischen „Countrypartei“. Die Beschreibung der komplexen Dynamiken zwischen diesen Gruppen ist essentiell, um das Verständnis der politischen Motivationen und Strategien im Kontext der Korruptionsvorwürfe zu erweitern. Das Kapitel verdeutlicht, wie die Parteienkonflikte die Debatte über Korruption und die Interpretation von politischen Praktiken beeinflussten.
IV. Korruption und Patronage in der Ära Walpole: Dieses Kapitel beleuchtet Walpoles politische Strategien und die Mechanismen der Majoritätenbildung im Parlament. Es analysiert die Praktiken, die bei der Opposition zu Korruptionsvorwürfen führten und die Entstehung einer öffentlichen Verfassungsdiskussion in Zeitungen wie dem Craftsman zur Folge hatten. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Walpoles Politik, seinen Methoden der Machtsicherung und der Reaktion seiner Gegner, die seine Handlungen als korrupt bezeichneten. Die Analyse der Mechanismen der Majoritätenbildung deckt auf, wie Walpoles Politik von seinen Kritikern beurteilt und als korrupt dargestellt wurde.
V. Korruptionsvorwürfe als Symptom des Parteienkonflikts?: Das Kapitel untersucht die Verfassungsdiskussion und deren Implikationen für die Debatte um den Korruptionsbegriff. Es analysiert die These von Hermann Wellenreuther, wonach die Debatte unterschiedlichen Verfassungskonzeptionen und Gesellschaftsmodellen entspringt. Die Analyse zielt darauf ab, die Kontinuität des Parteienstreits nach 1714 nachzuweisen und dessen Bedeutung für die politische Stabilität der Ära Walpole zu verdeutlichen. Die Verbindung zwischen Parteienkonflikt und Korruptionsvorwürfen wird hergestellt und analysiert, um die politischen Realitäten dieser Zeit umfassender zu verstehen.
Schlüsselwörter
Frühparlamentarismus, England, Sir Robert Walpole, Korruption, Patronage, Whigs, Tories, Parteienkonflikt, Verfassungsgeschichte, politische Stabilität, Majoritätenbildung, Verfassungsdebatte, normativer Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Korruption und Parteienkonflikt im englischen Frühparlamentarismus während der Ära Walpoles
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Korruption und den damit verbundenen Debatten im englischen Frühparlamentarismus (1714-1742) während der Ära Walpoles. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Korruption ein systemimmanentes Phänomen oder ein Zeichen des Niedergangs politischer Tugend war. Die These wird geprüft, dass das Fehlen eines ausgeprägten Parteiensystems und der Bedarf an parlamentarischen Mehrheiten zu Patronage und Bestechung führten.
Welche Aspekte des englischen politischen Systems werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das politische System Englands im frühen 18. Jahrhundert, inklusive seiner Verfassung und wichtigsten Institutionen. Sie analysiert deren Funktionen und Beziehungen, um das politische Handeln in der Ära Walpoles zu verstehen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abwesenheit einer schriftlich fixierten Verfassung und den Besonderheiten des englischen Regierungssystems.
Welche Rolle spielten die Parteien Whigs und Tories?
Die Arbeit analysiert die Parteienkonflikte zwischen Whigs und Tories, inklusive der Rolle von Korruption und Patronage auf Wahlkreisebene. Sie untersucht die Interessen der verschiedenen politischen Gruppen, insbesondere der „Courtpartei“ unter Walpole und der gegnerischen „Countrypartei“. Die komplexen Dynamiken zwischen diesen Gruppen werden im Kontext der Korruptionsvorwürfe beleuchtet.
Wie wird die Politik Sir Robert Walpoles dargestellt?
Die Arbeit analysiert Walpoles politische Strategien und Mechanismen der Majoritätenbildung im Parlament. Sie untersucht Praktiken, die bei der Opposition zu Korruptionsvorwürfen führten und die Entstehung einer öffentlichen Verfassungsdiskussion in Zeitungen wie dem Craftsman zur Folge hatten. Der Fokus liegt auf Walpoles Politik, seinen Methoden der Machtsicherung und der Reaktion seiner Gegner.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Korruptionsvorwürfen und Parteienkonflikt dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Verfassungsdiskussion und deren Implikationen für den Korruptionsbegriff. Sie analysiert die These, dass die Debatte unterschiedlichen Verfassungskonzeptionen und Gesellschaftsmodellen entspringt. Die Verbindung zwischen Parteienkonflikt und Korruptionsvorwürfen wird hergestellt und analysiert, um die politischen Realitäten dieser Zeit umfassender zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frühparlamentarismus, England, Sir Robert Walpole, Korruption, Patronage, Whigs, Tories, Parteienkonflikt, Verfassungsgeschichte, politische Stabilität, Majoritätenbildung, Verfassungsdebatte, normativer Kontext.
Welche Kapitel enthält die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsfrage), Das politische System Englands im frühen 18. Jahrhundert (Beschreibung des politischen Systems), „The Rage of Party“? - Whigs, Tories, Court und Country (Analyse der Parteienkonflikte), Korruption und Patronage in der Ära Walpole (Walpoles Politik und Korruptionsvorwürfe), Korruptionsvorwürfe als Symptom des Parteienkonflikts? (Verfassungsdiskussion und Korruptionsbegriff).
Welche These wird in der Arbeit geprüft?
Die Arbeit prüft die These, dass das Fehlen eines ausgeprägten Parteiensystems und der Bedarf an parlamentarischen Mehrheiten zu Patronage und Bestechung im englischen Frühparlamentarismus während der Ära Walpoles führten.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit berücksichtigt die englische Verfassung und die politische Landschaft der Zeit. Sie analysiert die zeitgenössischen Quellen und die Debatten um den Korruptionsbegriff. Die genaue methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung detaillierter beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der Geschichte, insbesondere der englischen Verfassungsgeschichte und der Geschichte des Frühparlamentarismus. Sie ist auch von Interesse für alle, die sich für die Geschichte der politischen Korruption und der Entwicklung von Parteiensystemen interessieren.
- Citation du texte
- Marius Sauter (Auteur), 2006, Korruption im englischen Frühparlamentarismus 1714-1747 - "System Walpole" oder Strukturmerkmal?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68669