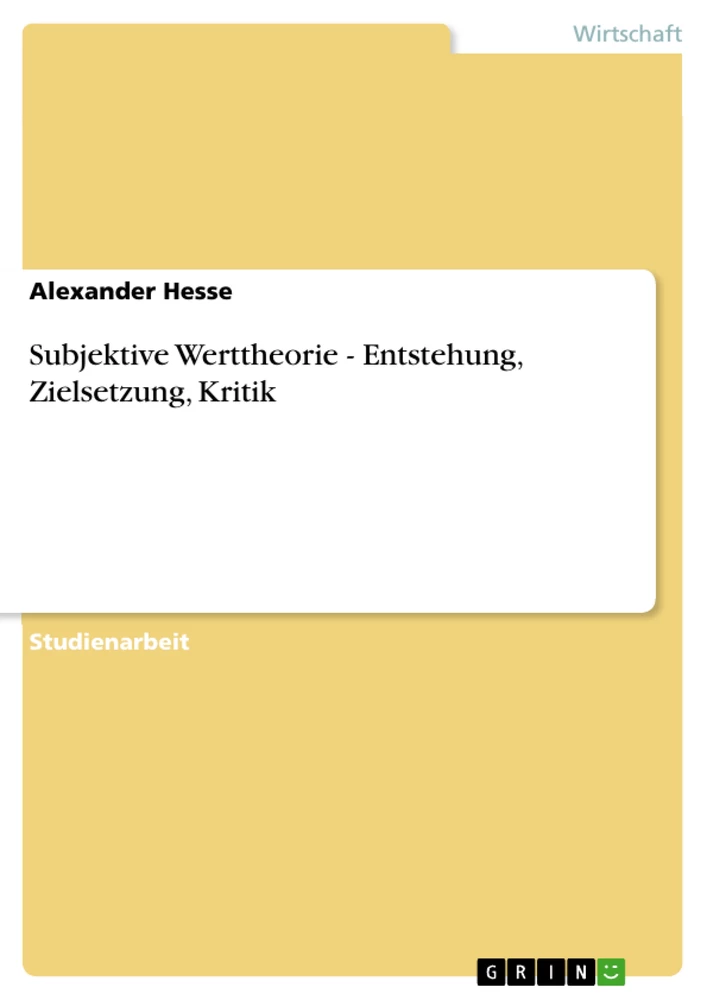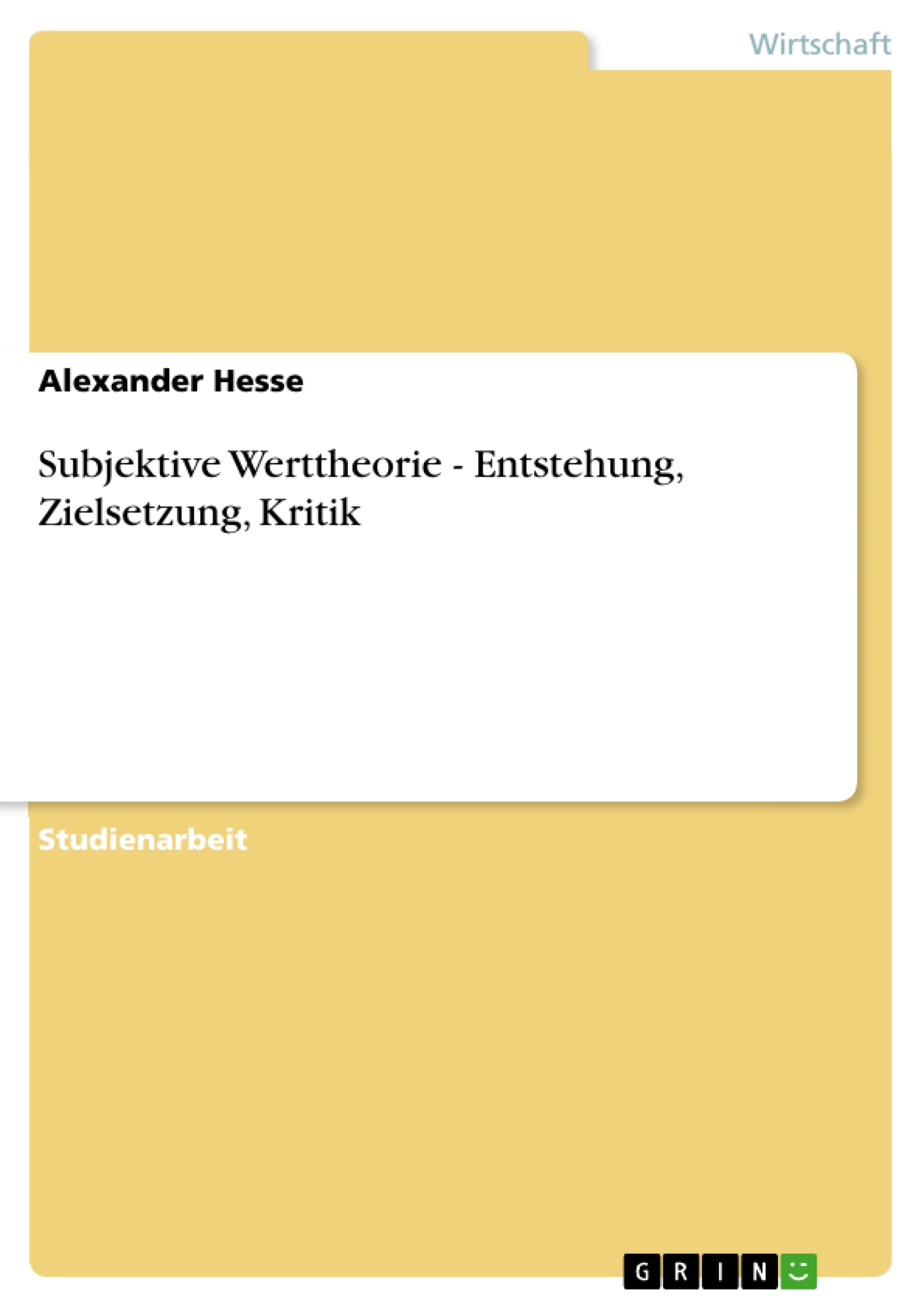Ob privat oder in der beruflichen Sphäre - hinter nahezu jedem, uns täglich begegnenden Sachverhalt verbirgt sich regelmäßig ein Wert. Nicht selten unterscheidet sich dabei die Bewertung eines Gutes oder einer Ware intersubjektiv. Je seltener ein Produkt ist, desto mehr Wert wird ihm beigemessen; oft also bestimmt die Seltenheit den Wert eines Produktes wesentlich mit. Man mag dabei bspw. an das Gemälde der Mona Lisa denken, welches zwar objektiv gesehen tatsächlich einen bestimmten Wert hat, für den einzelnen aber - also subjektiv durchaus wertlos sein kann. Darüber hinaus bestimmt m.E. die Dringlichkeit des Bedarfs deren Wert: dem Bettler wird ein Kanten Brot naturgemäß mehr wert sein als dem Vorstandsvorsitzenden eines namhaften Unternehmens.
Im Rahmen dieser Arbeit soll die subjektive Werttheorie aus volkswirtschaftlicher Sicht näher beleuchtet werden. Dazu werden zunächst die Begrifflichkeiten abgegrenzt, um eine grobe Orientierung der Thematik zu gewährleisten (Kapitel 2). Anschließend wird auf den Entstehungshintergrund der subjektiven Werttheorie einzugehen sein, wobei zunächst die Theorien angesprochen werden, die dieser vorausgegangen sind (Kapitel 3). Das folgende Kapitel behandelt dann die Zielsetzung der subjektiven Werttheorie (Kapitel 4), bevor die Thematik abschließend gewürdigt wird (Kapitel 5). Der Aufsatz endet sodann mit einem kurzen Fazit (Kapitel 6).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsabgrenzungen
- 2.1. Subjektivität
- 2.2. Wert
- 3. Zur Entstehung der subjektiven Werttheorie
- 3.1. Vorgeschichte
- 3.2. Entstehung der subjektiven Werttheorie
- 4. Zielsetzung der subjektiven Werttheorie
- 5. Kritik an der subjektiven Werttheorie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der subjektiven Werttheorie aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Ziel ist es, die Entstehung, die Zielsetzung und die Kritik dieser Theorie zu beleuchten. Die Arbeit gliedert sich in eine Begriffsabgrenzung, die historische Einordnung der Theorie, die Darstellung ihrer Zielsetzung und eine kritische Würdigung.
- Entstehung der subjektiven Werttheorie und ihre Vorläufer
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Subjektivität und Wert
- Zentrale Argumente und Zielsetzungen der subjektiven Werttheorie
- Hauptkritikpunkte an der subjektiven Werttheorie
- Volkswirtschaftliche Relevanz der subjektiven Werttheorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die allgegenwärtige Rolle von Wert in privaten und beruflichen Kontexten. Sie hebt die intersubjektive Variabilität der Bewertung von Gütern hervor und illustriert dies am Beispiel der Mona Lisa und des Wertes eines Brotes für einen Bettler im Vergleich zu einem Vorstandsvorsitzenden. Die Arbeit kündigt die Struktur an: Begriffsabgrenzung, Entstehungshintergrund, Zielsetzung und Kritik der subjektiven Werttheorie, gefolgt von einem Fazit.
2. Begriffsabgrenzungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Subjektivität" und "Wert". Subjektivität wird als individuelle Wahrnehmung beschrieben, die von Person zu Person unterschiedlich sein kann, beeinflusst von Vorurteilen, Gefühlen und Interessen. Der Begriff "Wert" wird als Beitrag eines Produkts zur Bedürfnisbefriedigung eines Individuums erklärt, wobei er sowohl monetär als auch nicht-monetär sein kann und objektive sowie subjektive Ausprägungen aufweist. Der Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Wertschätzung wird anhand des Beispiels eines Unfallwagens verdeutlicht, wobei der objektive Restwert durch Gutachter und der subjektive Wert für den Eigentümer unterschiedlich sein können.
3. Zur Entstehung der subjektiven Werttheorie: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung der subjektiven Werttheorie, beginnend mit einer Betrachtung der vorangegangenen Theorien. Es beleuchtet die historischen und theoretischen Entwicklungen, die zur Herausbildung der subjektiven Werttheorie führten. Der Fokus liegt auf den intellektuellen Strömungen und den Schlüsselfiguren, die die Entwicklung dieser Theorie maßgeblich beeinflusst haben. Die Darstellung beinhaltet sowohl eine chronologische Abfolge der wichtigsten Entwicklungsschritte als auch eine Analyse der jeweiligen Argumentationen.
4. Zielsetzung der subjektiven Werttheorie: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele und Absichten der subjektiven Werttheorie. Es erläutert, welche Fragen die Theorie beantworten möchte und welche Erkenntnisse sie zu liefern versucht. Der Fokus liegt auf der zentralen These der Theorie und ihrer Implikationen für das ökonomische Denken. Das Kapitel wird die Grundprinzipien der subjektiven Werttheorie darlegen und deren Begründungen erläutern. Es analysiert die spezifischen Beiträge dieser Theorie zum Verständnis von Wertbildungsprozessen.
5. Kritik an der subjektiven Werttheorie: Dieses Kapitel präsentiert die Kritikpunkte an der subjektiven Werttheorie. Es analysiert die Schwächen und Grenzen der Theorie und setzt sie in Bezug zu anderen ökonomischen Theorien. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den Annahmen, den Schlussfolgerungen und den empirischen Belegen der Theorie. Das Kapitel diskutiert die verschiedenen Einwände und Kontroversen, die im Laufe der Zeit im Zusammenhang mit der subjektiven Werttheorie aufgeworfen wurden.
Schlüsselwörter
Subjektive Werttheorie, Wert, Subjektivität, Bedürfnisbefriedigung, Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomie, Kritik, Entstehung, Zielsetzung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Subjektive Werttheorie
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit der subjektiven Werttheorie aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Sie untersucht die Entstehung, die Zielsetzung und die Kritik dieser Theorie. Die Arbeit gliedert sich in eine Begriffsabgrenzung, die historische Einordnung der Theorie, die Darstellung ihrer Zielsetzung und eine kritische Würdigung. Sie beinhaltet Einleitung, Begriffsdefinitionen (Subjektivität und Wert), die Entstehung der Theorie mit ihren Vorläufern, die Zielsetzung der Theorie, Kritikpunkte an der Theorie und ein abschließendes Fazit.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert die zentralen Begriffe "Subjektivität" als individuelle, von Person zu Person unterschiedliche Wahrnehmung, beeinflusst von Vorurteilen, Gefühlen und Interessen, und "Wert" als den Beitrag eines Produkts zur Bedürfnisbefriedigung eines Individuums, der monetär oder nicht-monetär sein kann und sowohl objektive als auch subjektive Ausprägungen aufweist.
Wie wird die Entstehung der subjektiven Werttheorie dargestellt?
Die Entstehung der subjektiven Werttheorie wird chronologisch und analytisch dargestellt, beginnend mit einer Betrachtung vorangegangener Theorien. Die Arbeit beleuchtet die historischen und theoretischen Entwicklungen, die Schlüsselfiguren und die intellektuellen Strömungen, die die Entwicklung maßgeblich beeinflusst haben.
Welche Zielsetzung verfolgt die subjektive Werttheorie?
Die Arbeit erläutert die Ziele und Absichten der subjektiven Werttheorie, welche Fragen sie beantworten möchte und welche Erkenntnisse sie liefern will. Der Fokus liegt auf der zentralen These der Theorie und ihren Implikationen für das ökonomische Denken. Die Grundprinzipien und deren Begründungen sowie die spezifischen Beiträge zum Verständnis von Wertbildungsprozessen werden dargestellt.
Welche Kritikpunkte an der subjektiven Werttheorie werden behandelt?
Die Arbeit präsentiert die Kritikpunkte an der subjektiven Werttheorie, analysiert ihre Schwächen und Grenzen und setzt sie in Bezug zu anderen ökonomischen Theorien. Es werden die Annahmen, Schlussfolgerungen und empirischen Belege kritisch diskutiert, inklusive der Einwände und Kontroversen im Zusammenhang mit der Theorie.
Welche Kapitel enthält die Seminararbeit?
Die Seminararbeit enthält folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsabgrenzungen (Subjektivität und Wert), Zur Entstehung der subjektiven Werttheorie, Zielsetzung der subjektiven Werttheorie, Kritik an der subjektiven Werttheorie und Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Subjektive Werttheorie, Wert, Subjektivität, Bedürfnisbefriedigung, Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomie, Kritik, Entstehung, Zielsetzung.
Welche Beispiele werden verwendet, um die Theorie zu erläutern?
Die Arbeit verwendet Beispiele wie den Wert der Mona Lisa im Vergleich zum Wert eines Brotes für einen Bettler und einen Vorstandsvorsitzenden, sowie den Vergleich des objektiven Restwerts eines Unfallwagens (durch Gutachter ermittelt) mit dem subjektiven Wert für den Eigentümer, um die Konzepte von Subjektivität und Wert zu veranschaulichen.
- Citation du texte
- Dipl.-Kfm. Alexander Hesse (Auteur), 2006, Subjektive Werttheorie - Entstehung, Zielsetzung, Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69395