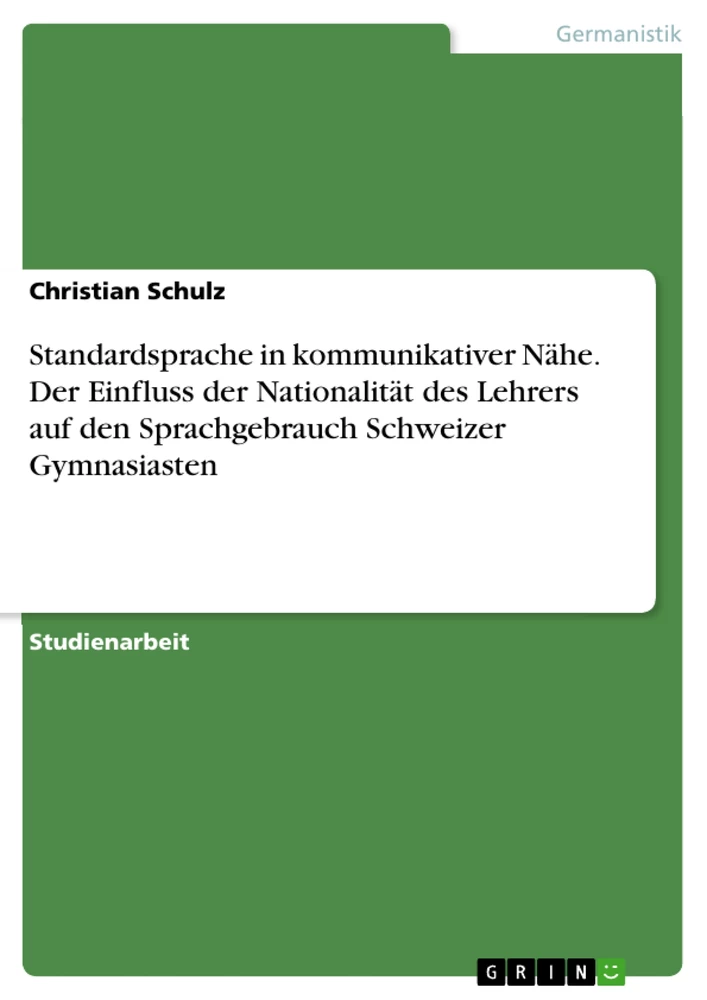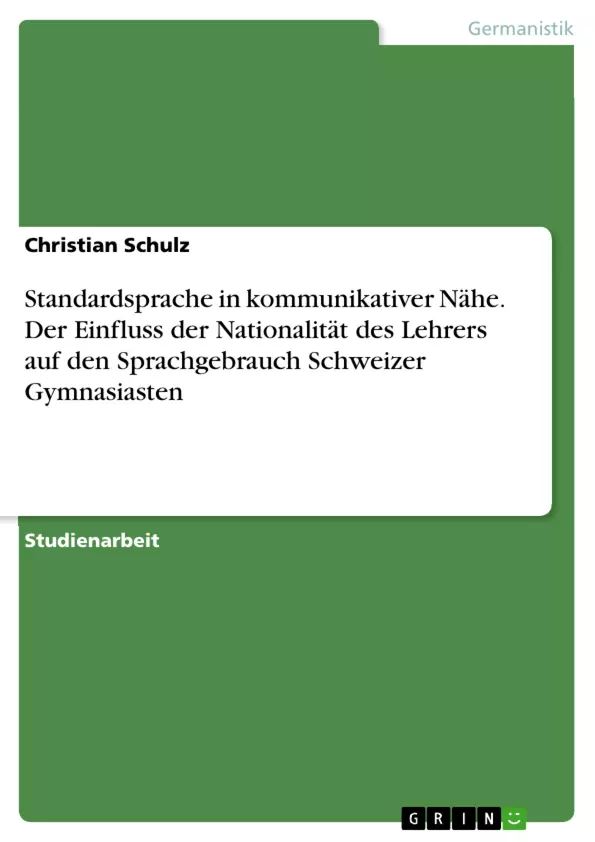Bei welchen kommunikativen Funktionen des Dialektgebrauchs auf der Schülerseite nach Kropf und Steiner lassen sich im Schweizer Gymnasialunterricht standardsprachliche Tendenzen feststellen, wenn die Lehrperson aus Deutschland stammt und fast ausschliesslich bundesdeutsches Hochdeutsch mit norddeutscher Färbung spricht? In einem ersten Schritt sollen die bisherigen relevanten Studien zum Varietätengebrauch im Schweizer Gymnasium kurz vorgestellt werden. Daraufhin wird die methodische Vorgehensweise dieser Arbeit dargelegt und anschliessend erfolgt die Analyse verschiedener Transkriptionen aus vier Unterrichtsstunden an einem Zürcher Gymnasium hinsichtlich kommunikativer Funktionen. Zum Schluss wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus dieser Untersuchung aufgestellt.
Kantonale und schulische Vorgaben bezüglich der kommunikativen Gestaltung des Unterrichts weisen in der Regel einen offensichtlichen Widerspruch zur Handhabung in der realen Unterrichtssituation auf. Dass sowohl die Schweizer Standardsprache, als auch der Dialekt, immer noch beide ihren festen Platz im dynamischen Varietätenverhältnis Schweizer Schulen haben, steht nach Werlens Analyse der hiesigen Sprachenlandschaft außer Frage. Zudem haben Kropf und Steiner in ihren Untersuchungen festgestellt, dass die Verwendung des Dialekts von Schülern und Lehrern auch im Unterricht höherer Schulstufen in der Regel dazugehört. Beide gehen davon aus, dass der Dialektgebrauch dort nicht willkürlich, sondern gemäß eines Regelsystems von kommunikativen Funktionen und Sprachrevieren erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bisherige Studien
- 2.1 Einflussfaktoren zu Dialekt und Standardsprache
- 2.2 Dialektgebrauch bei Lehrern in saarländischen Schulen
- 2.3 Kommunikative Relevanz von Dialektäusserungen im Unterricht
- 2.4 Funktionen des Dialektgebrauchs am Gymnasium
- 3 Methodische Vorgehensweise
- 3.1 Audioaufnahmen
- 3.2 Transkription
- 4 Dialektgebrauch bei Gymnasialschülern
- 4.1 Kommunikative Funktionen mit Wechsel zum Dialekt
- 4.1.1 Verständnissicherungsfunktion
- 4.1.2 Einbezugsfunktion
- 4.2 Kommunikative Funktionen mit standardsprachlichen Tendenzen
- 4.2.1 Veranschaulichungsfunktion
- 4.2.2 Einverständnisfunktion
- 4.2.3 Intensivierungsfunktion
- 4.2.4 Korrektur- und Widerspruchsfunktion
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Nationalität des Lehrers auf den Sprachgebrauch Schweizer Gymnasiasten, insbesondere die Verwendung von Dialekt und Standardsprache. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich standardsprachliche Tendenzen im Dialektgebrauch der Schüler zeigen, wenn der Lehrer aus Deutschland stammt und hauptsächlich Hochdeutsch spricht. Die Studie basiert auf der Annahme, dass der Lehrer als Sprachvorbild fungiert.
- Der Einfluss der Lehrperson als Sprachvorbild auf den Schüler.
- Die kommunikativen Funktionen des Dialektgebrauchs bei Schülern.
- Das Verhältnis von Dialekt und Standardsprache im Schweizer Gymnasium.
- Vergleichende Analyse des Dialektgebrauchs mit deutschsprachigen Lehrpersonen im Vergleich zu schweizerdeutschen Lehrpersonen.
- Identifizierung standardsprachlicher Tendenzen im Schülerdialekt.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Widerspruch zwischen kantonalen und schulischen Vorgaben zur Sprachverwendung im Unterricht und der tatsächlichen Praxis. Sie stellt die bestehende Forschungssituation dar, in der bisher vor allem der Einfluss deutschschweizerisch sprechender Lehrer untersucht wurde. Die Arbeit fokussiert auf die Fragestellung, wie sich der Sprachgebrauch von Schülern mit einer aus Deutschland stammenden Lehrperson unterscheidet, die hauptsächlich Hochdeutsch spricht. Die Studie untersucht, welche kommunikativen Funktionen des Dialektgebrauchs auf Schülerseite standardsprachliche Tendenzen aufweisen.
2 Bisherige Studien: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über bisherige Forschungsarbeiten zum Verhältnis von Dialekt und Standardsprache im Schweizer Schulunterricht. Es werden die Studien von Sieber/Sitta (1986), Ramge (1978), Kropf (1986) und Steiner (2008) vorgestellt und deren Ergebnisse bezüglich Einflussfaktoren, kommunikativer Funktionen des Dialektgebrauchs und der Situation an verschiedenen Schulstufen zusammengefasst. Der Mangel an Studien, die sich mit dem Einfluss nicht-schweizerdeutsch sprechender Lehrkräfte befassen, wird hervorgehoben.
3 Methodische Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie. Es wird die Erhebungsmethode (Audioaufnahmen von Unterrichtsstunden) und die Datenanalyse (Transkription und Auswertung der kommunikativen Funktionen des Sprachgebrauchs) detailliert erläutert. Die Auswahl der untersuchten Unterrichtsstunden und die Kriterien zur Analyse werden transparent dargestellt.
4 Dialektgebrauch bei Gymnasialschülern: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Transkriptionen. Es wird untersucht, in welchen kommunikativen Kontexten die Schüler Dialekt verwenden und inwiefern standardsprachliche Tendenzen erkennbar sind. Die Analyse betrachtet verschiedene Funktionen des Dialektgebrauchs, wie Verständnissicherung, Einbezug, Veranschaulichung, Einverständnisbekundung, Intensivierung und Korrektur/Widerspruch, unter dem Einfluss der Hochdeutsch sprechenden Lehrkraft.
Schlüsselwörter
Standardsprache, Dialekt, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Gymnasium, Sprachgebrauch, Schüler, Lehrer, Kommunikation, Varietäten, Kommunikative Funktionen, Sprachvorbild, Unterricht, Transkription, Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Dialektgebrauch Schweizer Gymnasiasten unter dem Einfluss einer deutschsprachigen Lehrkraft
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht den Einfluss einer deutschsprachigen Lehrkraft (die hauptsächlich Hochdeutsch spricht) auf den Sprachgebrauch von Schweizer Gymnasiasten. Der Fokus liegt auf der Verwendung von Dialekt und Standardsprache im Unterricht und den kommunikativen Funktionen des Dialektgebrauchs.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Studie geht folgenden Fragen nach: Inwiefern zeigen sich standardsprachliche Tendenzen im Dialektgebrauch der Schüler? Welche kommunikativen Funktionen erfüllt der Dialektgebrauch der Schüler? Wie wirkt sich die Lehrperson als Sprachvorbild auf den Schüler aus? Wie unterscheidet sich der Dialektgebrauch im Vergleich zu Situationen mit schweizerdeutsch sprechenden Lehrpersonen?
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie basiert auf Audioaufnahmen von Unterrichtsstunden. Die Daten wurden transkribiert und anschließend analysiert, wobei die kommunikativen Funktionen des Sprachgebrauchs im Mittelpunkt standen. Die Auswahl der Unterrichtsstunden und die Kriterien der Analyse werden detailliert beschrieben.
Welche bisherigen Studien wurden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Forschungsarbeiten von Sieber/Sitta (1986), Ramge (1978), Kropf (1986) und Steiner (2008) zum Thema Dialekt und Standardsprache im Schweizer Schulunterricht. Die Lücke an Studien zum Einfluss nicht-schweizerdeutsch sprechender Lehrkräfte wird hervorgehoben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Analyse zeigen, in welchen kommunikativen Kontexten die Schüler Dialekt verwenden und inwiefern standardsprachliche Tendenzen erkennbar sind. Es werden verschiedene Funktionen des Dialektgebrauchs untersucht, wie z.B. Verständnissicherung, Einbezug, Veranschaulichung, Einverständnisbekundung, Intensivierung und Korrektur/Widerspruch, unter dem Einfluss der Hochdeutsch sprechenden Lehrkraft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Standardsprache, Dialekt, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Gymnasium, Sprachgebrauch, Schüler, Lehrer, Kommunikation, Varietäten, Kommunikative Funktionen, Sprachvorbild, Unterricht, Transkription, Analyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu bisherigen Studien, ein Kapitel zur Methodik, ein Kapitel zum Dialektgebrauch der Gymnasiasten und eine Zusammenfassung. Die Einleitung beleuchtet den Widerspruch zwischen kantonalen und schulischen Vorgaben und der Praxis. Das Kapitel zu den bisherigen Studien gibt einen Überblick über die Forschung. Das Methodenkapitel beschreibt die Datenerhebung und -analyse. Das Hauptkapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse des Dialektgebrauchs.
Welche Annahme liegt der Studie zugrunde?
Die Studie basiert auf der Annahme, dass die Lehrperson als Sprachvorbild für die Schüler fungiert.
- Quote paper
- Christian Schulz (Author), 2019, Standardsprache in kommunikativer Nähe. Der Einfluss der Nationalität des Lehrers auf den Sprachgebrauch Schweizer Gymnasiasten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/703374