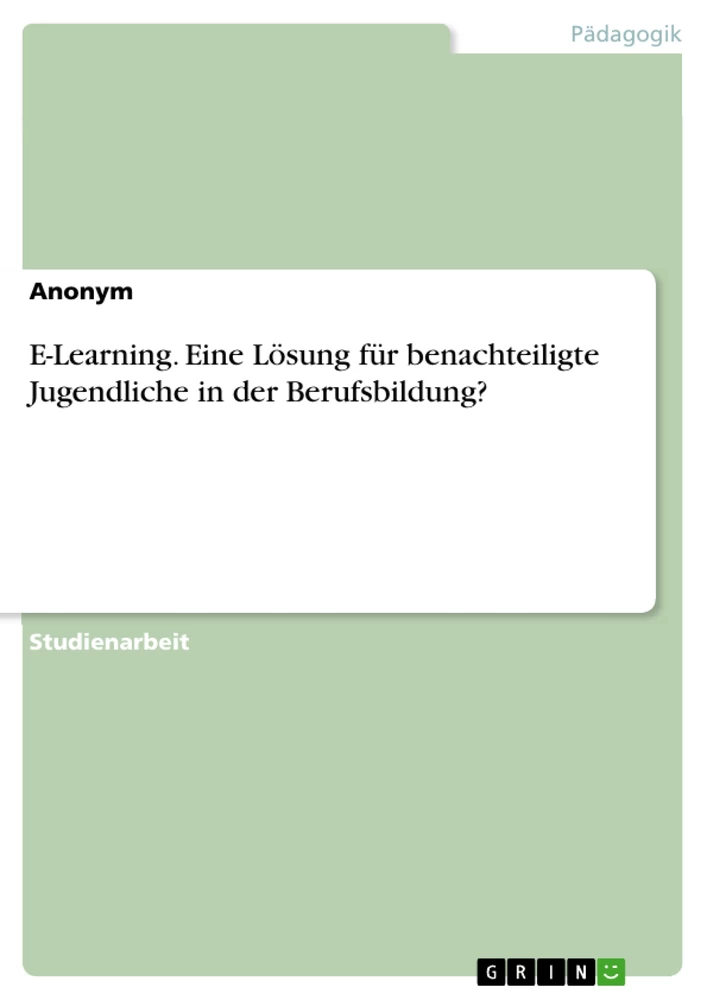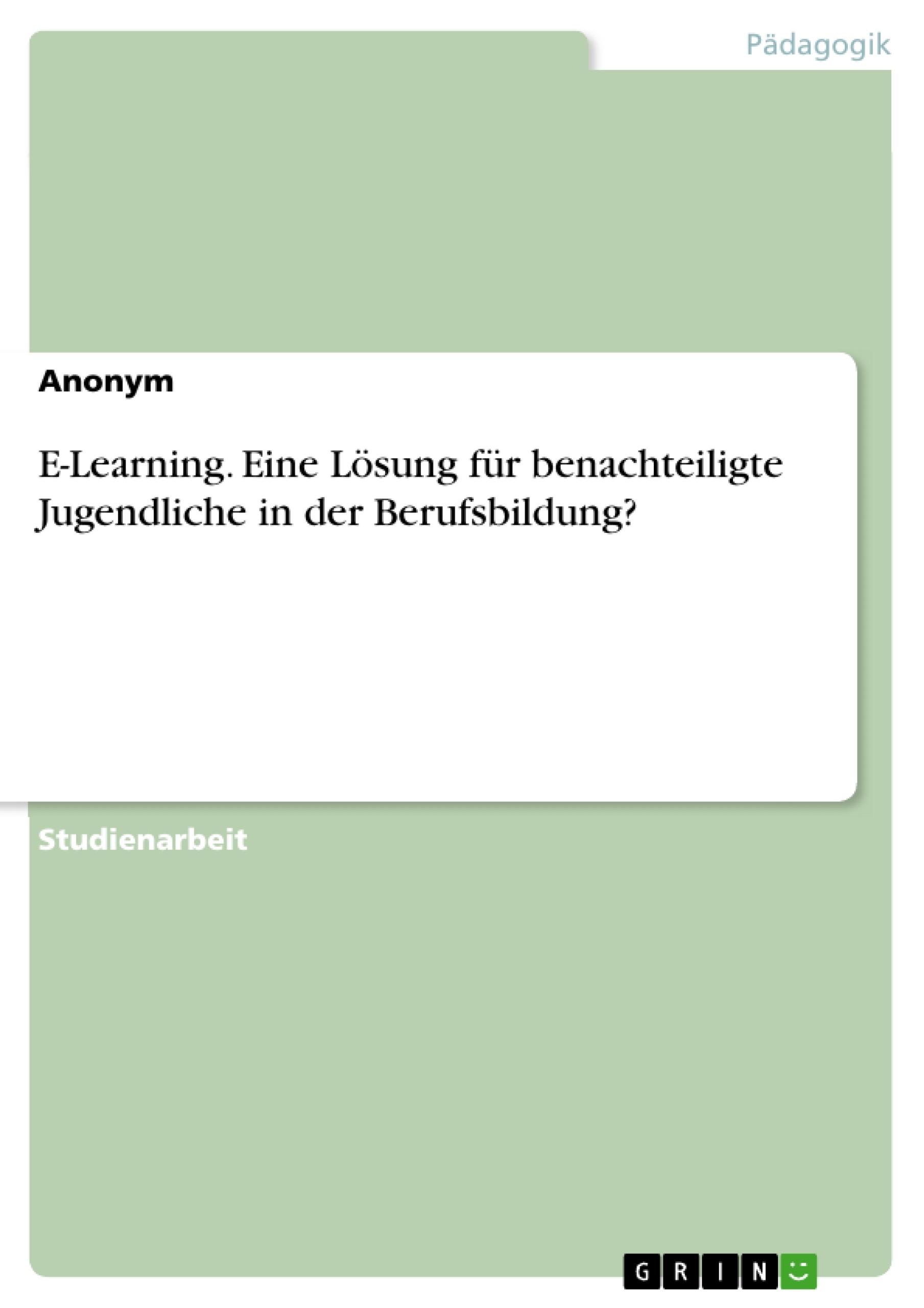Im Rahmen des Seminares „Arbeit, Wirtschaft und Berufsbildungspolitik“ wurden gesellschaftliche Phänomene in der beruflichen Bildung diskutiert und angesprochen, unteranderem die Digitalisierung. Diese hat den Einzug in die berufliche Bildung gefunden, damit einhergehend wird oft der Begriff des E-Learnings assoziiert, welches das elektronische Lernen beschreibt. E-Learning wird an dieser Stelle zum großen Hoffnungsträger gemacht. Es soll die berufliche Weiterbildung für jeden, zu jeder Zeit und an jedem Ort individuell zugänglich machen. In betrieblichen Aus- und Weiterbildungskonzepten werden computergestützte Lernmedien zur Vermittlung von Wissen und zur Unterstützung des Lerntransfers verwendet. Den Teilnehmern wird somit die Möglichkeit geboten sich sicher und erfolgreich in das Berufsleben zu integrieren.
Hinsichtlich der Thematik der vorliegenden Arbeit lautet die Fragestellung:
Wie geeignet ist die Verwendung von E-Learning für benachteiligte Jugendliche in der beruflichen Bildung?
Die Frage wird am Beispiel eines bestimmten Projektes beantwortet. Es handelt sich hierbei um das Projekt „Die Kompetenzwerkst@tt Recycling“, welches von Howe F. und Knutzen S. von 2005 bis 2008 begleitet und ausgewertet wurde. Die Wahl ist auf diese empirische Fallstudie gefallen, da die Studie der genannten Autoren verdeutlicht, wie effektiv und welche Vorteile das E-Learning für die Aus- und Weiterbildung bieten kann. Gerade in der heutigen Zeit kommt dem kompetenzorientierten Unterricht mit einem hohen Maß an Technisierung, insbesondere den elektronischen Lernplattformen, eine besondere Rolle zu. E-Learning gewinnt an Bedeutung, da es mehr als eine Methode ist. Es wird zum wichtigen Element in der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen und prägt das gesamte Bildungskonzept.
Die in dieser Arbeit analysierten Beobachtungsdaten wurden im Rahmen des Forschungsprojekts „Die Kompetenzwerkst@tt“ von Howe F. und Knutzen S. erhoben. Die Daten sind folgendem Buch zu entnehmen: „E-Learning in der Berufsvorbereitung – Arbeitsprozessorientierte softwaregestützte Lehr-Lern-Arrangements für benachteiligte Jugendliche am Beispiel des Elektroschrott- und Kfz-Recyclings“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Thema und Relevanz
- 1.2 Fragestellung und Interessenbekundung
- 1.3 Vorgehen
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2. Diskurs: E-Learning
- 2.1 Geschichte des E-Learnings
- 2.2 Formen des E-Learnings
- 2.3 Handlungskompetenz und Handlungsfähigkeit
- 3. Empirie
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.2 Die Kompetenzwerkst@tt Recycling
- 3.2.1 Die Kompetenzwerkst@tt-Lernsoftware
- 3.2.2 Evaluation
- 4. Würdigung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung von E-Learning für benachteiligte Jugendliche in der beruflichen Bildung. Sie analysiert ein konkretes Projekt, die „Kompetenzwerkst@tt Recycling“, um die Wirksamkeit und Vorteile von E-Learning in diesem Kontext zu beleuchten. Die Arbeit trägt dazu bei, die Rolle von E-Learning in der kompetenzorientierten Berufsausbildung zu verstehen.
- Eignung von E-Learning für benachteiligte Jugendliche
- Analyse des Projekts „Kompetenzwerkst@tt Recycling“
- Wirkung von E-Learning auf berufliche Handlungskompetenz
- Historische Entwicklung und verschiedene Formen des E-Learnings
- Potenziale und Grenzen von E-Learning in der beruflichen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des E-Learnings in der beruflichen Bildung ein, insbesondere im Hinblick auf benachteiligte Jugendliche. Sie definiert die Forschungsfrage, beschreibt die gewählte Methodik (eine Fallstudie basierend auf dem Projekt „Kompetenzwerkst@tt Recycling“) und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Relevanz des Themas wird im Kontext der Digitalisierung und des wachsenden Bedarfs an individueller und flexibler Weiterbildung hervorgehoben.
2. Diskurs: E-Learning: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des E-Learnings. Es beginnt mit einem historischen Überblick, der die Entwicklung vom behavioristischen Ansatz der programmierten Unterweisung bis hin zu modernen adaptiven Lernsystemen nachzeichnet. Weiterhin werden verschiedene Formen des E-Learnings, wie CBT und WBT, vorgestellt und ihre Eigenschaften und Unterschiede erläutert. Der Diskurs schließt mit einer Auseinandersetzung mit Handlungskompetenz und Handlungsfähigkeit im Kontext von E-Learning.
3. Empirie: Das Hauptkapitel präsentiert die empirische Untersuchung des Projekts „Kompetenzwerkst@tt Recycling“. Es beinhaltet eine Definition von „benachteiligten Jugendlichen“ und eine detaillierte Beschreibung des Projekts, einschließlich der verwendeten E-Learning-Software und ihrer Evaluation. Die Ergebnisse der Evaluation werden jedoch nicht im Detail dargestellt, da dies den Umfang einer Vorschau überschreitet.
Schlüsselwörter
E-Learning, benachteiligte Jugendliche, berufliche Bildung, Kompetenzwerkst@tt Recycling, Handlungskompetenz, computergestütztes Lernen, adaptives Lernen, berufliche Weiterbildung, Digitalisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Vorschau: E-Learning für benachteiligte Jugendliche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung von E-Learning für benachteiligte Jugendliche in der beruflichen Bildung. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Projekts „Kompetenzwerkst@tt Recycling“, um die Wirksamkeit und Vorteile von E-Learning in diesem Kontext zu beleuchten. Die Arbeit trägt dazu bei, die Rolle von E-Learning in der kompetenzorientierten Berufsausbildung zu verstehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Eignung von E-Learning für benachteiligte Jugendliche, Analyse des Projekts „Kompetenzwerkst@tt Recycling“, Wirkung von E-Learning auf berufliche Handlungskompetenz, historische Entwicklung und verschiedene Formen des E-Learnings sowie Potenziale und Grenzen von E-Learning in der beruflichen Bildung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Thema, Fragestellung, Methodik, Aufbau), Diskurs: E-Learning (Geschichte, Formen, Handlungskompetenz), Empirie (Begriffsbestimmung, Kompetenzwerkst@tt Recycling, Evaluation), Würdigung und Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und definiert die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des E-Learnings. Das dritte Kapitel präsentiert die empirische Untersuchung des Projekts „Kompetenzwerkst@tt Recycling“. Die Kapitel „Würdigung“ und „Fazit“ fassen die Ergebnisse zusammen und ziehen Schlussfolgerungen.
Was ist die „Kompetenzwerkst@tt Recycling“?
Die „Kompetenzwerkst@tt Recycling“ ist ein konkretes Projekt, das in dieser Arbeit als Fallstudie untersucht wird. Es handelt sich um ein E-Learning-Projekt, das sich an benachteiligte Jugendliche in der beruflichen Bildung richtet. Die Arbeit beschreibt die verwendete Lernsoftware und die Evaluation des Projekts, wobei die detaillierten Ergebnisse der Evaluation aus Gründen des Umfangs in der Vorschau nicht dargestellt werden.
Welche Arten von E-Learning werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Formen des E-Learnings, von der programmierten Unterweisung bis hin zu modernen adaptiven Lernsystemen. Es werden auch die Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Formen wie CBT (Computer Based Training) und WBT (Web Based Training) erläutert.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Fallstudien-Methodik, wobei das Projekt „Kompetenzwerkst@tt Recycling“ im Detail analysiert wird, um die Forschungsfrage zu beantworten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: E-Learning, benachteiligte Jugendliche, berufliche Bildung, Kompetenzwerkst@tt Recycling, Handlungskompetenz, computergestütztes Lernen, adaptives Lernen, berufliche Weiterbildung, Digitalisierung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, E-Learning. Eine Lösung für benachteiligte Jugendliche in der Berufsbildung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704495