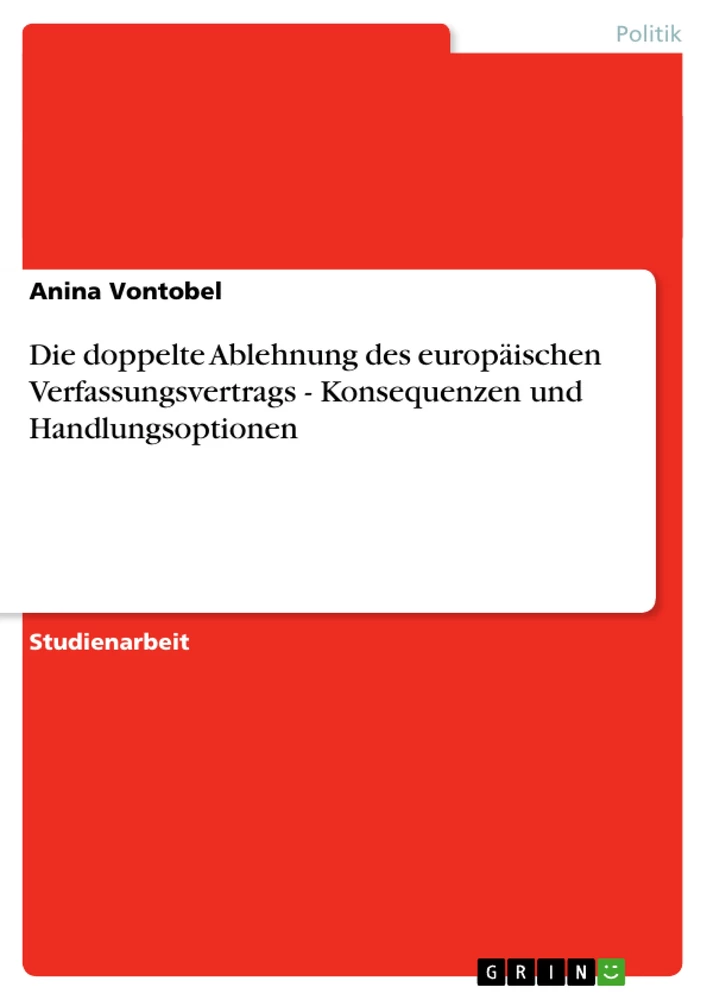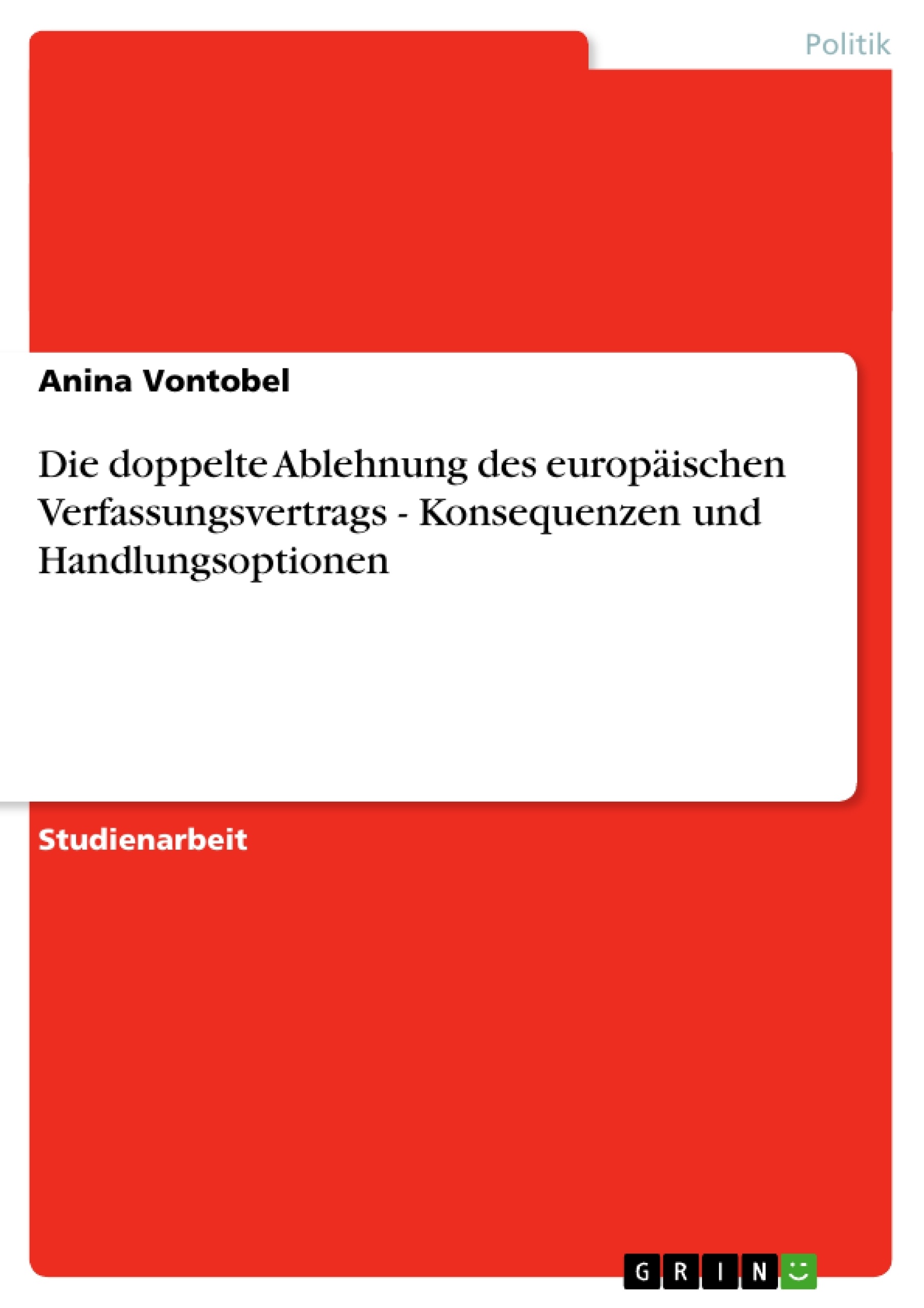Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der 25 EU-Mitgliedsstaaten und der drei Kandidatenländer den Vertrag über eine Verfassung für Europa, den sie am 18. Juni desselben Jahres einstimmig angenommen hatten. Dieser Vertrag tritt jedoch erst in Kraft, wenn er von jedem Unterzeichnerstaat nach dem in seiner Verfassung vorgeschriebenen Verfahren ratifiziert wurde. Je nach juristischer und geschichtlicher Tradition der einzelnen Länder geschieht dies mittels Volksabstimmung oder eines parlamentarischen Verfahrens. Wie in den vielen Diskussionen um die EU-Verfassung oft verwechselt, geht es bei der Europäischen Verfassung nicht darum, die Europäische Union an die Herausforderungen der Ost-Erweiterung anzupassen. Die Motivation hinter der Verfassung ist es, die Kompetenzen und Zuständigkeitsbereiche der EU zu klären, das demokratische Defizit zu mindern und die Legitimität der EU zu sichern sowie deren politische Effizienz zu verbessern 1 . Zum heutigen Zeitpunkt haben bereits dreizehn Mitgliedsstaaten 2 den Verfassungsvertrag ratifiziert. Am 29. Mai beziehungsweise am 1. Juni 2005 lehnten allerdings sowohl Frankreich wie auch die Niederlande den Vertrag in einem Referendum ab, beide mit signifikant hoher Wahlbeteiligung 3 . Über eine mögliche Krise des Ratifizierungsprozesses legt die Verfassung lediglich fest, dass „der Europäische Rat befasst wird, wenn nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung des Vertrags über eine Verfassung für Europa vier Fünftel der Mitgliedstaaten den genannten Vertrag ratifiziert haben und in einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten sind 4 .“ In dieser Arbeit möchte ich mich nun mit den möglichen Alternativen der EU zur Handhabung der momentanen Krise des Ratifizierungsprozesses befassen. Der erste Teil gibt einen Überblick über den Inhalt und die Bestimmungen der Verfassung. Darauf folgt im zweiten Teil eine Analyse der Ablehnung, sowie der möglichen Konsequenzen für die Europäische Union. Anschliessend sollen im dritten Teil dieser Arbeit verschiedene Wege aufgezeigt werden, wie die EU mit der momentanen Krise umgehen könnte oder sollte. Diese Handlungsoptionen werden sowohl vom politischen wie auch vom juristischen Standpunkt aus durchleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kernpunkte des Europäischen Verfassungsvertrags
- Gründe und Konsequenzen der zweifachen Ablehnung der Europäischen Verfassung
- Motive zur Ablehnung des Verfassungsvertrags
- Konsequenzen der Ablehnung
- Alternativen zur Verfassungsratifikation
- Wiederholung des Ratifikationsprozesses in Frankreich und den Niederlanden
- Ausschluss der Nicht-Ratifizierer
- Bildung eines „Kerneuropa“ mit erweiterter Kooperation
- Rosinen aus der Verfassung picken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gründe für die Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrags in Frankreich und den Niederlanden und beleuchtet die möglichen Konsequenzen dieser Ablehnung für die Europäische Union. Sie beschäftigt sich mit alternativen Handlungsoptionen der EU im Umgang mit der aktuellen Krise des Ratifizierungsprozesses, wobei sowohl politische als auch juristische Aspekte betrachtet werden.
- Analyse der Gründe für die Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrags
- Bewertung der möglichen Folgen der Ablehnung für die Europäische Union
- Vorstellung und Diskussion alternativer Handlungsoptionen der EU
- Juristische und politische Betrachtung der Handlungsoptionen
- Bewertung der Auswirkungen der Ablehnung auf das Image der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Europäische Verfassung und die aktuelle Situation des Ratifizierungsprozesses vor, wobei sie den Hintergrund, die Motivation und die Ziele der Verfassung beleuchtet. Sie skizziert die aktuelle Situation des Ratifizierungsprozesses und das Problem der Ablehnung in Frankreich und den Niederlanden.
- Kernpunkte des Europäischen Verfassungsvertrags: Dieses Kapitel erläutert die wichtigsten Inhalte der Europäischen Verfassung, insbesondere die Struktur, die Ziele, die Kompetenzen und die Institutionen der EU. Es beleuchtet die Neuerungen der Verfassung, wie die Einführung des Amtes des Aussenministers, die Stärkung des Europäischen Rates und die Definition der qualifizierten Mehrheit für die Beschlussfassung im Rat.
- Gründe und Konsequenzen der zweifachen Ablehnung der Verfassung: Dieser Abschnitt analysiert die Gründe, warum die Bürger in Frankreich und den Niederlanden gegen die Verfassung gestimmt haben. Er erörtert, wie die EU die Verfassung besser hätte präsentieren und die Zweifel der Bevölkerung hätte beschwichtigen können. Zudem werden die möglichen Konsequenzen der Ablehnung für die Europäische Union, sowohl intern als auch extern, kurz erläutert.
- Alternativen zur Verfassungsratifikation: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Wege, wie die EU mit der aktuellen Krise umgehen könnte oder sollte. Es werden verschiedene Handlungsoptionen diskutiert, wie die Wiederholung des Ratifikationsprozesses, der Ausschluss der Nicht-Ratifizierer, die Bildung eines „Kerneuropa“ oder die selektive Übernahme einzelner Bestimmungen der Verfassung. Jede Option wird aus politischer und juristischer Sicht betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Europäische Verfassung, der Ratifizierungsprozess, die Ablehnung der Verfassung in Frankreich und den Niederlanden, die möglichen Konsequenzen dieser Ablehnung für die Europäische Union und die alternativen Handlungsoptionen, die der EU zur Verfügung stehen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Staaten lehnten den europäischen Verfassungsvertrag ab?
Sowohl Frankreich als auch die Niederlande lehnten den Vertrag im Jahr 2005 in Referenden ab.
Was waren die Hauptziele der geplanten EU-Verfassung?
Ziele waren die Klärung von Kompetenzen, die Minderung des demokratischen Defizits, die Sicherung der Legitimität und die Verbesserung der politischen Effizienz der EU.
Welche Alternativen zur Ratifikation werden in der Arbeit diskutiert?
Diskutiert werden die Wiederholung der Referenden, der Ausschluss von Nicht-Ratifizierern, die Bildung eines „Kerneuropas“ oder das selektive Übernehmen einzelner Bestimmungen.
Welche Neuerungen hätte der Verfassungsvertrag eingeführt?
Vorgesehen waren unter anderem das Amt eines EU-Außenministers und die Neudefinition der qualifizierten Mehrheit im Rat.
Wie sieht die juristische Regelung bei Schwierigkeiten im Ratifizierungsprozess aus?
Der Vertrag legt fest, dass der Europäische Rat befasst wird, wenn nach zwei Jahren vier Fünftel der Staaten ratifiziert haben, aber in einzelnen Ländern Probleme auftreten.
- Citation du texte
- Anina Vontobel (Auteur), 2005, Die doppelte Ablehnung des europäischen Verfassungsvertrags - Konsequenzen und Handlungsoptionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71660