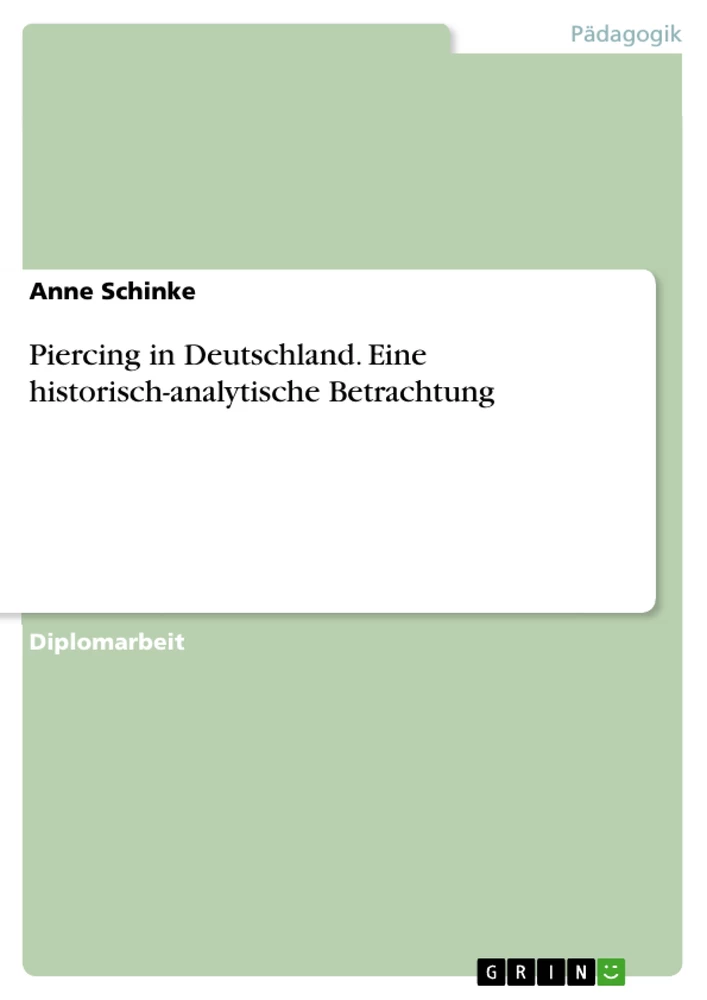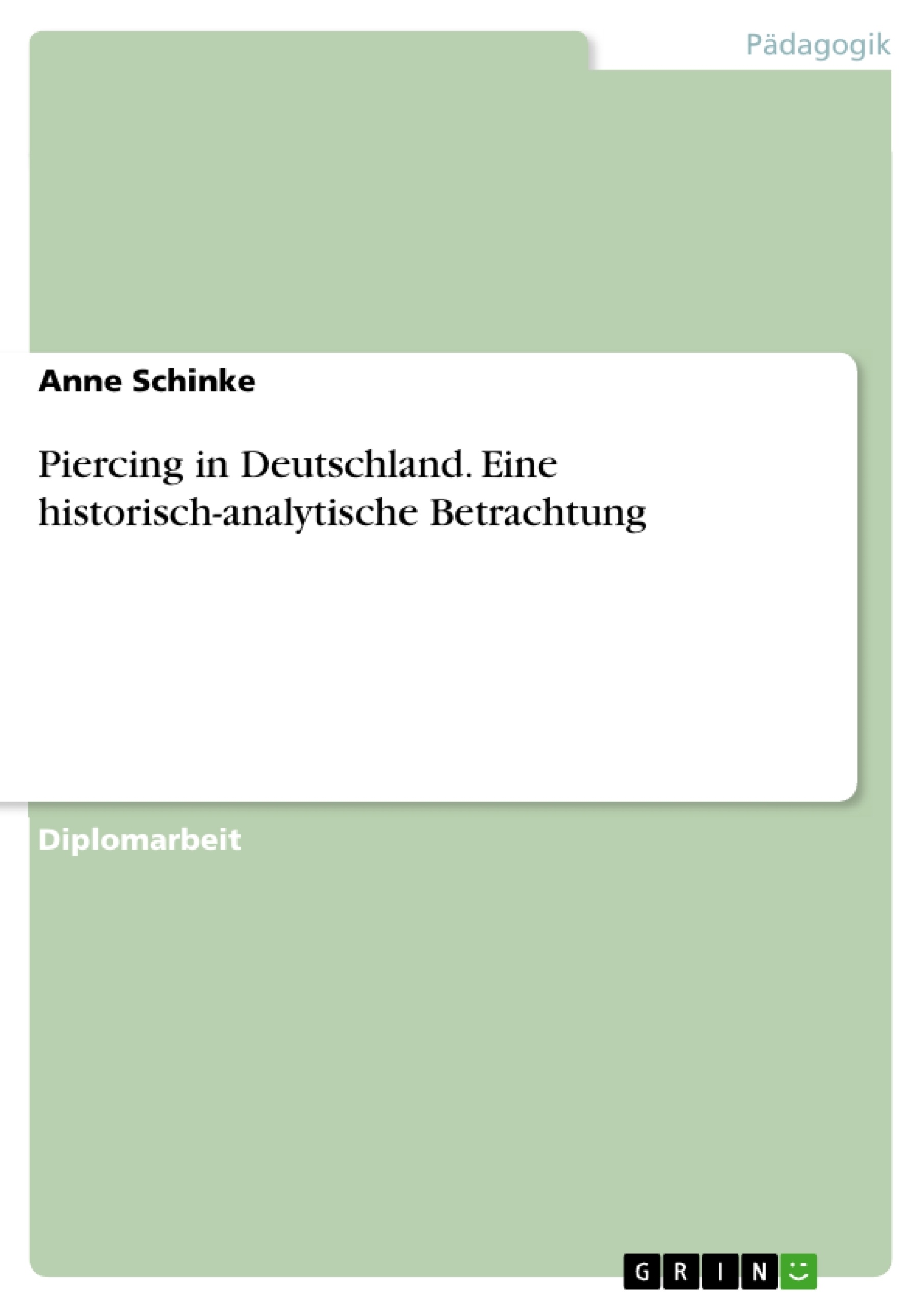Piercing ist in Deutschland hoch aktuell und wird zunehmend zu einem Gegenstand auch der öffentlichen Wahrnehmung. Dies lässt sich an der Zunahme von Berichten in den Medien, an Ausstellungen zum Thema, ergänzenden Vorträgen usw. erkennen. Immer mehr Jugendliche und auch Erwachsene tragen diesen besonderen Körperschmuck. Schon lange ist Piercing kein sicherer Hinweis auf Punks oder „Unterschichtgruppen“ mehr. Selbst bei der Verkäuferin an der Kasse funkelt nicht selten ein kleines Steinchen an der Oberlippe.
Wer sich jedoch für das Phänomen interessiert und sich damit eingehender auseinandersetzen will, findet recht wenig Literatur. Piercing befindet sich, wie der kleine vernachlässigte Bruder, scheinbar im Schatten des Tattoos und wird in der Regel zumeist nebenbei abgehandelt. Volle Aufmerksamkeit erhielt das Piercing erst jetzt: im Rahmen der Gesundheitsreform.
Das Buch der Autorin stellt die historische Entwicklung des Piercings in Deutschland seit Beginn des 20. Jahrhunderts und seinen Weg von der Subkultur zum Modeartikel vor. Warum wurde Piercing so populär? Und in welchen Subkulturen ist es besonders häufig anzutreffen?
Es eröffnet interessante Einblicke insbesondere in die sozialpsychologischen und pathologischen Aspekte des Piercings und setzt sich intensiv mit dem Bereich der nonverbalen Kommunikation auseinander, z.B. unter dem Gesichtspunkt der Inszenierung des Körpers durch Piercing, Selbstdarstellung, Körperzeichen usw.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den pathologischen Aspekten des Piercings bei Menschen mit einer akuten Borderline-Persönlichkeitsstörung und daraus resultierendem selbstverletzenden Verhalten. Denn leider ist dieses Thema heute aktueller und brisanter denn je. Und auch wenn es kaum ein Gepiercter gerne zugibt, ein Piercing kann Ausdruck einer psychischen Störung sein, was aber auf keinen Fall bedeuten soll, dass dies immer der Fall wäre!
Anhängern des Piercens ermöglicht die Lektüre eine neue Sichtweise auf die eigene Motivationsstruktur: Fand man wirklich nur den Schmuck schön? Ist das alles, oder steckt vielleicht noch mehr dahinter?
Besorgte Eltern bekommen Antworten auf die Frage, warum ihre Kinder „sich so etwas antun“.
Angesprochen werden daher alle, die heute im weitesten Sinne im pädagogischen Bereich mit Jugendlichen zu tun haben.
Kein einfaches, aber ein lohnendes Buch für alle, die zum Thema Piercing sich und andere besser verstehen möchten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Medien und das öffentliche Bild von Piercing
- Kapitel 3: Gefahren und Mythen um Piercings
- Kapitel 4: Motivationen und Bedeutungen von Piercings
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Piercings in Deutschland aus historisch-analytischer Perspektive. Die Autorin, die selbst Piercerin war, setzt sich kritisch mit dem öffentlichen Bild von Piercings auseinander und beleuchtet die verschiedenen Motivationen und Bedeutungen, die mit dem Tragen von Piercings verbunden sind.
- Das öffentliche Bild von Piercings in den Medien
- Häufige Missverständnisse und Mythen über Risiken von Piercings
- Individuelle Motivationen für das Tragen von Piercings
- Die Bedeutung von Piercings als Form der Selbstinszenierung
- Die Komplexität der Körpermodifikation als individuelles Ausdrucksmittel
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Die Autorin beschreibt ihre persönlichen Erfahrungen als Piercerin und die daraus entstandene Motivation, die Bedeutung von Piercings wissenschaftlich zu untersuchen. Sie kritisiert die oberflächliche und oft sensationslüsterne Berichterstattung in den Medien und strebt nach einer differenzierteren Betrachtung des Themas. Die Arbeit soll neue Perspektiven eröffnen und die verschiedenen Bedeutungen, die mit Piercings verbunden sein können, beleuchten, ohne dabei verallgemeinernde oder pathologisierende Aussagen zu treffen.
Kapitel 2: Medien und das öffentliche Bild von Piercing: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Piercings in den Medien. Es werden Beispiele aus der Presse angeführt, die Piercings vor allem mit Risiken und Horrorgeschichten verbinden. Die Autorin konfrontiert diese einseitigen und oft übertriebenen Schilderungen mit ihrer eigenen Erfahrung und zeigt auf, dass die Gefahren von Piercings in erster Linie auf unsachgemäße Ausführung und Pflege zurückzuführen sind. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Konstruktion eines negativen Bildes von Piercings.
Kapitel 3: Gefahren und Mythen um Piercings: Das Kapitel beschäftigt sich eingehend mit den tatsächlichen Risiken von Piercings und räumt mit weit verbreiteten Mythen auf. Es werden medizinische Aspekte beleuchtet, wobei die Autorin betont, dass die meisten Gefahren durch mangelnde Hygiene und unsachgemäße Pflege entstehen. Die "düstere Legende" von Lähmungen durch Piercings wird als unbegründet widerlegt. Der Schwerpunkt liegt auf der differenzierten Betrachtung von Risiken und dem Abbau von Ängsten durch Aufklärung.
Kapitel 4: Motivationen und Bedeutungen von Piercings: In diesem Kapitel werden verschiedene individuelle Motivationen für das Tragen von Piercings untersucht. Es wird deutlich, dass Piercings weit mehr als bloße Modeschmuck darstellen können und oft tiefere Bedeutungen für die Träger haben. Die Autorin erwähnt die Möglichkeit, Piercings als Ausdruck der Selbstinszenierung, der Verarbeitung von Erlebnissen oder als Symbol für bestimmte Lebensphasen zu verstehen. Die Komplexität der individuellen Beweggründe wird hervorgehoben, und es wird darauf hingewiesen, dass es keine allgemeingültigen Erklärungen für das Tragen von Piercings gibt.
Schlüsselwörter
Piercing, Körpermodifikation, Medien, Risikowahrnehmung, Mythen, Motivationen, Selbstinszenierung, individuelle Bedeutung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Medien, Mythen und Motivationen: Eine Analyse der Bedeutung von Piercings in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Bedeutung von Piercings in Deutschland aus einer historisch-analytischen Perspektive. Sie beleuchtet das öffentliche Bild von Piercings in den Medien, räumt mit Mythen über Risiken auf und analysiert die verschiedenen Motivationen und Bedeutungen, die mit dem Tragen von Piercings verbunden sind.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: das öffentliche Bild von Piercings in den Medien; häufige Missverständnisse und Mythen über Risiken von Piercings; individuelle Motivationen für das Tragen von Piercings; die Bedeutung von Piercings als Form der Selbstinszenierung; und die Komplexität der Körpermodifikation als individuelles Ausdrucksmittel.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Autorin, selbst eine ehemalige Piercerin, verbindet ihre persönlichen Erfahrungen mit einer kritischen Analyse der Medienberichterstattung und untersucht die verschiedenen Bedeutungen von Piercings, ohne verallgemeinernde oder pathologisierende Aussagen zu treffen. Die Arbeit verfolgt einen historisch-analytischen Ansatz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, vier Kapitel und einen Schluss mit Schlüsselwörtern. Kapitel 2 analysiert das öffentliche Bild von Piercings in den Medien. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den tatsächlichen Gefahren und Mythen um Piercings. Kapitel 4 untersucht die Motivationen und Bedeutungen von Piercings für die Träger.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit zeigt auf, dass das öffentliche Bild von Piercings in den Medien oft negativ verzerrt und von Mythen geprägt ist. Die tatsächlichen Risiken werden hauptsächlich durch unsachgemäße Ausführung und Pflege verursacht. Die Autorin betont die vielfältigen individuellen Bedeutungen von Piercings als Ausdruck der Selbstinszenierung und der Verarbeitung von Erlebnissen. Es gibt keine allgemeingültige Erklärung für das Tragen von Piercings.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an alle, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Körpermodifikation, Piercings und deren gesellschaftlicher Bedeutung auseinandersetzen möchten. Sie ist insbesondere für Studierende der Soziologie, Kulturwissenschaften und verwandter Disziplinen relevant.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Piercing, Körpermodifikation, Medien, Risikowahrnehmung, Mythen, Motivationen, Selbstinszenierung, individuelle Bedeutung, Deutschland.
Wo finde ich mehr Informationen?
(Hier könnte ein Link zur vollständigen Arbeit eingefügt werden, falls verfügbar.)
- Quote paper
- Anne Schinke (Author), 2007, Piercing in Deutschland. Eine historisch-analytische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71929