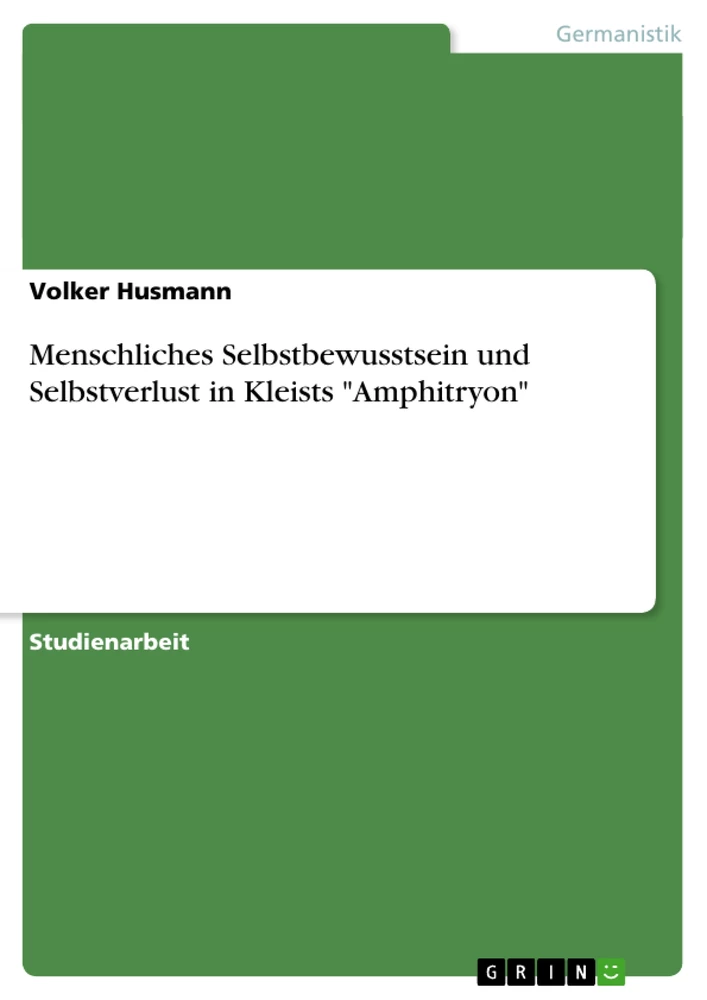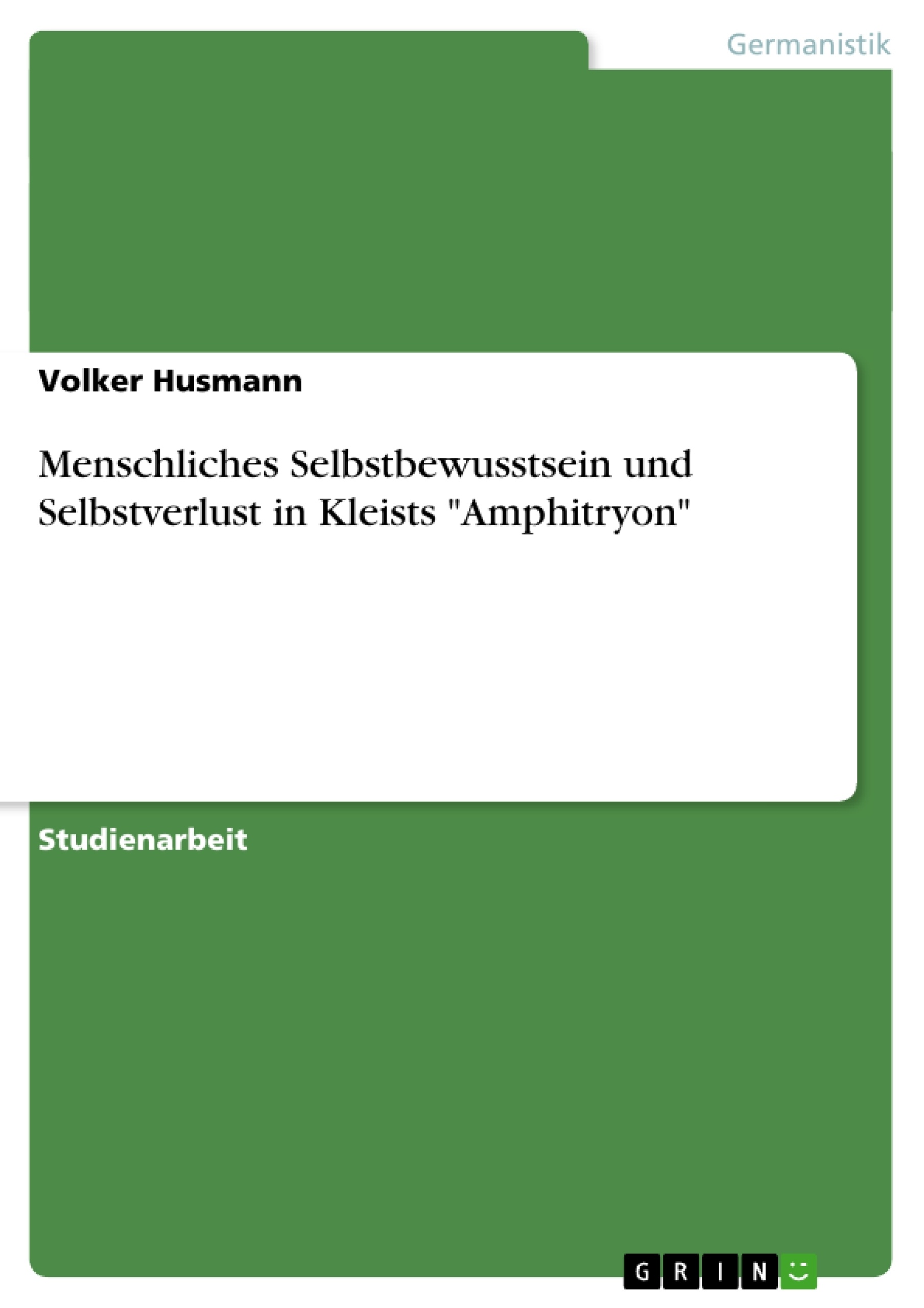Warum werden im Amphitryon gleich drei Personen in ihrem Selbst erschüttert? Ist es Zufall? Ist es eine rein dramaturgische Notwendigkeit? Diese Arbeit geht davon aus, dass die Figuren- und Problemkonstellation Amphitryon-Alkmene-Sosias bewusst konstruiert worden ist und dass ihr eine tiefere Bedeutung innewohnt, die es zu verstehen gilt. Es scheint ausgeschlossen, dass es sich dabei um eine doppelte Wiederholung des gleichen Phänomens handelt oder dass es um eine Reihe von Anfechtungen im Sinne einer Steigerung geht. Die Entamphitryonisierung ist nicht gleichsam eine höhere Entsosiatisierung oder dergleichen. Die Konstellation fußt, so lautet die These der Arbeit, auf dem Sockel einer anthropologischen Einsicht: Amphitryon, Alkmene und Sosias verkörpern jeweils einen Aspekt der menschlichen Existenz und bilden zusammen eine organische Einheit, die das menschliche Leben als Ganzes – das heißt auch: aus verschiedenen Teilen Zusammengesetztes – vorstellt. Die menschliche Existenz wird hierbei als eine in der Gesellschaft mit anderen vollzogene verstanden. Amphitryon stellt nach dieser These den Menschen als zoon politikon , als politisches Wesen dar, das sich selbst durch die Verhältnisse zu anderen begreift, sich also durch seine soziale Rolle definiert. Alkmene verkörpert den Menschen als ein zoon logon echon , als ein vernunftbegabtes Wesen, das seine Umwelt erkennen und verstehen kann. Damit sind die Kenntnis und Erkenntnis des Guten und die Möglichkeit der freien Wahl der Handlungen, für die Verantwortung zu übernehmen ist, verknüpft. Alkmene repräsentiert somit das sittliche Leben. Sosias charakterisiert eine wesentlich basalere Form des Menschseins: Er ist einfach ein zoon, ein Lebewesen. Bereits in der Antike, vor Plautus, wurde der Mensch als ein besonderes Tier begriffen. Man kennt die Anekdote, in der Platon den Menschen als ein ungefiedertes Tier auf zwei Beinen definiert, woraufhin gerupfte Hühner aus dem Hut gezaubert werden. Dieser Scherz, wenn man ihn recht versteht, zeigt bei all seiner scheinbaren Albernheit, dass die Griechen sehr wohl wussten, dass der Mensch sich nicht im Leiblichen, sondern durch seine besondere Seele und sein Gemeinwesen von den anderen Tieren unterscheidet...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstbewusstsein und Selbstverlust der irdischen Helden
- Amphitryon
- Alkmene
- Sosias
- Schlusswort und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das Thema des Selbstbewusstseins und des Selbstverlustes in Kleists „Amphitryon“ unter Berücksichtigung der drei irdischen Figuren: Amphitryon, Alkmene und Sosias. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Konstellation dieser Figuren zu verstehen und die Frage zu beantworten, warum sie in ihrem Selbst erschüttert werden.
- Die Darstellung des Menschen als „zoon politikon“ in Amphitryon
- Die Rolle des Menschen als „zoon logon echon“ in Alkmenes Handeln und Entscheidungen
- Sosias als „zoon“, der die grundlegenden Aspekte des menschlichen Daseins repräsentiert
- Die Frage, ob Selbstverlust ein Zufallsprodukt ist oder eine tiefergehende anthropologische Bedeutung hat
- Die Analyse der Verwirrung und des Gefühls des Selbstverlustes, die die Figuren erfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit dem Thema Selbstverlust im Kontext von Kleists „Amphitryon“. Sie stellt die Problematik des Selbstverlustes in der Komödie dar und beleuchtet die Situation der drei irdischen Helden, die nicht nur mit einer verwirrten Außenwelt konfrontiert sind, sondern auch mit einer inneren Verwirrung kämpfen.
Selbstbewusstsein und Selbstverlust der irdischen Helden
Amphitryon
Dieser Abschnitt analysiert Amphitryons Rolle und seine Positionierung im Stück. Er beleuchtet die Aspekte seiner gesellschaftlichen Stellung und die Darstellung seines Verhältnisses zu Alkmene. Die Analyse konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Amphitryon in der Komödie dargestellt wird und wie er mit den Herausforderungen des Selbstverlustes umgeht.
Alkmene
Dieser Teil befasst sich mit der Figur der Alkmene und untersucht, wie sie den Selbstverlust erlebt und wie ihre Handlungen und Entscheidungen durch diese Erfahrung beeinflusst werden. Die Analyse konzentriert sich auf Alkmenes Rolle als „zoon logon echon“ und ihre Fähigkeit, die Welt zu erkennen und zu verstehen.
Sosias
Dieser Abschnitt analysiert die Figur des Sosias und seine Rolle im Stück. Er beleuchtet Sosias‘ Sichtweise auf die Welt und sein Verhältnis zu Amphitryon. Die Analyse konzentriert sich auf Sosias’ Positionierung als „zoon“ und die Probleme, mit denen er unabhängig von seiner sozialen Rolle und seinem Gewissen konfrontiert ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Selbstbewusstsein und Selbstverlust im Kontext der menschlichen Existenz in Kleists „Amphitryon“. Zentrale Schlüsselbegriffe sind „zoon politikon“, „zoon logon echon“, „zoon“, „Verwirrung“, „Doppelgänger“, „Selbstverlust“, „anthropologische Einsicht“, „gesellschaftliche Rolle“ und „sittliches Leben“. Die Arbeit analysiert die Interaktion dieser Konzepte im Stück und untersucht, wie sie sich auf die Figuren und deren Selbstverständnis auswirken.
Häufig gestellte Fragen
Warum erleben die Figuren in Kleists „Amphitryon“ einen Selbstverlust?
Der Selbstverlust wird durch die Begegnung mit göttlichen Doppelgängern ausgelöst, die die Identität und das Selbstverständnis der irdischen Helden erschüttern.
Was verkörpert die Figur des Amphitryon?
Amphitryon repräsentiert das „zoon politikon“, das politische Wesen, das sich primär über seine soziale Rolle und Stellung in der Gesellschaft definiert.
Welche Rolle spielt Alkmene in der anthropologischen Deutung?
Alkmene verkörpert das „zoon logon echon“, das vernunftbegabte und sittliche Wesen, das nach Erkenntnis des Guten und moralischer Verantwortung strebt.
Wie wird Sosias im Stück charakterisiert?
Sosias stellt die basalste Form des Menschseins dar, das „zoon“ (Lebewesen), das mit rein körperlichen und existenziellen Herausforderungen konfrontiert ist.
Ist die Verwirrung der Figuren in „Amphitryon“ rein dramaturgisch?
Die Arbeit vertritt die These, dass die Erschütterung des Selbst eine bewusste anthropologische Konstruktion ist, um die verschiedenen Aspekte der menschlichen Existenz zu beleuchten.
- Citation du texte
- Volker Husmann (Auteur), 2006, Menschliches Selbstbewusstsein und Selbstverlust in Kleists "Amphitryon", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72395