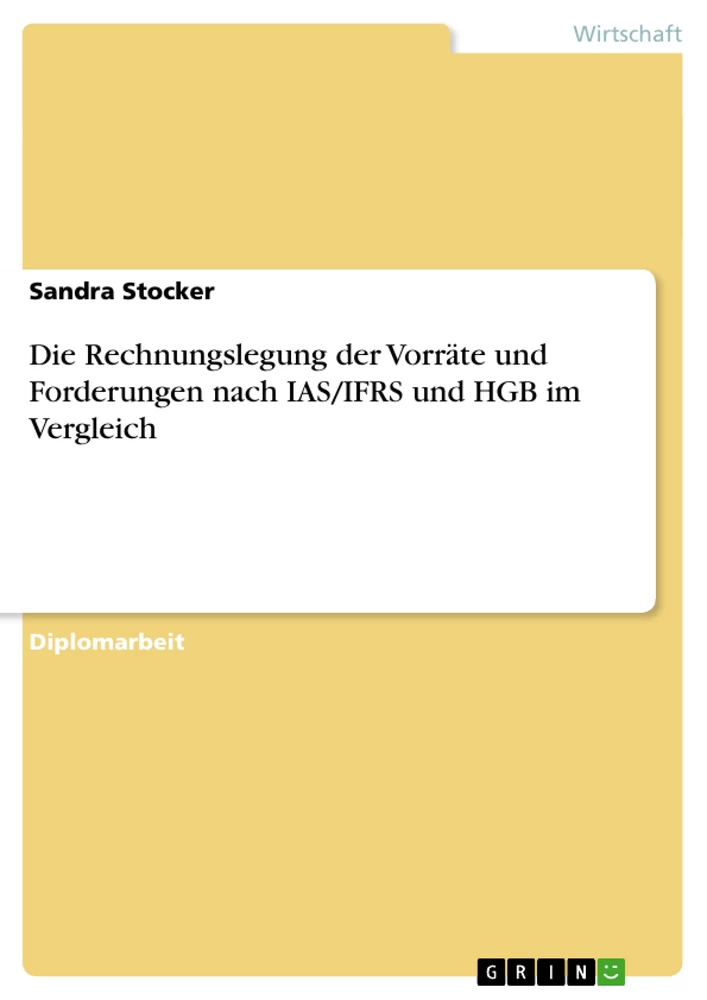Die fortschreitende Globalisierung der Unternehmen bedingt sowohl eine verstärkte internationale Kapitalverflechtung, als auch eine zunehmende Kapitalmarktorientierung. In der Regel schaffen Start-ups, sowie auch mittelständische Unternehmen eine Expansion auf internationaler Ebene nur über den Zugang zu den Kapitalmärkten. Für die Zulassung an der New Yorker Börse (NYSE) wird beispielsweise ein Jahresabschluss über drei Vergleichsjahre nach US-GAAP vorausgesetzt. Ferner ist die internationale Rechnungslegung innerhalb eines international operierenden Konzerns wesentlich effizienter und transparenter darzustellen, wenn in allen Gesellschaften eine einheitliche Norm zur Anwendung kommt. Selbst innerhalb Europas sind die bestehenden unterschiedlichen nationalen Rechnungslegungsnormen, für solche Bestrebungen hinderlich. Ein Vergleich oder eine Analyse von Jahresabschlüssen aus verschiedenen nationalen Rechtssystemen ist nicht möglich und potentiellen Anlegern wird ein Engagement erschwert. Durch die internationalen Rechnungslegungsnormen soll der Zugang zu den Börsenplätzen und somit zu den Kapitalgebern erleichtert werden.
Ein weiteres Motiv, sich mit den internationalen Bilanzierungsnormen zu beschäftigen, kann eine Refinanzierung durch internationale Kreditgeber und eine eventuell bessere Einstufung beim Rating der Banken sein1.
Seit 2005 sind außerdem neue gesetzliche Vorschriften zu beachten, die die internationalen Regelungen stärker berücksichtigen, um die Jahresabschlüsse aus Sicht der Investoren besser vergleichbar zu machen. Aus Unternehmenssicht führen somit nationale und internationale Börsenvorschriften sowie gesetzliche Regelungen, zur Anwendung internationaler Rechnungslegungsvorschriften2.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Bedeutung der internationalen Rechnungslegung
- 1.2. Historischer Rückblick
- 1.3. Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit
- 2. Die Rechnungslegungskonzepte und Institutionen
- 2.1. Das deutsche Handelsrecht
- 2.1.1. Gesetzgeber
- 2.1.2. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW)
- 2.1.3. Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC)
- 2.1.4. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung
- 2.2. Die internationalen Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS
- 2.2.1. Allgemeines / Aufbau
- 2.2.2. International Accounting Standards Committee / Board (IASC/IASB)
- 2.2.3. Rechnungslegungsgrundsätze nach IAS/IFRS
- 3. Die Rechnungslegung der Vorräte nach IAS/IFRS
- 3.1. Zielsetzung und Anwendungsbereich IAS 2
- 3.2. Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen
- 3.3. Ansatz
- 3.4. Bewertung
- 3.4.1. Bewertungsgrundsätze
- 3.4.2. Ermittlung der Zugangswerte
- 3.4.3. Einzelbewertung versus Bewertungsvereinfachungsverfahren
- 3.4.4. Analyse der Bilanzierungspraxis
- 3.4.5. Besonderheiten bei der Folgebewertung
- 3.5. Ausweis des Vorratsvermögens
- 4. Die Rechnungslegung der Vorräte nach HGB
- 4.1. Ansatz
- 4.2. Bewertung
- 4.2.1. Strenges Niederstwertprinzip
- 4.2.2. Maßstäbe für die Ermittlung des niedrigeren Wertes
- 4.2.3. Die Verfahren zur Bewertung gleichartiger Vorräte
- 4.2.3.1. Überblick über die Verfahren
- 4.2.3.2. Die Durchschnittsmethode
- 4.2.3.3. Die Verbrauchsfolgeverfahren
- 4.2.3.4. Handelsrechtliche Zulässigkeit von Verbrauchsfolgeunterstellungen
- 4.3. Ausweis
- 5. Die Rechnungslegung der Forderungen nach IAS/IFRS
- 5.1. Zielsetzung und Anwendungsbereich IAS 39
- 5.2. Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen
- 5.3. Ansatz
- 5.4. Bewertung
- 5.4.1. Zugangsbewertung
- 5.4.2. Folgebewertung
- 5.4.3. Analyse der Bilanzierungspraxis
- 5.5. Ausweis
- 6. Die Rechnungslegung der Forderungen nach HGB
- 6.1. Ansatz
- 6.2. Bewertung
- 6.2.1. Zugangsbewertung
- 6.2.2. Folgebewertung
- 6.2.3. Die Bewertung abzuzinsender Forderungen
- 6.2.4. Fremdwährungsforderungen
- 6.3. Ausweis
- 7. Zusammenfassung und Vergleich zwischen IAS/IFRS und HGB
- 7.1. Die wesentlichen Unterschiede zwischen IAS/IFRS und HGB
- 7.2. Gegenüberstellung der beiden Rechnungslegungssysteme bei der Bewertung von Vorräten
- 7.2.1. Anschaffungs-/Herstellungskosten
- 7.2.2. Bewertungsvereinfachungsverfahren
- 7.3. Vergleich der beider Rechnungslegungssysteme bei der Forderungsbewertung
- 7.3.1. Anschaffungskosten
- 7.3.2. Wertberichtigungen / Abschreibungen
- 8. Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit vergleicht die Rechnungslegung von Vorräten und Forderungen nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) und dem Handelsgesetzbuch (HGB). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme aufzuzeigen und ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Bilanzierungsgrundsätze zu vermitteln.
- Vergleich der Rechnungslegung von Vorräten nach IAS/IFRS und HGB
- Vergleich der Rechnungslegung von Forderungen nach IAS/IFRS und HGB
- Analyse der Bewertungsmethoden für Vorräte und Forderungen
- Untersuchung der Unterschiede in den Ansatz- und Ausweisvorschriften
- Bewertung der jeweiligen Stärken und Schwächen beider Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Bedeutung der internationalen Rechnungslegung im Kontext der Globalisierung. Es beschreibt den historischen Hintergrund der Entwicklung von IFRS und HGB und skizziert die Zielsetzung sowie die Vorgehensweise der Arbeit.
2. Die Rechnungslegungskonzepte und Institutionen: Dieses Kapitel stellt die relevanten Rechnungslegungskonzepte und Institutionen vor, sowohl im deutschen Kontext (HGB, IDW, DRSC) als auch im internationalen Kontext (IASB, IFRS). Es beschreibt die grundlegenden Prinzipien und den Aufbau der jeweiligen Regelwerke.
3. Die Rechnungslegung der Vorräte nach IAS/IFRS: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit der Rechnungslegung von Vorräten gemäß IAS 2. Es definiert die relevanten Begriffe, erläutert die Ansatzkriterien, beschreibt verschiedene Bewertungsmethoden (insbesondere die Ermittlung der Anschaffungskosten und die Wahl zwischen Einzelbewertung und Bewertungsvereinfachungsverfahren) und analysiert die Bilanzierungspraxis. Die Bedeutung einer korrekten Bewertung für die Darstellung des finanziellen Zustands des Unternehmens wird hervorgehoben.
4. Die Rechnungslegung der Vorräte nach HGB: Dieses Kapitel behandelt die Rechnungslegung von Vorräten nach deutschem Handelsrecht. Im Fokus steht das strenge Niederstwertprinzip und die verschiedenen Methoden zur Ermittlung des niedrigeren Wertes (Anschaffungskosten oder Nettoveräußerungswert). Die unterschiedlichen Verbrauchsfolgeverfahren (FIFO, LIFO, Durchschnittsmethode) werden detailliert erklärt und deren handelsrechtliche Zulässigkeit diskutiert. Der Einfluss der Bewertung auf die Gewinn- und Verlustrechnung wird analysiert.
5. Die Rechnungslegung der Forderungen nach IAS/IFRS: Dieses Kapitel beschreibt die Rechnungslegung von Forderungen nach IAS 39. Es erläutert die Definitionen, die Ansatzkriterien und die Bewertungsmethoden, sowohl bei der erstmaligen Ansatz als auch in der Folgebewertung. Eine Analyse der Bilanzierungspraxis liefert Einblicke in die praktische Anwendung der Standards. Der Fokus liegt auf der korrekten Abbildung der Risiken, die mit Forderungen verbunden sind.
6. Die Rechnungslegung der Forderungen nach HGB: Dieses Kapitel untersucht die Rechnungslegung von Forderungen nach HGB. Es beschreibt die Ansatzkriterien und die verschiedenen Bewertungsmethoden, einschließlich der Bewertung abzuzinsender Forderungen und Forderungen in Fremdwährung. Es wird aufgezeigt, wie die Wertberichtigungen nach HGB vorgenommen werden und welche Auswirkungen dies auf die Bilanz hat.
Schlüsselwörter
Internationale Rechnungslegung, IFRS, IAS, HGB, Vorräte, Forderungen, Bewertung, Ansatz, Ausweis, Niederstwertprinzip, Bewertungsvereinfachungsverfahren, Anschaffungskosten, Folgebewertung, Bilanzierungspraxis, Wertberichtigungen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Vergleich der Rechnungslegung von Vorräten und Forderungen nach IFRS und HGB
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit vergleicht die Rechnungslegung von Vorräten und Forderungen nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) und dem Handelsgesetzbuch (HGB). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme aufzuzeigen und ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Bilanzierungsgrundsätze zu vermitteln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der Rechnungslegung von Vorräten und Forderungen nach IFRS und HGB, die Analyse der Bewertungsmethoden für beide, die Untersuchung der Unterschiede in den Ansatz- und Ausweisvorschriften sowie die Bewertung der jeweiligen Stärken und Schwächen beider Systeme. Es werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der Standards beleuchtet.
Welche Rechnungslegungskonzepte und -institutionen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet das deutsche Handelsrecht (HGB), das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC), sowie die internationalen Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS, das International Accounting Standards Committee / Board (IASC/IASB) und deren grundlegenden Prinzipien.
Wie wird die Rechnungslegung von Vorräten nach IAS/IFRS behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Rechnungslegung von Vorräten gemäß IAS 2, einschließlich der Begriffsdefinitionen, Ansatzkriterien, verschiedener Bewertungsmethoden (Ermittlung der Anschaffungskosten, Einzelbewertung vs. Bewertungsvereinfachungsverfahren) und einer Analyse der Bilanzierungspraxis. Die Bedeutung einer korrekten Bewertung für die Darstellung des finanziellen Zustands des Unternehmens wird hervorgehoben.
Wie wird die Rechnungslegung von Vorräten nach HGB behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rechnungslegung von Vorräten nach deutschem Handelsrecht, mit Fokus auf dem strengen Niederstwertprinzip und den Methoden zur Ermittlung des niedrigeren Wertes (Anschaffungskosten oder Nettoveräußerungswert). Die verschiedenen Verbrauchsfolgeverfahren (FIFO, LIFO, Durchschnittsmethode) werden detailliert erklärt, ihre handelsrechtliche Zulässigkeit diskutiert und der Einfluss der Bewertung auf die Gewinn- und Verlustrechnung analysiert.
Wie wird die Rechnungslegung von Forderungen nach IAS/IFRS behandelt?
Die Arbeit beschreibt die Rechnungslegung von Forderungen nach IAS 39, einschließlich Definitionen, Ansatzkriterien, Bewertungsmethoden (Erst- und Folgebewertung) und einer Analyse der Bilanzierungspraxis. Der Fokus liegt auf der korrekten Abbildung der Risiken, die mit Forderungen verbunden sind.
Wie wird die Rechnungslegung von Forderungen nach HGB behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rechnungslegung von Forderungen nach HGB, einschließlich Ansatzkriterien, Bewertungsmethoden (einschließlich der Bewertung abzuzinsender Forderungen und Forderungen in Fremdwährung) und der Wertberichtigungen nach HGB und deren Auswirkungen auf die Bilanz.
Wie werden IFRS und HGB verglichen?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung und einen Vergleich zwischen IAS/IFRS und HGB, wobei die wesentlichen Unterschiede, die Gegenüberstellung der Systeme bei der Bewertung von Vorräten (Anschaffungskosten, Bewertungsvereinfachungsverfahren) und Forderungen (Anschaffungskosten, Wertberichtigungen/Abschreibungen) hervorgehoben werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Internationale Rechnungslegung, IFRS, IAS, HGB, Vorräte, Forderungen, Bewertung, Ansatz, Ausweis, Niederstwertprinzip, Bewertungsvereinfachungsverfahren, Anschaffungskosten, Folgebewertung, Bilanzierungspraxis, Wertberichtigungen.
Gibt es einen Ausblick?
Die Arbeit enthält einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich der internationalen und nationalen Rechnungslegung.
- Citation du texte
- Sandra Stocker (Auteur), 2007, Die Rechnungslegung der Vorräte und Forderungen nach IAS/IFRS und HGB im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73625