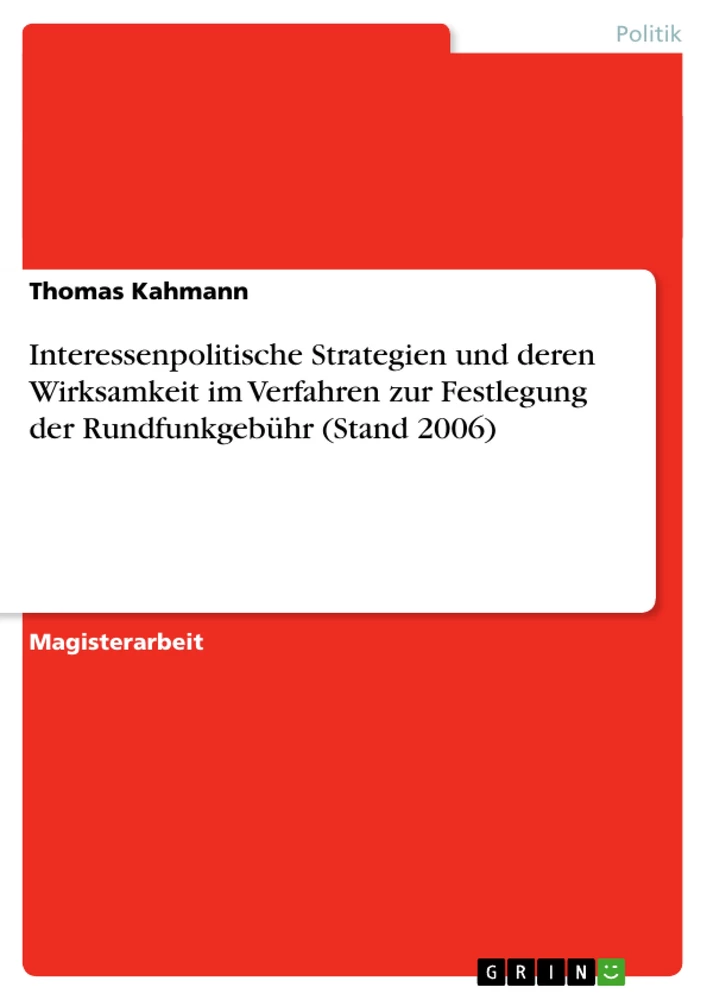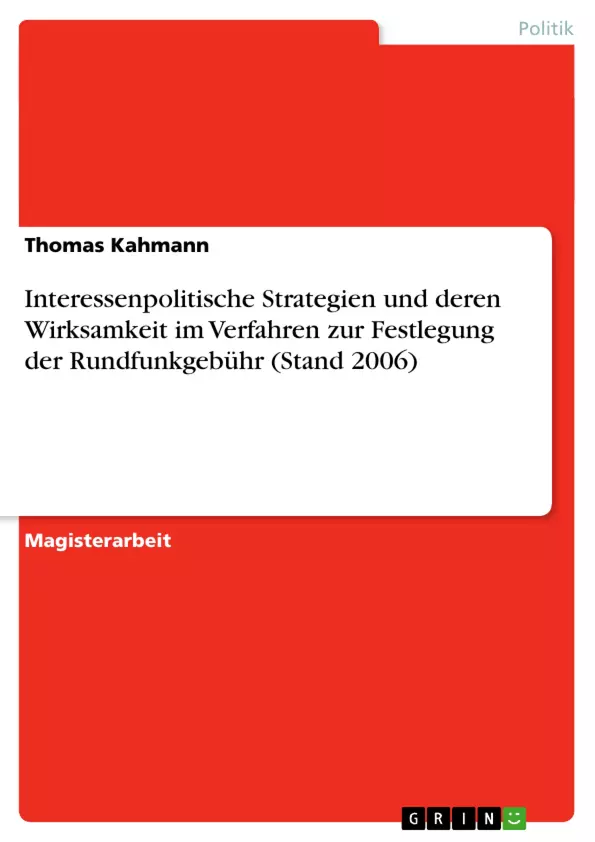Im Achten Rundfunkurteil beschäftigte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Es stellte Vorgaben für ein Verfahren auf, welches die Rundfunkanstalten vor dem Eingriff der Politik in die Programmautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schützen sollte. Zuvor hatte sich die von den Ländern festzulegende Höhe der Rundfunkgebühr, aus der sich die öffentlichrechtlichen Sender finanzieren, mehrfach als ein Druckmittel erwiesen, mit dem die Politik versuchte, Einfluss auf die Programmgestaltung des öffentlichrechtlichen Rundfunks auszuüben. Das Gericht bestätigte, dass die Festlegung der Rundfunkgebühr staatsfern zu erfolgen habe, und wies diese Aufgabe der neutral besetzten Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) zu, die den Gebührenbedarf der Länder zu prüfen und eine Empfehlung auszuarbeiten habe, von der die Ministerpräsidenten der Länder und die Landesparlamente nur mit einer komplizierten Begründung unter dem Aspekt der Sozialverträglichkeit abweichen könnten.1 Dieses von der Fachwelt als ausreichend staatsfern und sicher bewertete Verfahren kam bei den Gebührenrunden 1997 und 2001 zur Anwendung.2 Im Jahr 1997 stimmten die Bundesländer dem KEF-Vorschlag von einer Erhöhung um 2,27 Euro ebenso zu, wie sie im Jahr 2001 die Empfehlung einer Erhöhung um 1,71 Euro annahmen.
In der folgenden Gebührenrunde zur Erhöhung der Rundfunkgebühr im Jahr 2005 änderte sich das Vorgehen der Ministerpräsidenten: Der Vorschlag der unabhängigen KEF wurde erstmals seit der Einführung des Festsetzungsverfahrens nicht angenommen. Anstelle der von der KEF empfohlenen Erhöhung um 1,09 Euro beschlossen die Ministerpräsidenten eine Erhöhung um 0,88 Euro ab dem 01. April 2005. Damit beträgt die Rundfunkgebühr im Gegensatz zum Vorschlag der KEF, der in einer Rundfunkgebühr von 17,24 Euro gemündet wäre, lediglich 17,03 Euro. Die Ministerpräsidenten rechtfertigen diese Abweichung mit der ihnen als einzige Begründung im Verfahren zugestandenen Sozialverträglichkeit und führen an, dass die Gebührenempfehlung der KEF „[...] in das Umfeld einer deutlich angespannten wirtschaftlichen Lage, die große Herausforderungen und finanzielle Einschränkungen für alle Teile der Bevölkerung [...]“ mit sich bringe, falle.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Interessenbegriff
- 2.2. Interessentheoretische Ansätze
- 2.2.1. Pluralismustheorie
- 2.2.2. Interessen im systemtheoretischen Politikmodell
- 2.2.3. Konfliktorische Theorie
- 2.2.4. Interessenpolitik in der Neuen Politischen Ökonomie
- 2.2.5. Netzwerktheorie
- 2.3. Synopse und Kritik interessentheoretischer Ansätze
- 2.4. Marktcharakter der Interessenpolitik
- 2.5. Organisationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit
- 2.6. Interessenpolitische Instrumente
- 2.6.1. Lobbying
- 2.6.2. Pressure-Politik
- 2.6.2.1. Öffentliche Meinung und Public Relations
- 2.7. Zusammenfassung
- 3. Rechtliche Vorgaben der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung
- 3.1. Verfassungsrechtliche Vorgaben
- 3.2. Gesetzliche Vorgaben
- 3.3. Rundfunkfinanzierung
- 3.3.1. Gebührenfinanzierung
- 3.3.2. Wirtschaftswerbung
- 3.4 Zusammenfassung
- 4. Akteurs- und Interessenspektrum im Festsetzungsverfahren der Rundfunkgebühr
- 4.1. Öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter
- 4.2. Private Rundfunkveranstalter
- 4.3. Zusammenfassung
- 5. Präferenzsystem der Bundesländer als Entscheidungsebene im Gebührenverfahren
- 5.1. Gesamtgesellschaftlich systemrelevante Leistungen der Rundfunkanbieter
- 5.1.1. Wirtschaftliche Leistung: Öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk als Wirtschaftsfaktor – die regionale Struktur der deutsche Rundfunkwirtschaft
- 5.1.2. Publizistische Leistung: Vermittlungsfunktion der Massenmedien
- 5.2. Systemrelevante Leistungen der Rundfunkanbieter auf der Systemebene der Landesregierungen
- 5.3. Zusammenfassung
- 6. Verlauf des Gebührenfestsetzungsverfahrens und der Gebührendebatte für die 11. Gebührenperiode
- 7. Aktive Interesseneinbringung im Rahmen interessenpolitischer Strategien
- 7.1. Lobbying
- 7.1.1. Lobbying der öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter
- 7.1.2. Lobbying der privaten Rundfunkveranstalter
- 7.2. Pressure-Politik
- 7.2.1. Pressure-Politik der öffentlich rechtlichen Rundfunkveranstalter
- 7.2.2. Pressure-Politik der privaten Rundfunkveranstalter
- 7.3. Zusammenfassung
- 8. Analyse der Durchsetzungsfähigkeit
- 8.1. Organisationsfähigkeit
- 8.1.1. Konkrete und homogene Ziele der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter
- 8.1.2. Konkrete und homogene Ziele der privaten Rundfunkanbieter
- 8.1.3. Organisationsstrukturen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
- 8.1.4. Organisationsstrukturen der privaten Rundfunkanbieter
- 8.2. Konfliktfähigkeit
- 8.2.1. Wirtschaftliche Leistung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter
- 8.2.2. Wirtschaftliche Leistung der privaten Rundfunkanbieter
- 8.2.3. Publizistische Leistung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter
- 8.2.4. Publizistische Leistung der privaten Rundfunkanbieter
- 8.2.5. Informationen der öffentlich-rechtlichen Anbieter als systemrelevante Leistungen
- 8.2.6. Informationen der privaten Rundfunkanbieter als systemrelevante Leistungen
- 8.3. Zusammenfassung
- 9. Fazit – Die Dringlichkeit eines neuen Rundfunkurteils
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die interessenpolitischen Strategien und deren Wirksamkeit im Verfahren zur Festsetzung der Rundfunkgebühr in Deutschland. Sie analysiert die verschiedenen Interessengruppen, ihre Ziele und Strategien sowie die Mechanismen der Interessendurchsetzung im Kontext der dualen Rundfunkordnung.
- Analyse der interessenpolitischen Strategien von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstaltern
- Bewertung der Wirksamkeit verschiedener Strategien, wie Lobbying und Pressure-Politik
- Untersuchung der Organisationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit der verschiedenen Akteure
- Analyse der Rolle der Bundesländer als Entscheidungsebene im Gebührenfestsetzungsverfahren
- Bewertung der Relevanz des Rundfunkurteils des Bundesverfassungsgerichts für die Festsetzung der Rundfunkgebühr
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problematik der Rundfunkgebührenfestsetzung und die Relevanz des Themas dar, indem sie auf das Acht Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts und dessen Einfluss auf das Verfahren zur Festsetzung der Rundfunkgebühr eingeht. Sie beleuchtet die aktuelle Situation der Gebührenempfehlungen der KEF und die Entscheidungen der Ministerpräsidenten.
- Kapitel 2: Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die Analyse der interessenpolitischen Strategien. Es erläutert den Interessenbegriff, verschiedene interessentheoretische Ansätze und die Rolle von Organisationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit in der Interessenpolitik. Außerdem wird die Bedeutung von Lobbying und Pressure-Politik als interessenpolitische Instrumente diskutiert.
- Kapitel 3: Rechtliche Vorgaben der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung: Dieses Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Es fokussiert auf die Gebührenfinanzierung und die Rolle der Wirtschaftswerbung im dualen Rundfunksystem.
- Kapitel 4: Akteurs- und Interessenspektrum im Festsetzungsverfahren der Rundfunkgebühr: Dieses Kapitel präsentiert die verschiedenen Akteure und deren Interessenslagen im Verfahren zur Festsetzung der Rundfunkgebühr. Es analysiert die Perspektiven der öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstalter.
- Kapitel 5: Präferenzsystem der Bundesländer als Entscheidungsebene im Gebührenverfahren: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Bundesländer als Entscheidungsebene im Gebührenfestsetzungsverfahren. Es analysiert die systemrelevanten Leistungen der Rundfunkanbieter und deren Bedeutung für die Landesregierungen.
- Kapitel 6: Verlauf des Gebührenfestsetzungsverfahrens und der Gebührendebatte für die 11. Gebührenperiode: Dieses Kapitel beleuchtet den Verlauf des Gebührenfestsetzungsverfahrens und der Gebührendebatte für die 11. Gebührenperiode. Es beschreibt die Prozesse der Interesseneinbringung und die Entscheidungen der Ministerpräsidenten.
- Kapitel 7: Aktive Interesseneinbringung im Rahmen interessenpolitischer Strategien: Dieses Kapitel untersucht die aktiven Interesseneinbringungen der öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstalter im Rahmen interessenpolitischer Strategien. Es analysiert die Methoden des Lobbyings und der Pressure-Politik.
- Kapitel 8: Analyse der Durchsetzungsfähigkeit: Dieses Kapitel analysiert die Durchsetzungsfähigkeit der verschiedenen Akteure im Gebührenfestsetzungsverfahren. Es untersucht die Organisationsfähigkeit und die Konfliktfähigkeit der öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstalter.
Schlüsselwörter
Interessenpolitik, Rundfunkgebühr, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, privater Rundfunk, Lobbying, Pressure-Politik, Organisationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Bundesverfassungsgericht, Rundfunkurteil, KEF, Bundesländer, duales Rundfunksystem.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Rundfunkgebühr in Deutschland festgelegt?
Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) prüft den Bedarf und gibt eine Empfehlung ab, über die die Ministerpräsidenten der Länder entscheiden.
Was war die Besonderheit der Gebührenrunde 2005?
Erstmals wichen die Ministerpräsidenten vom KEF-Vorschlag ab und beschlossen eine geringere Erhöhung, was mit der „Sozialverträglichkeit“ begründet wurde.
Welche Strategien nutzen Rundfunkanstalten zur Interessenpolitik?
Sie nutzen Lobbying (direkte Einflussnahme) und Pressure-Politik (Öffentlichkeitsarbeit), um ihre finanziellen Bedarfe durchzusetzen.
Was ist das Ziel des „Achten Rundfunkurteils“?
Es soll die Programmautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor politischer Einflussnahme durch ein staatsfernes Finanzierungsverfahren schützen.
Warum gibt es Konflikte zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern?
Private Sender sehen in der Gebührenfinanzierung oft einen Wettbewerbsnachteil und versuchen, durch eigene Interessenpolitik die Mittel der öffentlich-rechtlichen Sender zu begrenzen.
- Quote paper
- Thomas Kahmann (Author), 2006, Interessenpolitische Strategien und deren Wirksamkeit im Verfahren zur Festlegung der Rundfunkgebühr (Stand 2006), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73733