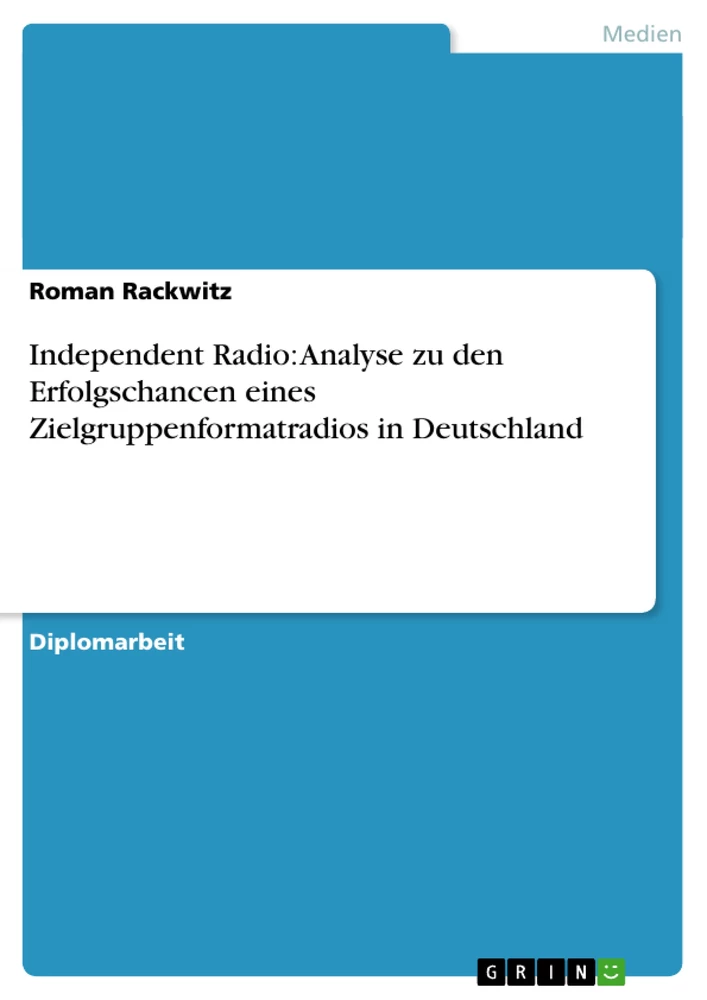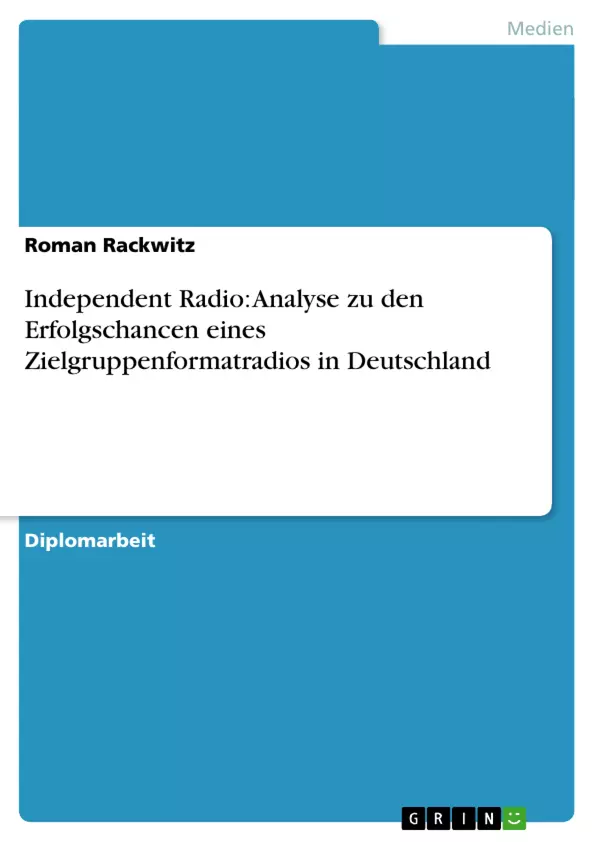Die Hoffnung der Musikwirtschaft auf neue musikalische Präsentationsflächen im Hörfunk war groß, als Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts in Deutschland erstmals private Radiostationen zugelassen wurden. Doch bald sollte sich Ernüchterung breit machen. Statt größerer musikalischer Vielfalt nutzen Hörfunkstationen Marktforschung, um sich musikalisch wie inhaltlich bei ihrem Zielpublikum abzusichern. Bereits existierende Hörgewohnheiten der Rezipienten werden von den Sendern seitdem gezielt bedient. Für musikalische Innovationen bleibt da kaum Platz. Die Ausrichtung der meisten privaten Hörfunkprogramme auf den Mainstream ist aus wirtschaftlicher Sicht durchaus verständlich. Die wichtigste Einnahmequelle eines privaten Senders, das Geld aus dem Verkauf von Werbezeiten, kann nur in ausreichender Menge sprudeln, wenn eine möglichst breite Masse an Zuhörern erreicht wird. Und dies passiert vor allem mit massentauglicher Musik. Manövriert sich die deutsche Hörfunklandschaft mit dieser Ausrichtung aber nicht selbst ins Abseits? Die durchschnittliche Hördauer ist seit dem Jahr 2000 insgesamt bereits um 10% gesunken. Weit dramatischer fallen die Einbrüche mit 25% in der Altersklasse der 14-29-Jährigen aus.
Wie aber kann die Hörfunkbranche auf diesen Negativtrend reagieren? Welche Möglichkeiten stehen ihr zur Verfügung, um einen weiteren Rückgang der Hörerzahlen zu verhindern und sogar neue Zielgruppen zu erschließen? Sollte es in Deutschland möglich sein, die Zahl der Radionutzer durch die Etablierung neuer Hörfunkspartenprogramme zu steigern? Können sich neue Spartenprogramme mit dem klassischen Geschäftsmodell im privaten Hörfunk, nämlich der Refinanzierung durch die Vermarktung ihrer Werbeflächen, erfolgreich am Markt etablieren? Welche Hürden müssen sie dabei überwinden?
Diesen Fragen gehe ich in meiner Diplomarbeit „Independent Radio: Analyse zu den Erfolgschancen eines Zielgruppenformatradios in Deutschland“ nach. Sie gliedert sich in zwei Abschnitte. Im theoretischen Teil wird eine Analyse des existierenden deutschen Radiomarkts inklusive der Kostenstrukturen der Sender, Refinanzierungsquellen und Verbreitungsmöglichkeiten vorgenommen. Ihm schließt sich ein Praxisteil an, in dem die Konzeption eines Zielgruppenformatradios im Mittelpunkt steht. Dieser Abschnitt umfasst u.a. eine Zielgruppen- und Standortanalyse, Überlegungen zur Senderstruktur und die Entwicklung eines Finanzplanes für die ersten fünf Jahre des Sendebetriebs.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Definitionen
- 1.1 Spartenprogramm / Zielgruppenprogramm
- 1.2 Vollprogramm
- 1.3 Formatradio
- 1.3.1 Independent Radio
- 1.4 Klassisches Geschäftsmodell im privaten deutschen Hörfunk
- 2. Erfolgskriterien für einen Hörfunksender
- 3. Senderprofil
- 4. Radiomarkt
- 5. Hörfunknutzung
- 5.1 Hörfunknutzung nach Altersklassen
- 5.2 Hörfunknutzung nach Bildung
- 5.3 Hörfunknutzung im Tagesverlauf
- 5.4 Motive der Hörfunknutzung
- 5.4.1 Nutzungstypen
- 6. Kostenstruktur privater Hörfunksender
- 6.1 Kostenstruktur im Einzelnen
- 7. Ertragsstruktur privater Hörfunksender
- 7.1 Unterschied der Werbeeinkünfte bei landesweiten und lokalen Sendern
- 7.2 Ausgaben privater Hörfunkveranstalter
- 8. Hörfunk und Werbung
- 8.1 Überblick über Werberichtlinien
- 8.2 Werberichtlinien im Detail
- 8.3 Bedeutung des Hörfunks als Werbemedium
- 8.4 Werbeeinkünfte
- 8.5 Werbezeitenauslastung
- 8.6 Wirkungsweise von Radiowerbung
- 8.6.1 Werbeeinstellung der Rezipienten beim Hörfunk
- 8.6.2 Stärken des Mediums
- 8.6.3 Schwächen des Mediums
- 8.7 Werbende Firmen und Branchen
- 9. Refinanzierungsmöglichkeiten
- 9.1 Spotwerbung
- 9.1.1 Imagewerbung
- 9.1.2 Abverkaufswerbung
- 9.1.3 Tandem Spots
- 9.2 Sponsoring
- 9.3 Patronate
- 9.4 Markenkooperationen
- 9.5 Direct Response Radio (DRR)
- 9.6 Live Spots
- 9.7 Senderpromotions
- 9.8 Syndications
- 9.9 Schleichwerbung
- 9.10 Payola
- 9.11 Online-Geschäft
- 9.11.1 Downloads
- 9.11.2 Klingeltöne
- 9.11.3 Online-Werbung
- 9.12 Merchandise
- 9.13 Payradio
- 9.14 Kooperationen mit Konzertveranstaltern
- 9.15 Liveberichterstattung vor Ort
- 9.16 Durchführung eigener Events
- 9.17 Music Exploitation
- 9.1 Spotwerbung
- 10. Hörfunkvermarktung
- 10.1 Eigenvermarktung
- 10.2 Fremdvermarktung
- 10.3 Vorteile der Kombinationen für Mediaplaner
- 10.4 Nachteile der Werbekombinationen für Mediaplaner
- 10.5 Vorraussetzung für Vermarktung eines Radiosenders durch die RMS
- 11. Verbreitungswege
- 11.1 Verbreitung via UKW
- 11.2 Digital Video Broadcasting Terrestrisch - DVB-T
- 11.2.1 Technische Details
- 11.2.2 Fazit
- 11.3 Verbreitung via Satellit
- 11.3.1 Astra Digital Radio - ADR
- 11.3.2 Digital Video Broadcasting - Satellite (DVB-S)
- 11.3.3 Fazit
- 11.4 Verbreitung über Kabelnetze
- 11.4.1 Hörfunksender im Kabelnetz
- 11.4.2 Hörfunknutzung in Kabelnetzen
- 11.4.3 Kosten für die Verbreitung
- 11.4.4 Fazit
- 11.5 Verbreitung via Internet
- 11.5.1 Radiostreams / Internetstreams
- 11.6 Alternative Verbreitungswege
- 11.6.1 Digital Audio Broadcasting (DAB)
- 11.6.2 Digital Multimedia Broadcasting (DMB)
- 11.6.3 Digital Video Broadcasting - Handhelds (DVB-H)
- 11.6.4 Universal Mobile Telecommunications System - UMTS
- 11.7 Fazit Verbreitung
- 12. Lizenzierung privater Rundfunkprogramme
- 12.1 Marktzutritt
- 12.2 Programmkontrolle
- 12.3 Zugangsvoraussetzung für die Verbreitung von Hörfunkprogrammen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Erfolgschancen eines neuen Zielgruppenformatradios im deutschen Markt. Sie untersucht die Marktgegebenheiten des deutschen Hörfunksektors, definiert Erfolgskriterien für Hörfunkprogramme und überprüft die Wirtschaftlichkeit eines neuen Senders anhand einer Senderkonzeption.
- Marktgegebenheiten des deutschen Hörfunksektors
- Erfolgskriterien für Hörfunkprogramme
- Wirtschaftlichkeit eines neuen Zielgruppenformatradios
- Refinanzierungsmöglichkeiten und Verbreitungswege
- Lizenzierung privater Rundfunkprogramme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Diplomarbeit vor und erläutert die Forschungsmethodik. Das erste Kapitel definiert verschiedene Hörfunkprogramme wie Spartenprogramme, Vollprogramme und Formatradios, insbesondere Independent Radio. Es analysiert auch das klassische Geschäftsmodell im privaten deutschen Hörfunk. Das zweite Kapitel widmet sich den Erfolgskriterien für einen Hörfunksender. Das dritte Kapitel präsentiert ein detailliertes Senderprofil. Das vierte Kapitel beleuchtet den Radiomarkt und die Hörfunknutzung in Deutschland. Es analysiert die Hörfunknutzung nach Altersklassen, Bildung und Tagesverlauf sowie die Motive der Hörfunknutzung. Die Kapitel 5 und 6 untersuchen die Kosten- und Ertragsstruktur privater Hörfunksender. Kapitel 8 befasst sich mit Hörfunk und Werbung, insbesondere mit den Werberichtlinien, der Bedeutung des Hörfunks als Werbemedium und der Wirkungsweise von Radiowerbung. Kapitel 9 analysiert die Refinanzierungsmöglichkeiten von Hörfunksendern, wie Spotwerbung, Sponsoring, Patronate und Online-Geschäft. Kapitel 10 beschäftigt sich mit der Hörfunkvermarktung, inklusive Eigen- und Fremdvermarktung. Kapitel 11 analysiert die verschiedenen Verbreitungswege von Hörfunkprogrammen, wie UKW, DVB-T, Satellit, Kabelnetz und Internet. Kapitel 12 behandelt die Lizenzierung privater Rundfunkprogramme. Die Diplomarbeit verzichtet bewusst auf eine Zusammenfassung des Abschlusskapitels, um potenzielle Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Hörfunk, Formatradio, Zielgruppenformatradio, Independent Radio, Erfolgskriterien, Marktgegebenheiten, Hörfunknutzung, Kostenstruktur, Ertragsstruktur, Werbung, Refinanzierungsmöglichkeiten, Verbreitungswege, Lizenzierung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Zielgruppenformatradio?
Ein Radiosender, der sein Programm (Musik und Inhalte) strikt an den Interessen einer spezifischen, oft eng definierten Hörerschaft ausrichtet, statt die breite Masse anzusprechen.
Warum sinken die Hörerzahlen bei jungen Menschen?
Gründe sind die zunehmende Konkurrenz durch digitale Angebote, Streaming-Dienste und eine oft als zu einheitlich wahrgenommene Mainstream-Ausrichtung der klassischen Sender.
Wie finanzieren sich private Radiosender?
Die Haupteinnahmequelle ist der Verkauf von Werbezeiten (Spotwerbung), ergänzt durch Sponsoring, Events und Online-Vermarktung.
Welche Rolle spielt die RMS bei der Vermarktung?
Die Radio Marketing Service (RMS) ist ein großer Vermarkter, der Werbeflächen verschiedener Sender bündelt und an Mediaplaner verkauft.
Welche Verbreitungswege gibt es für digitales Radio?
Neben dem klassischen UKW gibt es DAB+, Internetstreams, Satellitenradio (DVB-S) und mobile Verbreitung via Apps.
- Citar trabajo
- Roman Rackwitz (Autor), 2007, Independent Radio: Analyse zu den Erfolgschancen eines Zielgruppenformatradios in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73942