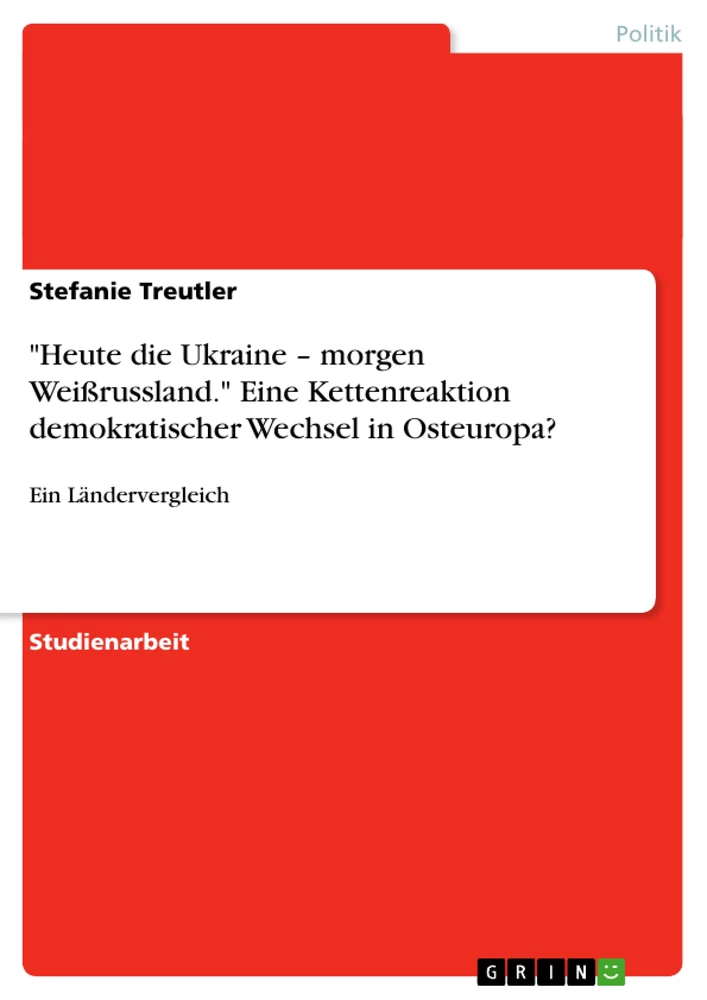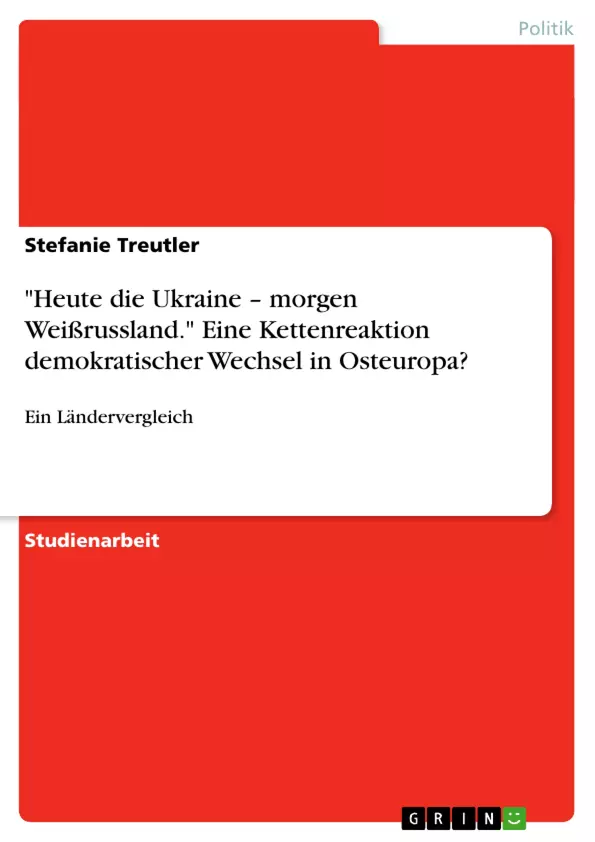Im Winter 2004/05 gingen hunderttausende Ukrainer auf die Straße, um gegen die gefälschten Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl und für ihren Kandidaten Juschchenko zu demonstrieren. Nach Wochen der Demonstrationen hatten sie schließlich Erfolg. Die „Orangene Revolution“ führte zum demokratischen Wechsel in der Ukraine. Sie stand in einer Abfolge mit den demokratischen Wechseln in Belgrad und Tiflis. Eine Kettenreaktion von demokratischen Wechseln schien durch Osteuropa zu laufen. Die hoffnungsvolle Botschaft „Heute die Ukraine – morgen Weißrussland“ war daher noch im Dezember vergangenen Jahres auf den Plakaten einer kleinen Demonstrantenschar auf dem Minsker Oktoberplatz zu lesen . Die Hoffnung der Demonstranten erfüllte sich jedoch nicht, eine Massenbewegung in Anlehnung an die erfolgreichen Proteste in der Ukraine kam nicht zustande. Der erwartete Dominoeffekt blieb aus. Es stellt sich die Frage, warum dies so ist. Welche Unterschiede in der auf den ersten Blick sehr ähnlichen Entwicklung der beiden Länder waren so wesentlich, dass dem Lukaschenko-Regime eine höhere Stabilität, ablesbar an der längeren Überlebensdauer, beschieden ist?
Im Folgenden soll ein Ländervergleich helfen, die Antwort auf diese Fragen zu finden. Die Ukraine wird dabei bis zum Jahr 2001 betrachtet, da zu diesem Zeitpunkt m.E. die Wende in der jüngsten ukrainischen Geschichte begann: Nach dem Mord am Journalisten Gongadse entwickelten sich die Proteste seiner Kollegen in kurzer Zeit zu einer Massenbewegung, zivilgesellschaftliches Engagement war in breiten Teilen der Bevölkerung geweckt worden. Hinzu kam im selben Jahr die Entlassung der erfolgreichen Regierung Juschchenko. Weißrussland hingegen wird bis zum Jahr 2004 betrachtet werden.
Zu untersuchende Felder werden dabei zum einen die politische Geschichte der beiden Länder im 20. Jahrhundert sein, die Entwicklung eines Nationalbewusstseins sowie der Grad an Rechtsstaatlichkeit. Die Untersuchung der Medien als Transmissionsriemen zwischen Zivilgesellschaft und Regime wird die Darstellung ergänzen. Die zu verfolgende These, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, ist die Annahme, dass nicht der Grad an Repression bzw. Autoritarismus, sondern die historischen Wurzeln der Zivilgesellschaft und deren Nationalbewusstein den wesentlichen Unterschied zwischen der Ukraine und Weißrussland darstellen und daher die längere Lebensdauer des Lukaschenko-Regimes erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff: Zivilgesellschaft
- Zivilgesellschaft und Nationalbewusstein in Weißrussland und der Ukraine
- 1.1 Weißrussland
- 1.2 Ukraine
- 1.3 Zwischenfazit Zivilgesellschaft
- Regimevergleich Lukaschenko und Kutschma: Handlungsrahmen der Zivilgesellschaft
- 2.1 Das System Lukaschenko
- a) Kollektivismus - Paternalismus – Autoritarismus – Isolationismus
- b) Der schleichende Staatsstreich und die Aufweichung der Rechtsstaatlichkeit
- 2.2 Kutschma: Der aufgehaltene Diktator?
- a) Die missglückten Reformen von Staat und Gesellschaft
- b) Der Weg zur Diktatur:
- 2.3 Zwischenfazit Regimevergleich
- Medien
- 3.1 Weißrussland
- a) Medienmonopol des Staates
- b) unabhängige Medien
- c) Wahrnehmung unabhängiger Medien in der Öffentlichkeit
- 3.2 Ukraine
- a) Eingeschränkter Einfluss des Staates und „Oligo-TV"
- b) Der Fall Gongadse und die Folgen
- 3.3 Zwischenfazit Medien
- Zusammenfassung: Wie erklärt sich die höhere Stabilität des weißrussischen Regimes?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Vergleich der politischen Entwicklungen in Weißrussland und der Ukraine und der Frage, warum das Lukaschenko-Regime eine höhere Stabilität aufweist als das ukrainische System. Die Arbeit untersucht, welche Unterschiede in den beiden Ländern zu der unterschiedlichen politischen Entwicklung geführt haben.
- Die Rolle der Zivilgesellschaft in Weißrussland und der Ukraine
- Der Einfluss des Nationalbewusstseins auf die politische Entwicklung
- Der Vergleich der politischen Systeme in Weißrussland und der Ukraine
- Die Bedeutung der Medien im Kontext der politischen Entwicklung
- Die Frage nach der Stabilität von autoritären Regimen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation und die Fragestellung der Arbeit dar. Sie beschreibt die "Orangene Revolution" in der Ukraine und die fehlende Massenbewegung in Weißrussland. Der Autor argumentiert, dass historische Wurzeln der Zivilgesellschaft und deren Nationalbewusstsein die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Ländern darstellen.
Im zweiten Kapitel wird der Begriff "Zivilgesellschaft" definiert und die Bedeutung einer funktionierenden Zivilgesellschaft für demokratische Prozesse erläutert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der politischen Geschichte der Ukraine und Weißrusslands im 20. Jahrhundert. Es wird untersucht, inwiefern die Bedingungen für eine funktionierende Zivilgesellschaft in den beiden Ländern gegeben waren und welche Impulse oder Proteste aus der Zivilgesellschaft hervorgerufen wurden.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Regimevergleich zwischen Lukaschenko und Kutschma. Es wird der Handlungsrahmen der Zivilgesellschaft unter den jeweiligen Regimen untersucht, wobei insbesondere die Rolle der Rechtsstaatlichkeit betrachtet wird.
Das fünfte Kapitel analysiert die Rolle der Medien in Weißrussland und der Ukraine. Es wird untersucht, inwiefern die Medien als Transmissionsriemen zwischen der Zivilgesellschaft und den Regimen dienen und welcher Einfluss der Staat auf die Medien hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit untersucht die Themen Zivilgesellschaft, Nationalbewusstsein, Regimevergleich, Medien, Stabilität von autoritären Regimen, Weißrussland, Ukraine, Lukaschenko, Kutschma, "Orangene Revolution", Rechtsstaatlichkeit, politische Geschichte, politische Entwicklung, Medienmonopol.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "Orangene Revolution"?
Eine Serie von Massenprotesten in der Ukraine (2004/05) gegen Wahlfälschungen, die schließlich zu einem demokratischen Regierungswechsel führte.
Warum gab es in Weißrussland keinen ähnlichen Dominoeffekt?
Die Arbeit nennt historische Wurzeln der Zivilgesellschaft und ein schwächer ausgeprägtes Nationalbewusstsein als Hauptgründe für die Stabilität Lukaschenkos.
Wie unterscheiden sich die Systeme Lukaschenko und Kutschma?
Lukaschenko etablierte ein autoritäres System mit Staatsmonopolen, während Kutschmas System in der Ukraine durch Oligarchen-Einfluss und schwächere Kontrolle geprägt war.
Welche Rolle spielten die Medien beim demokratischen Wechsel?
In der Ukraine dienten Medien (trotz Drucks) als Transmissionsriemen für die Zivilgesellschaft, während in Weißrussland ein staatliches Medienmonopol herrschte.
Wer war Gongadse?
Ein ermordeter ukrainischer Journalist, dessen Tod 2001 als Auslöser für erste große Massenbewegungen gegen das Kutschma-Regime gilt.
- Quote paper
- Stefanie Treutler (Author), 2005, "Heute die Ukraine – morgen Weißrussland." Eine Kettenreaktion demokratischer Wechsel in Osteuropa?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75487