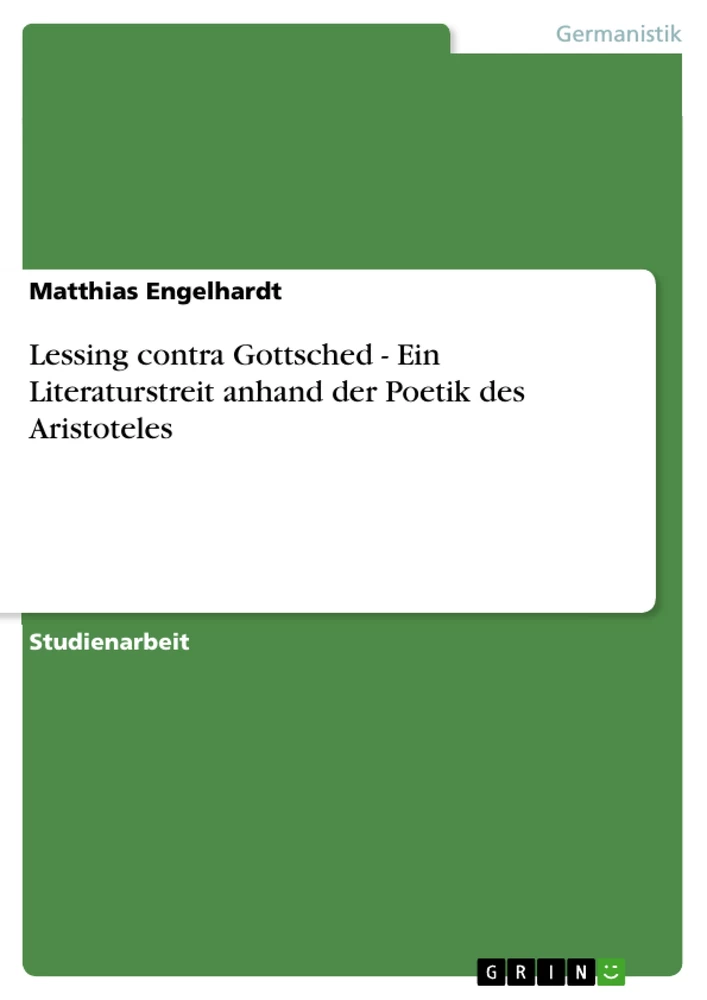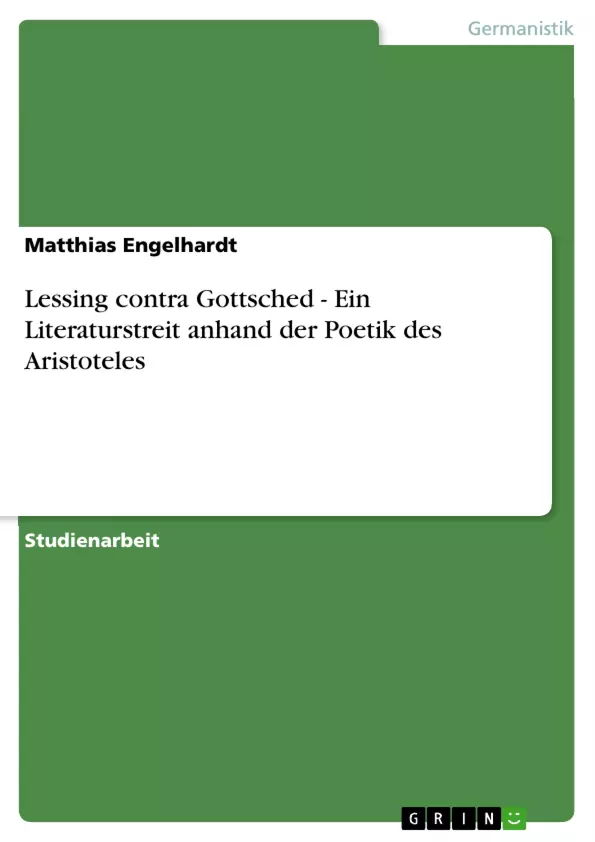Diese Arbeit will dem Literaturstreit zwischen Gottsched und Lessing auf den Grund gehen, will ihr unterschiedliches Verständnis von Aristoteles nachzeichnen und aufzeigen, in wie weit sich Gottsched vom Theater des französischen Klassizismus beeinflussen ließ, während Lessing das theatrale Maß aller Dinge in den Werken des Engländers und auf den ersten Blick antiaristotelisch eingestellten William Shakespeare (1564-1616) sah.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturhistorischer Hintergrund
- Gottscheds „Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen“
- „Von der Dichtkunst“ von Aristoteles
- Aristoteles: mimêsis und mythos
- Aristoteles und catharsis durch eleos und phobos
- Die Dramaturgie des Aristoteles
- Gottscheds annektiertes Kulturerbe
- Gottscheds Bezugnahme auf Aristoteles
- Das Theater des französischen Klassizismus
- Leistung von und Reaktionen auf Gottscheds Poetik
- „Von der Dichtkunst“ von Aristoteles
- Lessings „Briefe“ und „Hamburgische Dramaturgie“
- Lessings Reaktion auf „Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen“
- Lessings Poetik
- Lessings Loslösung von der Ständeklausel
- Lessings Neuinterpretation der Katharsistheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Literaturstreit zwischen Gottsched und Lessing im 18. Jahrhundert, wobei deren unterschiedliches Verständnis der Poetik des Aristoteles im Zentrum steht. Dabei werden Gottscheds Einflüsse durch das Theater des französischen Klassizismus beleuchtet, während Lessings Gegenentwurf anhand der Werke Shakespeares betrachtet wird.
- Die Rezeption der Poetik des Aristoteles im 18. Jahrhundert
- Die Reform des deutschen Theaters durch Gottsched und Lessing
- Der Einfluss des französischen Klassizismus auf Gottscheds Poetik
- Lessings Kritik an Gottscheds Theaterreform
- Die Katharsistheorie als zentrales Thema des Streits
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Arbeit und stellt die zentralen Figuren und den Fokus des Literaturstreits vor. Kapitel zwei beleuchtet den kulturhistorischen Kontext des frühen 18. Jahrhunderts in Deutschland und die Situation des Theaters. Das dritte Kapitel analysiert Gottscheds „Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen“ und die Rezeption der Poetik des Aristoteles durch Gottsched. Außerdem wird die Bedeutung des französischen Klassizismus für Gottscheds Theaterreform hervorgehoben. Kapitel vier beschäftigt sich mit Lessings „Briefe“ und „Hamburgische Dramaturgie“ und beleuchtet seine Kritik an Gottscheds Poetik und die Entwicklung seiner eigenen Theatertheorie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe mimêsis, catharsis, eikos, mythos, eleos und phobos aus der Poetik des Aristoteles. Sie analysiert deren Rezeption und Neuinterpretation durch Gottsched und Lessing im Kontext des Literaturstreits. Weitere wichtige Themen sind die Reform des deutschen Theaters, der Einfluss des französischen Klassizismus und die Entwicklung einer nationalen Theaterkultur.
- Citation du texte
- Matthias Engelhardt (Auteur), 2007, Lessing contra Gottsched - Ein Literaturstreit anhand der Poetik des Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75590