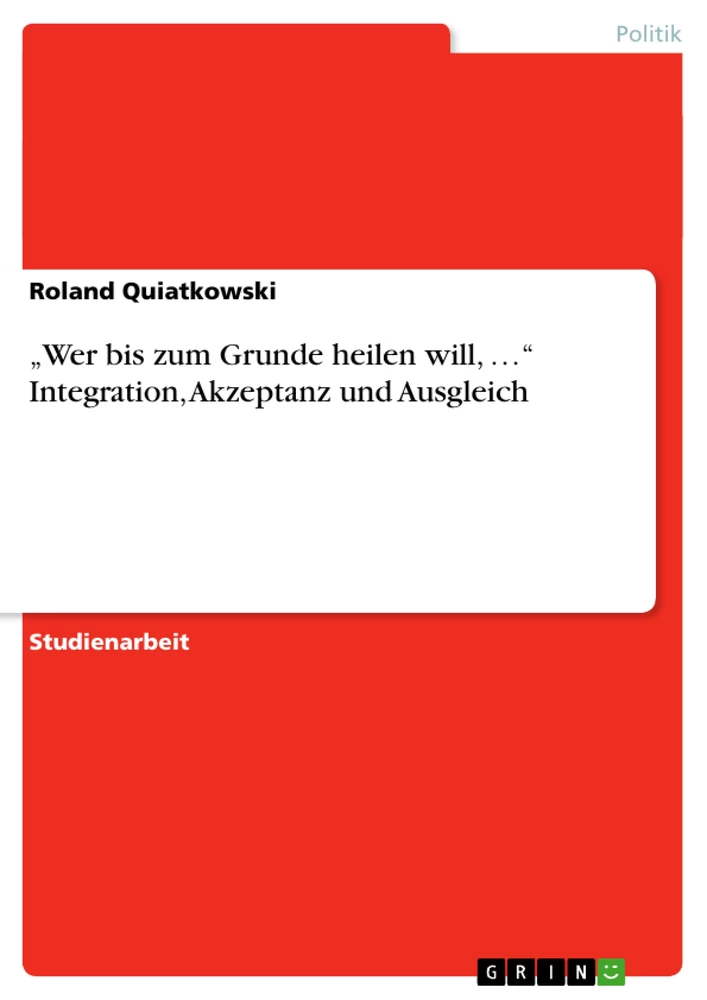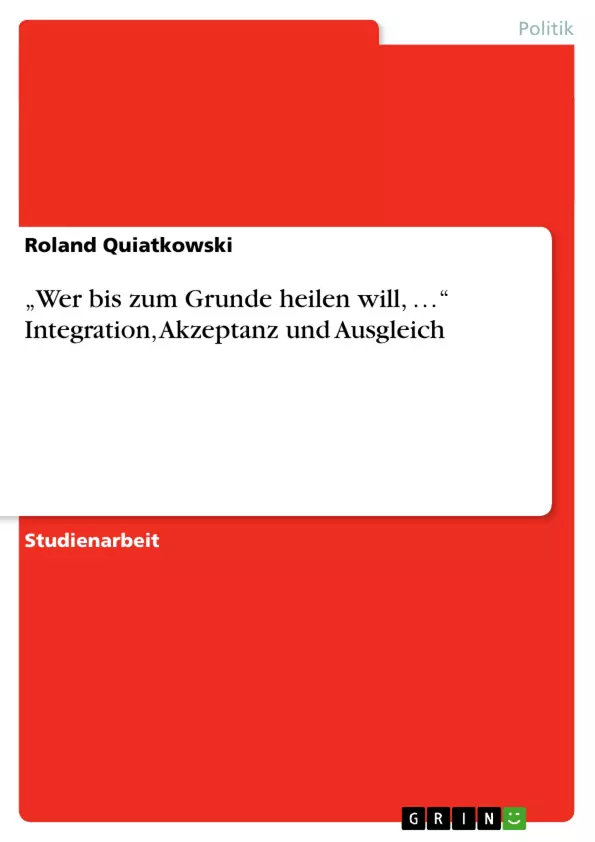„… der heilt zu Tod.“
Fußend auf dem grundsätzlichen Problem der Ordnung, nämlich dass Ordnungen nicht ohne ein letztes Element Unordnung bestehen können, entstand ein Bild wie es obiges Zitat des Pater Foelix perfekt auszudrücken vermag. Es stellt ein prinzipielles Problem jeder Macht dar. Denn es bedeutet, mindestens den letzten Grund für den Verlust eigener Autorität nicht aufheben zu können. So dass nach der Herstellung einer „perfekten“, nicht zu durchbrechenden Ordnung ein kompletter Stillstand dieses Systems die Folge wäre. Die mögliche Bedeutung eines solchen Stillstandes abzuschätzen, hieße aufzuzeigen, wie bewegungslos das System überhaupt sein kann. Mindestens wäre eine solche Macht auf geradezu philosophische Art und Weise langweilig für den letzten Menschen, der sie verwaltet.
Der Annahme, die Aktivitäten der „geordneten“ Umwelt abschätzen zu können, steht jedoch der Ausschluss zweier indiskutabler Voraussetzungen voran. Zum einen, inwiefern man überhaupt in der Lage sein kann, den Stillstand eines Systems festzustellen, in dem man sich selbst befindet und zum anderen, ob eine solche Ordnung in irgendeiner Weise im Rahmen des Möglichen läge.
...
betrachtenden Gegenstand der Hausarbeit. Nämlich der Frage, welches das geeignete Mittel ist, die Stagnation einer allzu perfekten Ordnung zu verhindern. Und das gerade, weil die Zersetzung der Ordnung nur von zwei möglichen Seiten ausgehen kann: Der Ordnung selbst in ihrer extremsten Ausprägung (ein Stillstand der Ordnung) und der Einführung nicht zu händelnder „Unwägbarkeiten.“
Eine solche Einführung einer Neuerung, die vom System vorher noch nicht betrachtet wurde, also auch nicht berechenbar gewesen sein konnte, wird im Folgenden als Integration bezeichnet. Integration von „Unwägbarkeiten“, die zukünftig vom auf „Perfektion“ zusteuernden System in die (Problem-) Prognosen miteinbezogen werden müssen.
...
drei großen Problemen. Es kann nämlich eine bestandssichernde Unordnung im abgeschlossenen, „ordentlichen“ System nicht existieren, da es ja ordentlich ist. Und damit kann auch kein von außen geschlossenes System bestehen. Weiterhin führt die permanente Einführung von Neuerungen zu einer Verminderung der Wahrscheinlichkeit der Einführung von Neuerungen. Und endlich kann mit Abnahme der Integrationswahrscheinlichkeit von einer Vergrößerung der Berechenbarkeit von zukünftigen Ereignissen, die das System nicht kennen sollte, ausgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Problemdefinition
- Spontaneität wird geplant.
- Eine grundsätzliche Dichotomie?
- Gute Ordnung, schlechte Ordnung? ..
- Wohin also?
- Übertrag
- Konsequenzen für die Praxis
- Territorialstaat vs. Massenintegration.…….......
- Einfachheit als Erfolgsprinzip?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beschäftigt sich mit dem grundlegenden Problem der Ordnung und deren Auswirkungen auf Integration, Akzeptanz und Ausgleich. Er untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Ordnungspolitik in einem sich ständig wandelnden Umfeld und analysiert die Folgen von „Unwägbarkeiten“ für ein System, das auf „Perfektion“ zusteuert.
- Das Dilemma der Ordnung und die Notwendigkeit von Unordnung für deren Bestand
- Die Rolle von Integration als Mittel zur Bewältigung von „Unwägbarkeiten“
- Die Beziehung zwischen Ordnung und Vorhersehbarkeit
- Die Bedeutung von Akzeptanz und Toleranz für die Integration neuer Elemente in ein System
- Die Grenzen der Ordnung und die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit in einem dynamischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt das zentrale Thema der Hausarbeit ein: das Problem der Ordnung und die Frage, wie eine „perfekte“ Ordnung vermieden werden kann, um Stagnation zu verhindern. Sie stellt das Zitat von Pater Foelix vor, das das Dilemma der Ordnung veranschaulicht: Eine vollkommene Ordnung würde zu einem Stillstand führen, der mindestens langweilig, wenn nicht sogar bedrohlich wäre.
Zur Problemdefinition
Dieses Kapitel geht der Problemdefinition nach und argumentiert, dass ein vollständig abgeschlossenes System nicht existieren kann, da es der Integration von „Unwägbarkeiten“ bedarf, um Bestand zu haben. Die ständige Einführung von Neuem führt jedoch zu einer Verminderung der Wahrscheinlichkeit weiterer Integration, was die Vorhersehbarkeit des Systems erhöht.
Mit einem Beispiel vom Spielzeug eines Kindes wird das Problem der Ordnung und Unordnung illustriert: Die Möglichkeit, Neues in ein System einzufügen, erfordert ein gewisses Maß an „Unordnung“, um Platz für die Integration zu schaffen. Ein vollständig geordnetes System würde den Stillstand und die Unfähigkeit zur Anpassung bedeuten.
Übertrag
Dieser Abschnitt wird in der Vorschau nicht berücksichtigt, da er möglicherweise wichtige Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen aus dem Text enthält.
Konsequenzen für die Praxis
Dieses Kapitel diskutiert die Konsequenzen der vorangegangenen Argumentation für die Praxis. Es werden Themen wie Territorialstaat vs. Massenintegration und die Rolle von Einfachheit als Erfolgsprinzip beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind Ordnung, Unordnung, Integration, Akzeptanz, Toleranz, Vorhersehbarkeit, System, Stagnation, „Unwägbarkeiten“, Anpassungsfähigkeit, Politik, Gesellschaft, und Evolution.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist eine "perfekte Ordnung" laut dem Text problematisch?
Eine vollkommene Ordnung würde zu einem totalen Stillstand des Systems führen. Ohne ein Element der Unordnung verliert eine Macht ihre Anpassungsfähigkeit und stagniert.
Was wird in diesem Kontext unter "Integration" verstanden?
Integration bezeichnet die Einführung von Neuerungen oder "Unwägbarkeiten" in ein System, die vorher nicht berechenbar waren, um dessen Stagnation zu verhindern.
Wie hängen Ordnung und Vorhersehbarkeit zusammen?
Mit abnehmender Wahrscheinlichkeit für die Integration von Neuem steigt die Berechenbarkeit zukünftiger Ereignisse, was das System jedoch gleichzeitig anfälliger für externe Schocks macht.
Welche Rolle spielt die Akzeptanz bei der Systemerhaltung?
Akzeptanz und Toleranz sind notwendig, um neue, unvorhersehbare Elemente in eine bestehende Ordnung aufzunehmen, ohne das gesamte System zu zerstören.
Was bedeutet das Prinzip der Einfachheit in der Praxis?
Der Text diskutiert Einfachheit als ein mögliches Erfolgsprinzip in der Ordnungspolitik, um die Handlungsfähigkeit gegenüber komplexen "Massenintegrationen" zu wahren.
- Citation du texte
- Roland Quiatkowski (Auteur), 2007, „Wer bis zum Grunde heilen will, …“ Integration, Akzeptanz und Ausgleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75655