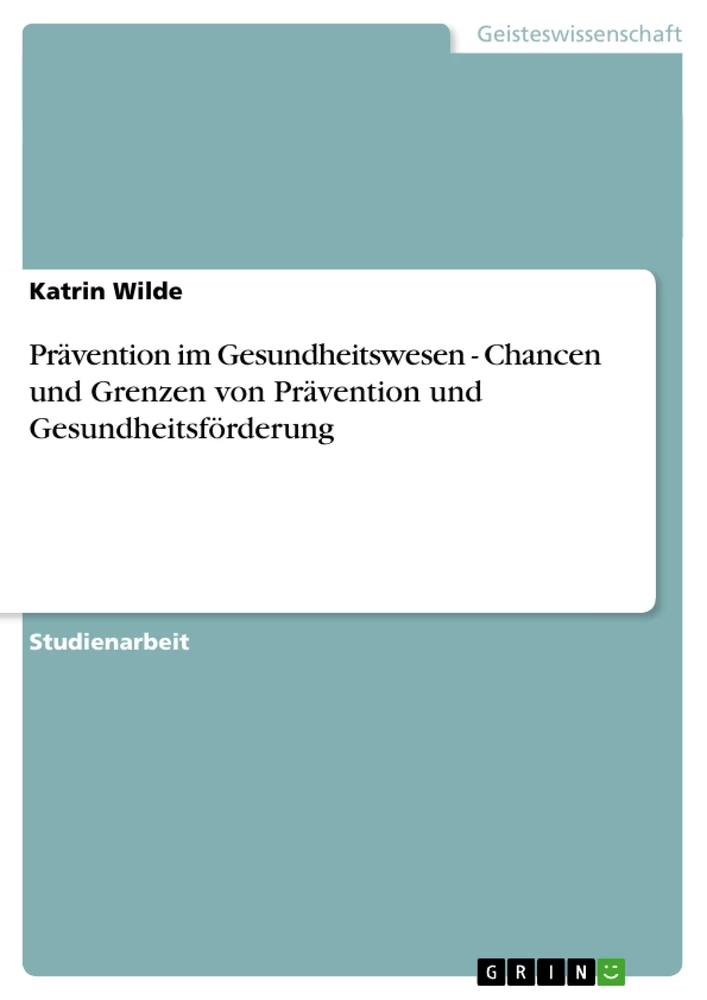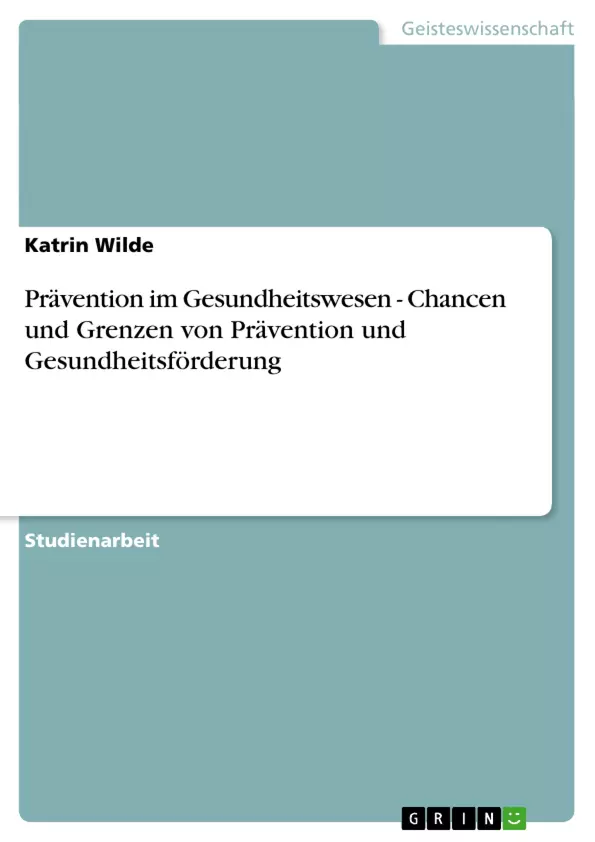In Anbetracht stetig steigender Kosten im Gesundheitswesen steht zurzeit einmal wieder die Prävention auf der politischen Agenda.
Neben ethischen Aspekten, welche wohl die Vorbeugung von Krankheiten der Behandlung und Heilung eindeutig vorziehen, stellt die ökonomische Sichtweise die Frage nach der Kosteneffizienz der präventiven Maßnahmen. Die aktuelle Diskussion um Kostenersparnis im Gesundheitswesen prüft also auch präventive Maßnahmen im Hinblick darauf, ob hierdurch eine Entlastung für die gesetzlichen Krankenkassen erreicht werden kann.
Präventive Maßnahmen haben jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Kostenentwicklung der Krankenkassen, vielmehr hat ein „Mehr an Gesundheit“ positive Auswirkungen auf viele gesellschaftliche Bereiche, hier sind insbesondere Wirtschaft, Unfallversicherung, Rentenversicherung etc. zu nennen.
Problematisch jedoch stellt sich insbesondere die Tatsache dar, dass nicht alle Akteure, welche ins Gesundheitswesen eingebunden sind, zwangsläufig ein Interesse an der Umsetzung präventiver Maßnahmen haben, hier sind z.B. Ärzte und Krankenhäuser zu nennen, welche am gesunden Patienten selbstverständlich kaum verdienen können: Prävention ist aus deren Sichtweise also häufig unökonomisch. Somit stellt sich die Frage, ob und wie die verschiedenen Akteure in Präventionsmaßnahmen mit eingebunden werden können, und welche Reformen hierzu nützlich sein könnten.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich zunächst mit den theoretischen Grundlagen der Prävention befassen, die verschiedenen Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung anhand der verschiedenen Projektformen in der Primärprävention und Gesundheitsförderung aufzeigen, und schließlich die Akteure und ihre Einbindung in das Gesundheitssystem bezugnehmend auf Präventivmaßnahmen darstellen, um anschließend mögliche Reformen auf diesem Gebiet zu erörtern.
Beginnen möchte ich zunächst mit einer Definition des Begriffes „Prävention“:
„Prävention […] umfasst alle (zielgerichteten) Maßnahmen und Aktivitäten, die eine bestimmte gesundheitliche Schädigung verhindern, weniger wahrscheinlich machen oder verzögern“. Im Weiteren lassen sich verschiedene Formen von Prävention unterscheiden...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen der Prävention
- Theoretische Grundlagen
- Antonovskys Modell der Salutogenese
- Prävention und habituelles Handeln
- Projekte in der Primärprävention und Gesundheitsförderung
- Der individuelle Ansatz
- Der Setting-Ansatz
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Kampagnen für die Gesamtbevölkerung
- Akteure
- Gesetzliche Krankenversicherungen
- Staatliche Akteure
- Leistungserbringer / Ärzte
- Betriebe / Wirtschaft
- Pharmaindustrie
- Patienten / Versicherte
- Reformansätze
- Bisherige Gesetzgebung
- Das Präventionsgesetz 2005
- Reformvorschläge
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext des deutschen Gesundheitssystems. Sie analysiert die verschiedenen Formen und Ansätze der Prävention, ihre theoretischen Grundlagen, die beteiligten Akteure sowie mögliche Reformansätze.
- Die Bedeutung der Prävention im Hinblick auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen
- Die unterschiedlichen Formen der Prävention (z.B. Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention, Verhältnisprävention)
- Die Rolle der Akteure im Gesundheitssystem (z.B. Krankenkassen, Staat, Ärzte, Betriebe)
- Die Herausforderungen und Chancen der Präventionsarbeit
- Mögliche Reformansätze zur Stärkung der Prävention im Gesundheitssystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der Prävention im deutschen Gesundheitswesen vor dem Hintergrund steigender Gesundheitskosten dar. Es werden die ökonomischen und ethischen Aspekte der Präventionsarbeit beleuchtet sowie die Frage nach der Einbindung verschiedener Akteure im Gesundheitssystem.
- Formen der Prävention: Dieses Kapitel definiert verschiedene Formen der Prävention, wie Primär-, Sekundär-, und Tertiärprävention sowie Verhältnisprävention, und erläutert ihre jeweiligen Zielsetzungen.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt zwei wichtige theoretische Modelle der Prävention: Antonovskys Modell der Salutogenese und die Bedeutung habituellen Handelns für die Präventionsarbeit.
- Projekte in der Primärprävention und Gesundheitsförderung: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Ansätze und Projekte der Primärprävention und Gesundheitsförderung, darunter den individuellen Ansatz, den Setting-Ansatz, die betriebliche Gesundheitsförderung und Kampagnen für die Gesamtbevölkerung.
- Akteure: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Akteure, die an der Präventionsarbeit beteiligt sind, und beschreibt ihre jeweiligen Rollen und Interessen.
- Reformansätze: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Reformansätze zur Stärkung der Prävention im deutschen Gesundheitssystem, darunter die bisherige Gesetzgebung, das Präventionsgesetz 2005 und verschiedene Reformvorschläge.
Schlüsselwörter
Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitssystem, Kostenentwicklung, Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention, Verhältnisprävention, Salutogenese, habituelles Handeln, Akteure, Reformansätze, Präventionsgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Primärprävention?
Maßnahmen, die darauf abzielen, die Entstehung von Krankheiten bei Gesunden von vornherein zu verhindern (z. B. Impfungen oder gesunde Ernährung).
Was besagt das Modell der Salutogenese?
Nach Aaron Antonovsky fragt es nicht „Was macht krank?“, sondern „Was hält gesund?“ und betont die Rolle des Kohärenzgefühls.
Warum ist Prävention ökonomisch umstritten?
Während sie langfristig Kosten spart, ist sie kurzfristig teuer. Zudem verdienen Ärzte und Krankenhäuser oft mehr an der Heilung als an der Vorbeugung.
Was ist der Setting-Ansatz?
Prävention, die direkt in den Lebenswelten der Menschen stattfindet, wie in Schulen, Betrieben (betriebliche Gesundheitsförderung) oder Kommunen.
Welche Rolle spielt das Präventionsgesetz?
Es soll die Zusammenarbeit der Akteure (Krankenkassen, Staat, Betriebe) stärken und finanzielle Mittel für Präventionsprojekte verbindlich festlegen.
- Citation du texte
- Katrin Wilde (Auteur), 2004, Prävention im Gesundheitswesen - Chancen und Grenzen von Prävention und Gesundheitsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76190