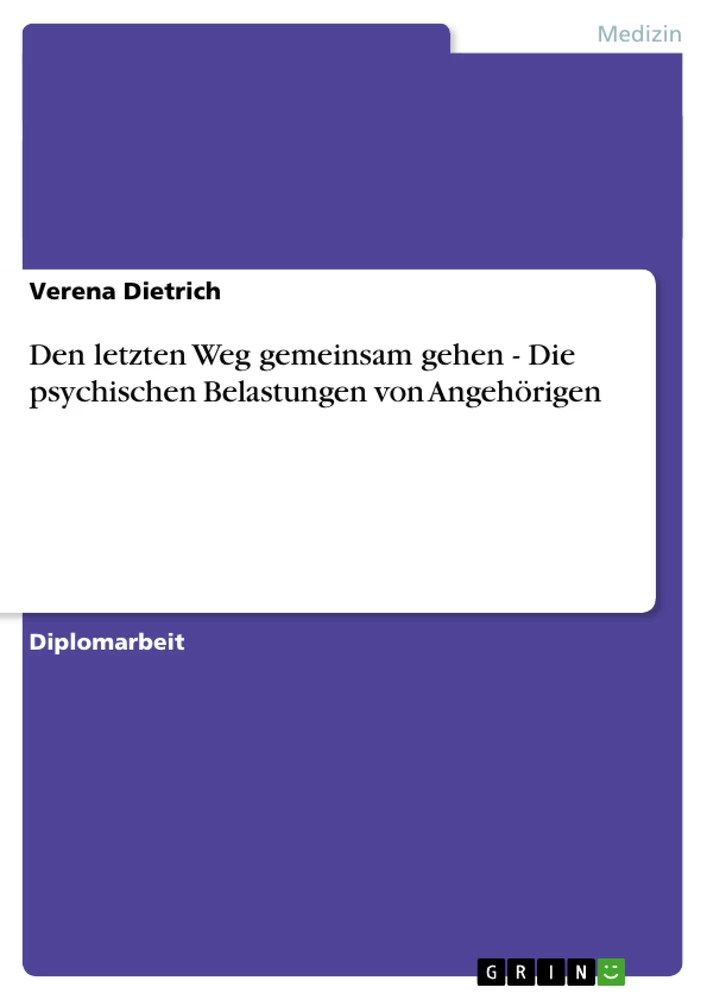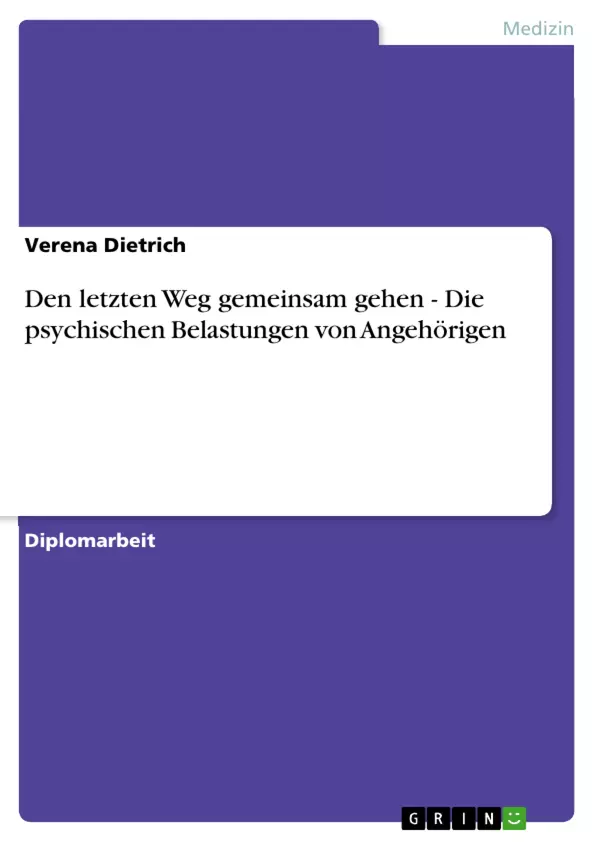Eine häusliche Sterbebegleitung durch ein nahes Familienmitglied wird von vielen Angehörigen gewünscht. Eine solche Form der Betreuung und Begleitung hat zum einen Auswirkungen auf den Begleiter und zum anderen auf die ganze Familie. Der zentrale Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf den psychischen Belastungen von Angehörigen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ihrem Angehörigen den letzten Wunsch zu erfüllen und ihm ein Sterben in seiner für ihn vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
Acht problemzentrierte Interviews wurden im Rahmen der qualitativen Untersuchung mit Angehörigen, die ein nahes Familienmitglied zu Hause bis zum Tod begleitet haben, durchgeführt. Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Ergebnisse und die Auswertung des Interviewmaterials dargestellt und diskutiert.
Es ergaben sich aus den Aussagen der Betroffenen eine Vielzahl von Belastungen, denen Menschen bei einer häuslichen Sterbebegleitung ausgesetzt sind. Als zentrale Belastungen wurden von den Angehörigen die Problematik der permanenten Bereitschaft und der inneren Unruhe, um das Wohlbefinden des Sterbenden zu erhalten oder herzustellen, genannt. Zudem war für viele eine weitere einnehmende Einschränkung, dass der Sterbende mit seinen Bedürfnissen den Tagesablauf bestimmt und sich die gesamte Familie darauf einstellen muss. Eine Ursache dieser Gefühle und Empfindungen sind die kontinuierlich zu leistenden Unterstützungsmaßnahmen und die zeitgleiche Verabreichung von starken Medikamenten. Das fehlende Fachwissen und die fehlende Fachkompetenz tragen weiterhin zu Gefühlen der Unsicherheit und Angst bei.
Die Ergebnisse bieten einen Anreiz für verschiedene Institutionen und Professionen, Aufträge für Information, Begleitung, Betreuung und Anleitung von Angehörigen zu leisten, damit Hauptbetreuungspersonen Ängste und Unsicherheiten verlieren und noch mehr Menschen die anspruchsvolle und intensive Aufgabe einer häuslichen Sterbebegleitung übernehmen. Zudem ist eine Weiterentwicklung von ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen, die sich mit der palliativen Versorgung beschäftigen, in Erwägung zu ziehen. Der besondere Fokus liegt hier auf dem Aspekt einer adäquaten Sterbebegleitung, mit dem Ziel die Angehörigen bei der Aufgabe zu unterstützen und mit pädagogischem Geschick zu begleiten
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT
- 2.1 AUSGANGSLAGE: DIE STERBEBEGLEITUNG DURCH ANGEHÖRIGE
- 2.1.1 STERBEBEGLEITUNG HEIẞT LEBENSBEGLEITUNG
- 2.1.2 DIE BEGLEITUNG VON STERBENDEN UND DESSEN ANGEHÖRIGER
- 2.1.3 ANFORDERUNGEN AN DEN BEGLEITER
- 2.2 GEGENSTAND UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT
- 2.1 AUSGANGSLAGE: DIE STERBEBEGLEITUNG DURCH ANGEHÖRIGE
- 3. AKTUELLE FORSCHUNGSERGEBNISSE, MODELLE UND THEORIEN ZUR FRAGESTELLUNG
- 3.1 DER STERBEPROZESS AUS PFLEGEWISSENSCHAFTLICHER SICHT
- 3.1.1 DAS PHASENMODELL VON ELISABETH KÜBLER-ROSS
- 3.1.2 MODELL DER HOFFNUNG DER UNHEILBAREN NACH HERBERT PLÜGGE
- 3.1.3 WEITERE MODELLE IM ÜBERBLICK
- 3.1.4 KRITISCHE WÜRDIGUNG UND DISKUSSION DER MODELLE
- 3.2 BELASTUNG, BEANSPRUCHUNG UND STRESS IM KONTEXT DER STERBEBEGLEITUNG
- 3.2.1 DAS BELASTUNGSEMPFINDEN VON ANGEHÖRIGEN
- 3.2.2 MODIFIZIERTES THEORETISCHES MODELL ZUR PFLEGEBEDINGTEN BELASTUNG
- 3.2.3 DER ,,PFLEGEKOMPASS“ ZUR EINSCHÄTZUNG VON BELASTUNG
- 3.2.4 DIE ERLEBTE BELASTUNG ALS STRESS
- 3.2.5 DAS BIOLOGISCHE STRESSMODELL NACH SEYLE
- 3.2.6 DAS TRANSAKTIONALE STRESSKONZEPT NACH LAZARUS
- 3.2.7 KRITISCHE WÜRDIGUNG UND DISKUSSION DER MODELLE
- 3.3 AKTUELLE FORSCHUNGSERGEBNISSE BEZOGEN AUF DIE FORSCHUNGSFRAGE
- 3.1 DER STERBEPROZESS AUS PFLEGEWISSENSCHAFTLICHER SICHT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die psychischen Belastungen von Angehörigen, die ein Familienmitglied zu Hause bis zum Tod begleiten. Ziel ist es, diese Belastungen zu identifizieren und zu beschreiben, um daraus Handlungsempfehlungen für Institutionen und Professionen abzuleiten.
- Psychische Belastung von Angehörigen bei häuslicher Sterbebegleitung
- Analyse von Stressfaktoren und deren Auswirkungen
- Auswertung qualitativer Interviews mit betroffenen Angehörigen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Unterstützung von Angehörigen
- Bewertung bestehender Modelle und Theorien zur Sterbebegleitung und Belastung
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema der häuslichen Sterbebegleitung und die damit verbundenen psychischen Belastungen der Angehörigen ein. Sie skizziert die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage der Arbeit. Der Zitat von Rinpoche (1999, S. 211) betont die Bedeutung bedingungsloser Liebe in der Sterbebegleitung als einleitendes Motiv.
2. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Situation der Sterbebegleitung durch Angehörige, beleuchtet die Bedeutung der Lebensbegleitung im Sterbeprozess und benennt die Anforderungen an die Begleitpersonen. Es formuliert den konkreten Gegenstand und die Zielsetzung der Arbeit, welche die Untersuchung der psychischen Belastung der Angehörigen im Fokus hat.
3. AKTUELLE FORSCHUNGSERGEBNISSE, MODELLE UND THEORIEN ZUR FRAGESTELLUNG: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über relevante Forschungsergebnisse, Modelle und Theorien zum Sterbeprozess und den damit verbundenen Belastungen. Es werden verschiedene Modelle wie das Phasenmodell von Kübler-Ross und das Modell der Hoffnung der Unheilbaren nach Plügge vorgestellt und kritisch diskutiert. Darüber hinaus werden Theorien zu Belastung, Beanspruchung und Stress im Kontext der Sterbebegleitung erläutert und in Beziehung zur Forschungsfrage gesetzt. Der Abschnitt zu aktuellen Forschungsergebnissen liefert den thematischen Hintergrund für die eigene empirische Untersuchung.
Schlüsselwörter
Häusliche Sterbebegleitung, psychische Belastung, Angehörige, qualitative Forschung, Inhaltsanalyse, Stress, Modell von Kübler-Ross, Modell der Hoffnung, Palliativversorgung, ambulante Pflege.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Psychische Belastungen von Angehörigen bei häuslicher Sterbebegleitung
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die psychischen Belastungen von Angehörigen, die ein Familienmitglied zu Hause bis zum Tod begleiten. Ziel ist die Identifizierung und Beschreibung dieser Belastungen, um daraus Handlungsempfehlungen für Institutionen und Professionen abzuleiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die psychische Belastung von Angehörigen bei häuslicher Sterbebegleitung, analysiert Stressfaktoren und deren Auswirkungen, wertet qualitative Interviews mit betroffenen Angehörigen aus und entwickelt Handlungsempfehlungen zur Unterstützung von Angehörigen. Zudem werden bestehende Modelle und Theorien zur Sterbebegleitung und Belastung bewertet.
Welche Modelle und Theorien werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet das Phasenmodell von Elisabeth Kübler-Ross, das Modell der Hoffnung der Unheilbaren nach Herbert Plügge, weitere Modelle zum Sterbeprozess und Theorien zu Belastung, Beanspruchung und Stress im Kontext der Sterbebegleitung (z.B. das biologische Stressmodell nach Seyle und das transaktionale Stresskonzept nach Lazarus). Diese Modelle werden kritisch diskutiert und in Beziehung zur Forschungsfrage gesetzt.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf qualitativer Forschung und beinhaltet die Auswertung qualitativer Interviews mit betroffenen Angehörigen. Die genaue Methode der Auswertung (z.B. Inhaltsanalyse) wird im Haupttext detailliert beschrieben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Ausgangslage und Zielsetzung, ein Kapitel zu aktuellen Forschungsergebnissen, Modellen und Theorien, und weitere Kapitel (die im vorliegenden Preview nicht detailliert beschrieben sind), die die Ergebnisse und Schlussfolgerungen präsentieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Häusliche Sterbebegleitung, psychische Belastung, Angehörige, qualitative Forschung, Inhaltsanalyse, Stress, Modell von Kübler-Ross, Modell der Hoffnung, Palliativversorgung, ambulante Pflege.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Identifizierung und Beschreibung der psychischen Belastungen von Angehörigen bei der häuslichen Sterbebegleitung, um daraus Handlungsempfehlungen für eine bessere Unterstützung der Angehörigen abzuleiten.
Wie wird die Einleitung der Arbeit gestaltet?
Die Einleitung führt in das Thema der häuslichen Sterbebegleitung und die damit verbundenen psychischen Belastungen der Angehörigen ein. Sie skizziert die Relevanz des Themas, die Forschungsfrage und enthält ein einleitendes Zitat von Rinpoche (1999, S. 211) zur Bedeutung bedingungsloser Liebe in der Sterbebegleitung.
- Quote paper
- Verena Dietrich (Author), 2006, Den letzten Weg gemeinsam gehen - Die psychischen Belastungen von Angehörigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76420