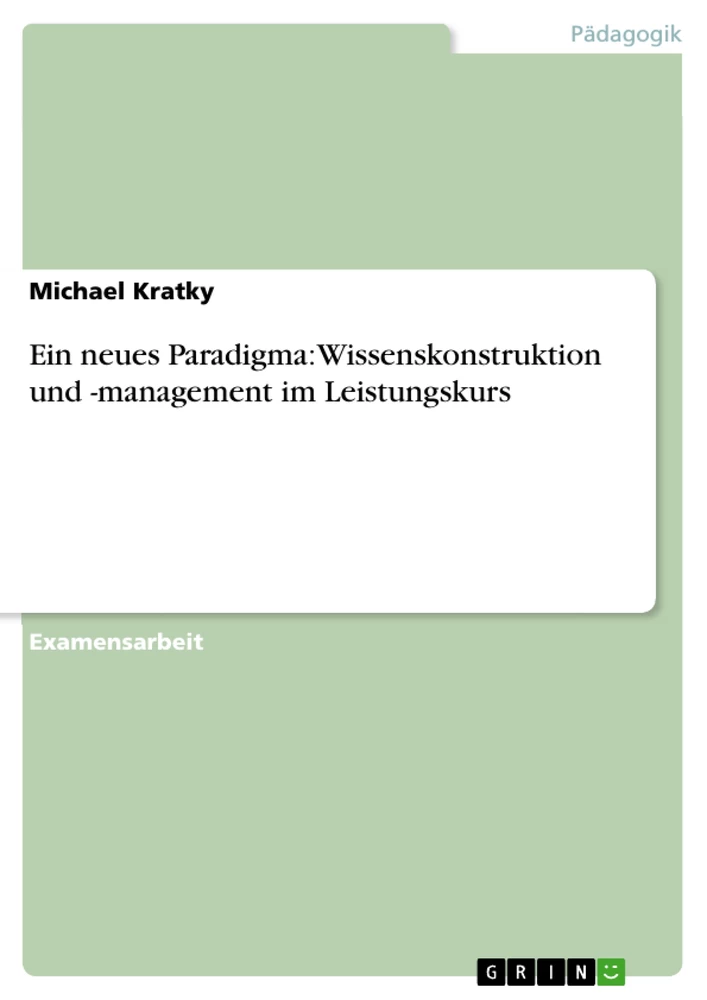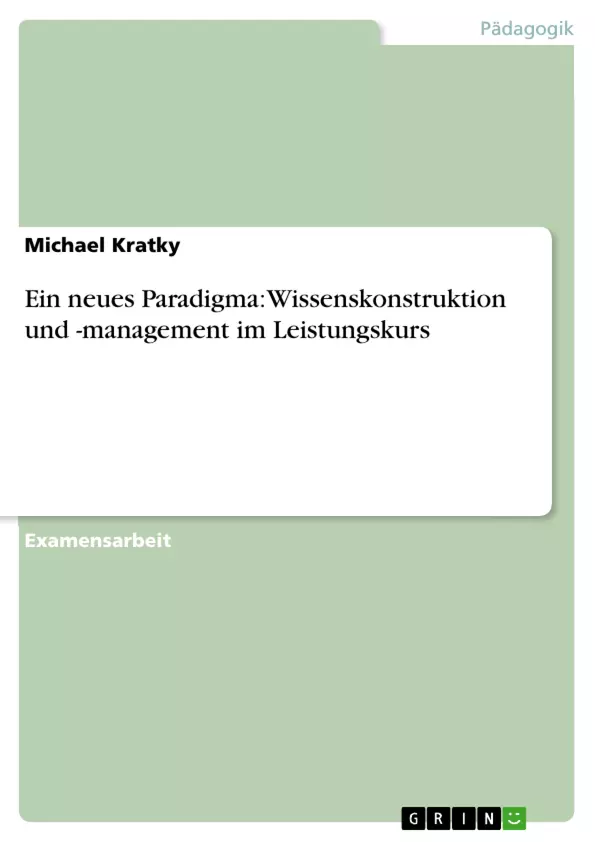Diese Arbeit zeigt, vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels von der Industrie- zur Wissensgesellschaft, ein Konzept zur Vorbereitung der Schüler auf die veränderten Konditionen im neuen Paradigma auf. Ausgehend von einer Analyse des derzeitigen Standes in der aktuellen Fachdidaktikliteratur wird auf das anthropologisch motivierte Unterrichtsmodell „Lernen durch Lehren“ verwiesen, das als integratives Modell nicht nur den unter anderem in Nieweler postulierten Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen gerecht wird, also Soft Skills vermittelt, sondern durch die Applikation der neuronalen Netzwerkstruktur auf das konkrete Unterrichtsgeschehen die kollektive Konstruktion von Wissen, also den Aufbau von Hard Skills, fördert. Als radikal handlungsorientiertes Konzept verkörpert LdL nicht nur kognitionspsychologisch einen konstruktivistischen Ansatz, sondern präsentiert sich als partizipatives, kollektives Prinzip zur Wissenskonstruktion im Klassenzimmer, wobei lerntheoretische Basis und praktische Anwendung direkt verzahnt sind. Universales Ziel aller Einzelbausteine ist der systematische Aufbau von Netzsensibilität. Netzsensibilität bezeichnet ein Gespür für die Auswirkungen der Globalisierung und für die Interdependenz bzw. Verwobenheit der Welt und aller ihrer Konstituenten (Menschen, Regionen, Länder, Kontinente), das nicht nur kognitiv registriert sondern auch emotional wahrgenommen wird. Bei LdL wird diese (Kontext-) Sensibilität zunächst einmal innerhalb des Klassenzimmers aufgebaut, wenn die Lerner aufmerksamkeitsökonomisch und ressourcenorientiert interagieren, das Wissen aller einzelnen Lerner einbeziehen und gemeinsam neues Wissen konstruieren. Die Kompetenz Netzsensibilität wirkt sich dann beim Verlassen des Labors „Klassenzimmer“ besonders positiv aus, wenn die Welt an sich ins Blickfeld rückt und die Schüler aufgrund ihres Trainings routiniert und souverän damit umgehen können. Die Ausdehnung der Ressourcenorientierung, verbunden mit dem aktiven Suchen von Informationsquellen außerhalb des Klassenzimmers, geht von der Prämisse aus, dass die Träger von Ressourcen in der Wissensgesellschaft vor allem Menschen sind. Die zunächst innerhalb des Klassenraums etablierte Netzsensibilität gewinnt mit dem Internet und seinen Kommunikationsmöglichkeiten eine schier grenzenlose Dimension.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation und Zielsetzung dieser Arbeit
- Zum Verständnis von Prinzip und Entstehung dieser Arbeit
- Ausgangspunkt: Paradigmenwechsel in der Fremdsprachendidaktik
- Zur aktuellen Literatur in der Französischdidaktik
- Kompetenzbegriff
- Idee des Konstruierens und Lernerautonomie
- Unterrichtsentwicklung und Fokus auf Handlungsorientierung
- Entwicklungen im Internet
- Günstige, legitime Infrastrukturen für den „Wissensverkehr“
- Initiative: virtuelle Vorlesung
- Theoriefundament und didaktisch-wissenschaftliche Prädispositionen
- Anthropologische Prämissen (und damit Aufbau eines Lernerkonstrukts)
- Kontrolle und exploratives Verhalten
- Problemlösekompetenz
- Flow und intrinsische Motivation
- Grundbedürfnisse als Manifestation des Kontrollbegriffs
- Systemtheoretische Grundlagen
- Das didaktische Modell „Lernen durch Lehren“
- Unterrichtsmodell auf anthropologisch motiviertem Gerüst
- Konkrete Strukturen und fremdsprachendidaktische Einordnung
- LdL-Prinzipien im Zusammenhang
- Wissen und dessen Generierung
- Daten, Informationen, Wissen und Wissensgenerierung
- Voraussetzungen der Wissensgenerierung in Unternehmen
- Enabler der Wissensgenierung im LdL-Unterricht
- Wissensmetabolismus im Unterricht
- Netzwerke und Emergenzen
- Applikation des Netzwerkgedankens auf den LK und dessen Implikationen
- Die Organisationsform „Gehirn“
- Netzwerkstruktur: Die Klasse als neuronales Netz
- Rivalisierende vs. kooperative Zielstrukturen und Lernmotivation
- Wirkung der kooperativen Lernform „Gehirn“
- Inhalte und Aktivitäten
- Zur Relevanz geistesgeschichtlich-literarischen Strukturwissens
- Kontemporäres Zeitgeschehen
- Kompetenzerwerb und -Training am Beispiel von Reisen
- Metareflexion und Transparenz
- Die Wiki-Seiten des LK
- Zusammenfassung und Ausblick
- Universales Motto: Sensibilität und Routine im Ungang mit intellektuellen Ressourcen
- Konsequenzen für die Lehrerbildung
- Glossar: die wichtigsten Begriffe im neuen Paradigma
- Aufmerksamkeitsökonomie
- Emergenz
- Flow
- Ganzheitlichkeit
- Handlungsorientierung
- Klassenraumdiskurs
- Lernerautonomie
- Linearität (a priori vs. a posteriori)
- Netzsensibilität
- Neuronale Struktur (Gehirnmetapher)
- Ressourcenorientierung
- Wissensgesellschaft
- Wissensmetabolismus
- Bibliographische Hinweise
- Zitierte und weiterführende Literatur
- Websites
- Videomaterial
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Zulassungsarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines neuen Unterrichtsparadigmas, das die Herausforderungen der Wissensgesellschaft und die Möglichkeiten der Informationstechnologie für den Fremdsprachenunterricht berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt auf der konkreten Anwendung des didaktischen Modells Lernen durch Lehren (LdL) im Leistungskurs Französisch.
- Kollektive Wissenskonstruktion im Unterricht
- Anthropologische und systemtheoretische Grundlagen des LdL-Modells
- Wissensgesellschaft und ihre Implikationen für die Didaktik
- Die Rolle der Informationstechnologie im Unterricht
- Entwicklung und Implementierung eines Netzwerkgedankens im Leistungskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit legt die Motivation und die Zielsetzung dar. Es werden die Herausforderungen der Wissensgesellschaft und die veränderte Rolle der Schule in der heutigen Zeit beleuchtet. Außerdem wird auf die Bedeutung der Informationstechnologie im Unterricht hingewiesen und das LdL-Modell als Grundlage für die Analyse des Leistungskurses Französisch eingeführt.
Kapitel 2 analysiert die aktuellen Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik und beleuchtet die Rezeption des LdL-Modells in der Literatur. Die Arbeit verweist auf die Möglichkeiten des Internets und die Rolle der Wikipedia für den Unterricht. Es wird außerdem die Initiative zur Erstellung einer virtuellen Vorlesung zum Thema Handlungsorientierung vorgestellt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des LdL-Modells und präsentiert ein Lernerkonstrukt, das auf anthropologischen und systemtheoretischen Prinzipien beruht. Es werden zentrale Begriffe wie Kontrolle, Problemlösekompetenz, Flow und Grundbedürfnisse erläutert und in den Kontext des LdL-Modells eingebettet.
Kapitel 4 widmet sich der Applikation des Netzwerkgedankens auf den Leistungskurs Französisch. Die Klasse wird als neuronales Netz (Gehirn) betrachtet und die Bedeutung von kooperativen Lernformen sowie die Herausforderungen der Leistungsbewertung diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung von konkreten Inhalten und Aktivitäten des Kurses, wie die Behandlung von geistesgeschichtlich-literarischen Strukturwissen, kontemporärem Zeitgeschehen, Klassenfahrten und der Förderung von Metareflexion und Transparenz.
Kapitel 5 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die Konsequenzen für die Lehrerbildung. Es wird die Bedeutung der Netzsensibilität und die Notwendigkeit einer adäquaten Vorbereitung der Lehrkräfte für den Umgang mit den Herausforderungen der Wissensgesellschaft betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem didaktischen Modell „Lernen durch Lehren“ (LdL), der kollektiven Wissenskonstruktion, der Wissensgesellschaft, der Informationstechnologie, der Wikipedia, dem Netzwerkgedanken, der Gehirnmetapher, dem Konzept der Netzsensibilität und den Schlüsselqualifikationen im Kontext des Fremdsprachenunterrichts.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Modell „Lernen durch Lehren“ (LdL)?
LdL ist ein handlungsorientiertes Unterrichtsmodell, bei dem Schüler die Rolle des Lehrenden übernehmen, um Wissen aktiv und kollektiv zu konstruieren.
Was versteht man unter „Netzsensibilität“?
Es bezeichnet ein Gespür für die globale Interdependenz und die Fähigkeit, intellektuelle Ressourcen in Netzwerken souverän zu nutzen.
Wie wird die Klasse als „neuronales Netz“ betrachtet?
Die Organisationsform orientiert sich am Gehirn; durch kooperative Zielstrukturen interagieren Lerner ressourcenorientiert und generieren gemeinsam Wissen.
Welche Rolle spielt das Internet im LdL-Unterricht?
Das Internet bietet grenzenlose Kommunikationsmöglichkeiten und Ressourcen, wie z. B. Wikis, die für die kollektive Wissenskonstruktion genutzt werden.
Was ist das Ziel des Paradigmenwechsels in der Didaktik?
Ziel ist die Vorbereitung der Schüler auf die Wissensgesellschaft durch die Vermittlung von Soft Skills, Lernerautonomie und komplexen Handlungskompetenzen.
- Citar trabajo
- Michael Kratky (Autor), 2007, Ein neues Paradigma: Wissenskonstruktion und -management im Leistungskurs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76557