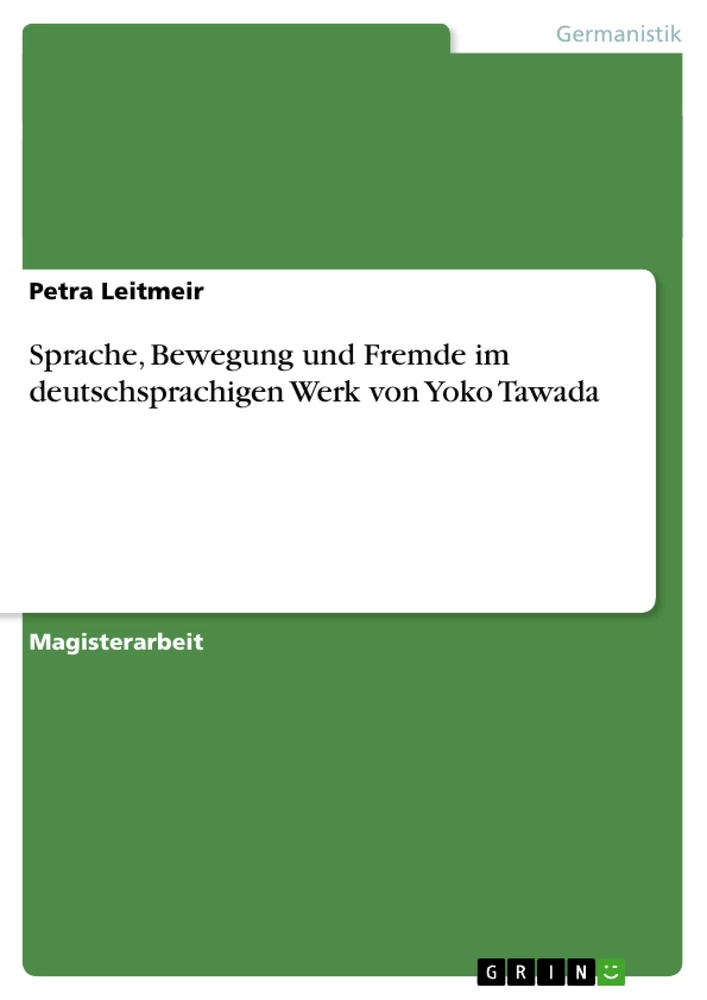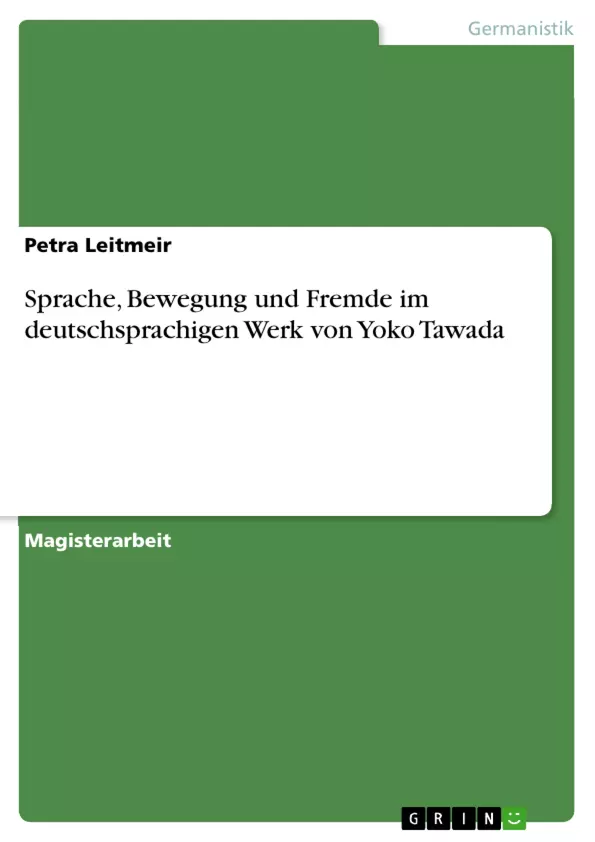Ein in der Neueren deutschen Literatur oft vernachlässigtes Feld stellt die Interkulturelle Germanistik da. Sie umfasst deutschsprachige Werke nicht deutschsprachiger Autoren. Diese können entweder aus der Nachfolgegeneration von Einwandern stammen, aber auch selbst aus den unterschiedlichen Gründen zugewandert sein. Oft werden dabei Migrationserfahrungen bzw. Erfahrungen in einem kulturellen "Zwischenraum" literarisch verarbeitet. Gerne werden diese mit Homi Bhabas Theorie des "Third Space" gedanklich gefasst. Bei Yoko Tawada liegt der Fall etwas anders, da sich ihre Werke gegen derartige theoretische Durchdringung sperren. Sie steht in der deutschsprachigen Literatur einzigartig da. Nicht nur, dass die japanische Autorin aus eigenem Willen und nicht aus politischer Notwendigkeit nach Deutschland kam. Auch ihr Verständnis von Interkulturalität geht weit über eine literarische Verarbeitung von Fremdheitserfahrung hinaus. Vertraut mit den gängigen theoretischen Diskursen um Sprache und Fremdheit, setzt Tawada ihre "Fremdheitserfahrung" in der Sprache selbst an. Da aus Tawadas Sicht die Sprache die Realitätswahrnehmung konstituiert, ist Fremdheit bei ihr keine "Alltagserfahrung" sondern wird vorerst zum sprachlichen Phänomen, was sich aber dennoch körperlich wahrnehmen lund damit im Alltag erfahren lässt. Fremde ist bei Tawada eingewandert in die Sprach selbst. Während die Essays die durch Sprache gemachte alltägliche Fremde eines Ichs sichtbar machen und nie klar ist, wo die Grenzen jener Ich-Identitäten anfangen und wo sie aufhören experimentiert sie in ihren Theaterstücken mit einer "Sprache" der Fremde und versucht auch gezielt, eine neue Sprache daraus hervorgehen zu lassen, die jene Polarität von eigen und fremd gar nicht mehr entstehen lässt. Hierbei bewegt sie sich auf einem sehr produktiven wie und gleichzeitig fatalen Pfad, denn während ihre Sprachexperimente tatsächlich neue kreative Varianten sprachlichen Erlebens hervorbringen ist das Scheitern der Überwindung einer polaren Sprache auch immer schon mit inbegriffen. Die Arbeit versucht, die sprachliche Verfahrensweise von Tawada anhand einiger von Yoko Tawadas Prosatexten und Theaterstücken aufzuzeigen und jene existenzielle Dimension von Fremdheit herauszuarbeiten, die sich durch Tawadas Werke zieht und gleichzeitig in existentielle Bereiche vordringt, da sie die Gültigkeit jedweder Systeme in Frage stellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- I) Forschungsüberblick
- Zusammenfassung
- Textanalytischer Teil
- II)
- 1. Talisman
- a) „Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht“
- b) „Eine Scheibengeschichte“
- 2. Die Theaterstücke
- a) „Die Kranichmaske, die bei Nacht strahlt“
- a1) „Fremde“ und Wassermetaphorik
- a2) Tod, Sarg und weibliche Leiche
- a3) „Sprache der Toten“ - „Sprache der Lebenden“
- a4) Die Bedeutung der Zahlen im Prolog
- a5) Die Stimmen
- a5.1. Die Zahl „Eins“ oder der Bruder
- a5.2. Die Zahl „Zwei“ oder die Schwester
- a5.3. Die Zahl „Drei“ oder der Nachbar
- a5.4. Die Zahl „Vier“ oder der Übersetzer
- a6) Die Verwandlungen/Das Maskenspiel
- b) „Wie der Wind im Ei“
- b1) Zur Handlung und den zentralen Personenkonstellationen
- b2) Fruchtbarkeits- und Schwangerschaftsmetaphorik
- b3) Das Schreibprojekt der Frau
- b4) Die Personen
- b5) Zur Verknüpfung von Inhalt und Sprache im Stück
- c) Zum Aufführungspotenzial beider Theaterstücke
- a) „Die Kranichmaske, die bei Nacht strahlt“
- 1. Talisman
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Auseinandersetzung Yoko Tawadas mit den Themen „Fremde“ und „Sprache“ in ihrem deutschsprachigen Werk. Das Hauptziel ist es, die wahrnehmungs- und sprachkritischen Dimensionen in ausgewählten Essays und Theaterstücken zu analysieren und aufzuzeigen, wie sich Tawadas Verständnis von „Fremdsprache“ entwickelt. Die Arbeit beleuchtet, wie Tawada über die bloße Darstellung persönlicher Migrationserfahrungen hinausgeht und sprachliche Konventionen hinterfragt.
- Sprachkritik und die Dekonstruktion kultureller Wahrnehmung
- Das Konzept der „Fremdsprache“ als metaphorische und existentielle Erfahrung
- Die Verbindung von Inhalt und Form in Tawadas Texten
- Intertextualität und Querverweise in Tawadas Werk
- Die Rolle der Migration in Tawadas literarischer Produktion
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung stellt Yoko Tawada als einzigartige Autorin in der deutschsprachigen Literatur vor und beschreibt ihren biographischen Hintergrund sowie ihre sprachliche und literarische Arbeitsweise. Sie hebt hervor, dass Tawadas Texte über eine rein biographische Verarbeitung von Migrationserfahrungen hinausgehen und eine tiefgreifende sprachkritische Reflexion beinhalten. Die Arbeit wird als Untersuchung von Tawadas literarischer Auseinandersetzung mit „Fremde“ und „Sprache“ angekündigt, wobei Essays und Theaterstücke analysiert werden, um die Entwicklung ihres Konzepts der „Fremdsprache“ zu verfolgen.
I) Forschungsüberblick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die vorhandene Sekundärliteratur zu Yoko Tawada. Es wird erläutert, warum der Fokus nicht nur auf die in der Arbeit behandelten Texte beschränkt ist, sondern auch die Herangehensweise der Forschungsaufsätze an Tawadas Schreibweise im Mittelpunkt steht. Der Überblick dient als Grundlage für die nachfolgende Analyse der ausgewählten Texte.
II) 1. Talisman: Dieser Abschnitt analysiert zwei Essays aus Tawadas Werk „Talisman“ und „Überseezungen“. „Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht“ und „Eine Scheibengeschichte“ werden auf ihre sprachkritischen und wahrnehmungskritischen Aspekte hin untersucht. Die Zusammenfassung beleuchtet, wie Tawada durch sprachliche Mittel kulturelle Wahrnehmungskonventionen hinterfragt und aufdeckt. Die Analyse zeigt auf, wie die Essays die Grundlage für die weiterführenden Überlegungen zu „Fremdheit“ in ihren Theaterstücken legen.
II) 2. Die Theaterstücke: Dieser Teil der Arbeit widmet sich der Analyse von Tawadas Theaterstücken „Die Kranichmaske, die bei Nacht strahlt“ und „Wie der Wind im Ei“. Die Zusammenfassung geht auf die Handlung, die zentralen Personenkonstellationen und die Metaphorik in beiden Stücken ein. Sie betont die enge Verknüpfung von Inhalt und Sprache, die assoziativen Zusammenhänge und intertextuellen Bezüge. Die Analyse fokussiert darauf, wie sich der Begriff der „Fremdsprache“ in den Theaterstücken von der Vorstellung einer konkreten Fremdsprache hin zu einer generellen „Fremdheit“ von Sprache verschiebt, die nicht mehr im Außen beheimatet ist.
Schlüsselwörter
Yoko Tawada, Fremdsprache, Sprache, Migration, Kulturkritik, Wahrnehmung, Sprachkritik, Theater, Essay, Intertextualität, Metaphorik, Japanische Literatur, Deutschsprachige Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Yoko Tawadas Werk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die literarische Auseinandersetzung Yoko Tawadas mit den Themen „Fremde“ und „Sprache“ in ihrem deutschsprachigen Werk. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der wahrnehmungs- und sprachkritischen Dimensionen in ausgewählten Essays und Theaterstücken, um Tawadas Verständnis von „Fremdsprache“ und dessen Entwicklung aufzuzeigen.
Welche Texte werden analysiert?
Die Analyse umfasst ausgewählte Essays aus Tawadas „Talisman“ (genauer: „Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht“ und „Eine Scheibengeschichte“) und ihre Theaterstücke „Die Kranichmaske, die bei Nacht strahlt“ und „Wie der Wind im Ei“. Die Arbeit geht über eine reine Inhaltsangabe hinaus und beleuchtet die sprachliche Gestaltung und die dahinterliegenden Konzepte.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Sprachkritik und die Dekonstruktion kultureller Wahrnehmung in Tawadas Texten. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Konzept der „Fremdsprache“ als metaphorische und existentielle Erfahrung. Die Verbindung von Inhalt und Form, Intertextualität, Querverweise und die Rolle der Migration in Tawadas Werk werden ebenfalls analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, einen Forschungsüberblick, einen Abschnitt zur Analyse von Essays aus „Talisman“, einen Abschnitt zur Analyse der Theaterstücke und einen Schluss. Der Abschnitt zu den Theaterstücken ist detailliert untergliedert und untersucht verschiedene Aspekte der Stücke, wie Handlung, Personenkonstellationen, Metaphorik und die Entwicklung des „Fremdsprache“-Konzepts.
Was ist das Hauptziel der Analyse?
Das Hauptziel ist es, die sprachkritische Reflexion in Tawadas Texten aufzuzeigen und zu analysieren, wie sie über die bloße Darstellung persönlicher Migrationserfahrungen hinausgeht und sprachliche Konventionen hinterfragt. Die Entwicklung ihres Verständnisses von „Fremdsprache“ von einer konkreten Fremdsprache hin zu einer generellen „Fremdheit“ der Sprache steht im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Yoko Tawada, Fremdsprache, Sprache, Migration, Kulturkritik, Wahrnehmung, Sprachkritik, Theater, Essay, Intertextualität, Metaphorik, Japanische Literatur, Deutschsprachige Literatur.
Wie wird der Forschungsüberblick genutzt?
Der Forschungsüberblick gibt einen Überblick über die Sekundärliteratur zu Yoko Tawada. Er dient als Grundlage für die Analyse und erläutert die Herangehensweise an Tawadas Schreibweise in der vorliegenden Arbeit.
Wie werden die Essays aus „Talisman“ analysiert?
Die Analyse der Essays aus „Talisman“ konzentriert sich auf ihre sprachkritischen und wahrnehmungskritischen Aspekte. Es wird untersucht, wie Tawada durch sprachliche Mittel kulturelle Wahrnehmungskonventionen hinterfragt und aufdeckt und wie diese Essays die Grundlage für die weiterführenden Überlegungen zu „Fremdheit“ in ihren Theaterstücken legen.
Wie werden die Theaterstücke analysiert?
Die Analyse der Theaterstücke konzentriert sich auf Handlung, Personenkonstellationen und Metaphorik. Besonders hervorgehoben wird die enge Verknüpfung von Inhalt und Sprache, assoziative Zusammenhänge und intertextuelle Bezüge. Die Analyse zeigt die Verschiebung des „Fremdsprache“-Konzepts von einer konkreten Fremdsprache hin zu einer generellen „Fremdheit“ von Sprache.
- Quote paper
- Petra Leitmeir (Author), 2007, Sprache, Bewegung und Fremde im deutschsprachigen Werk von Yoko Tawada, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76850